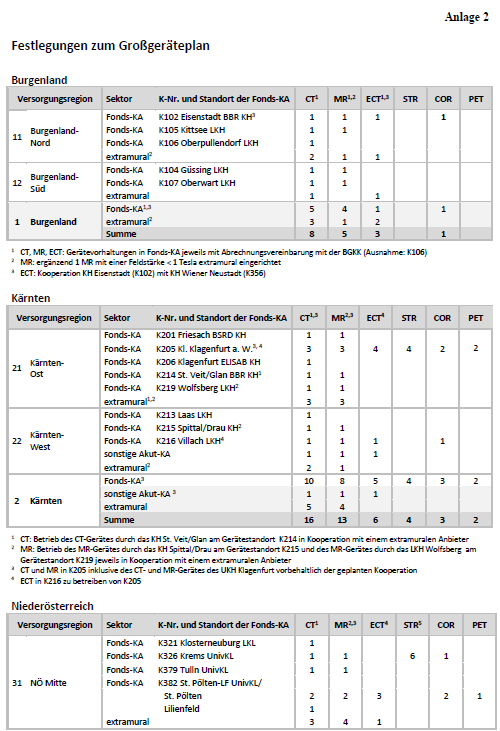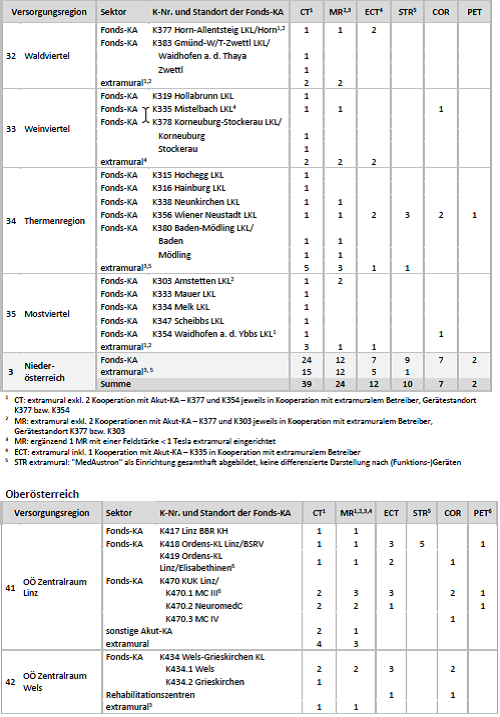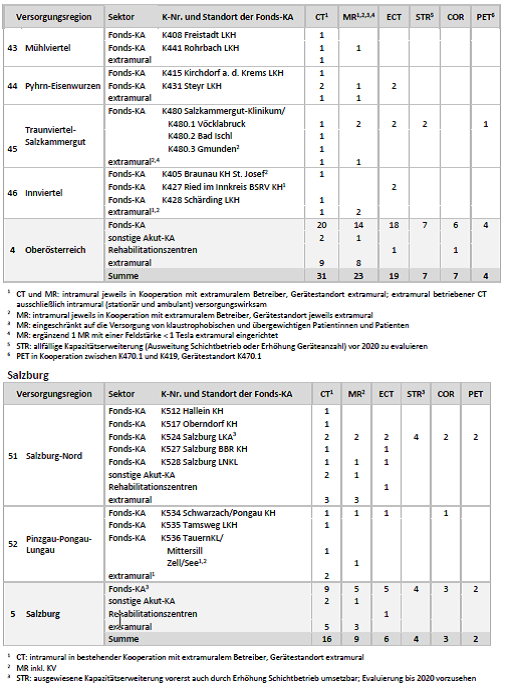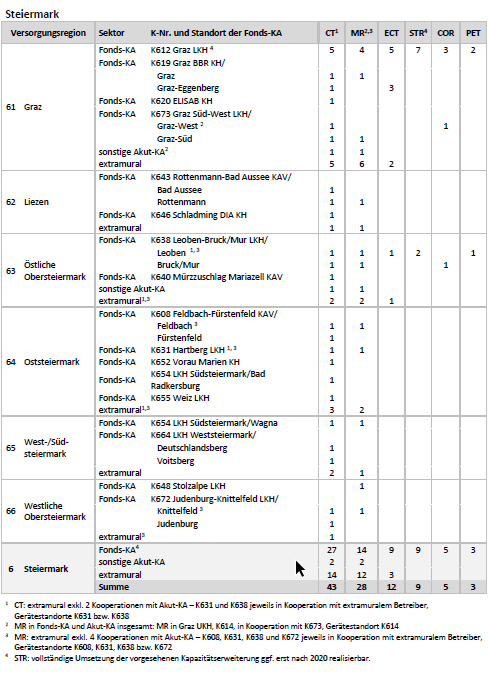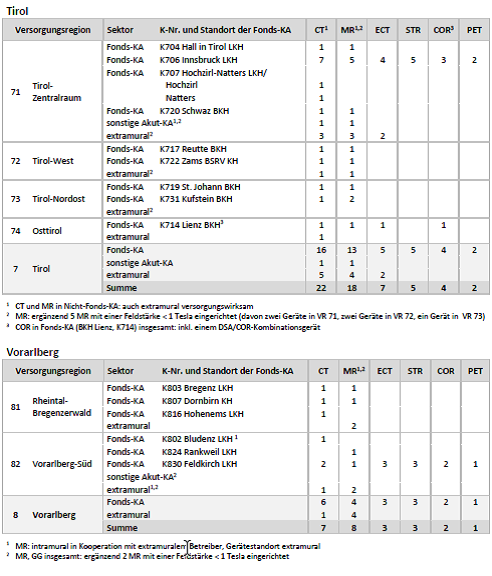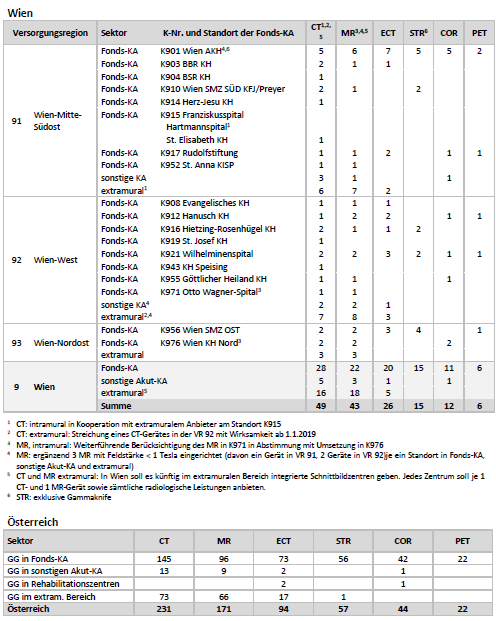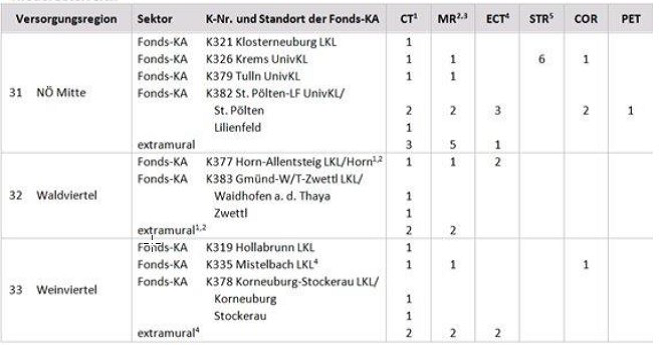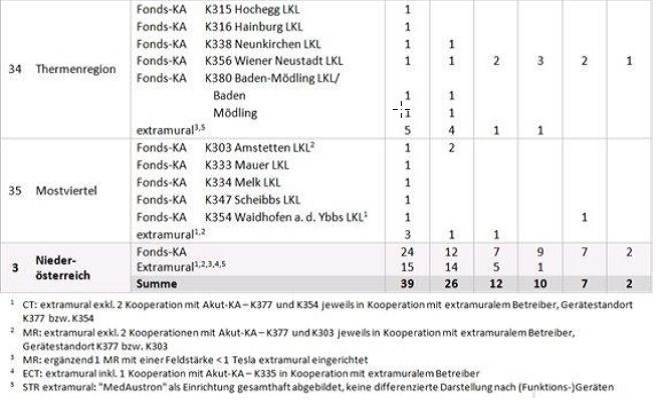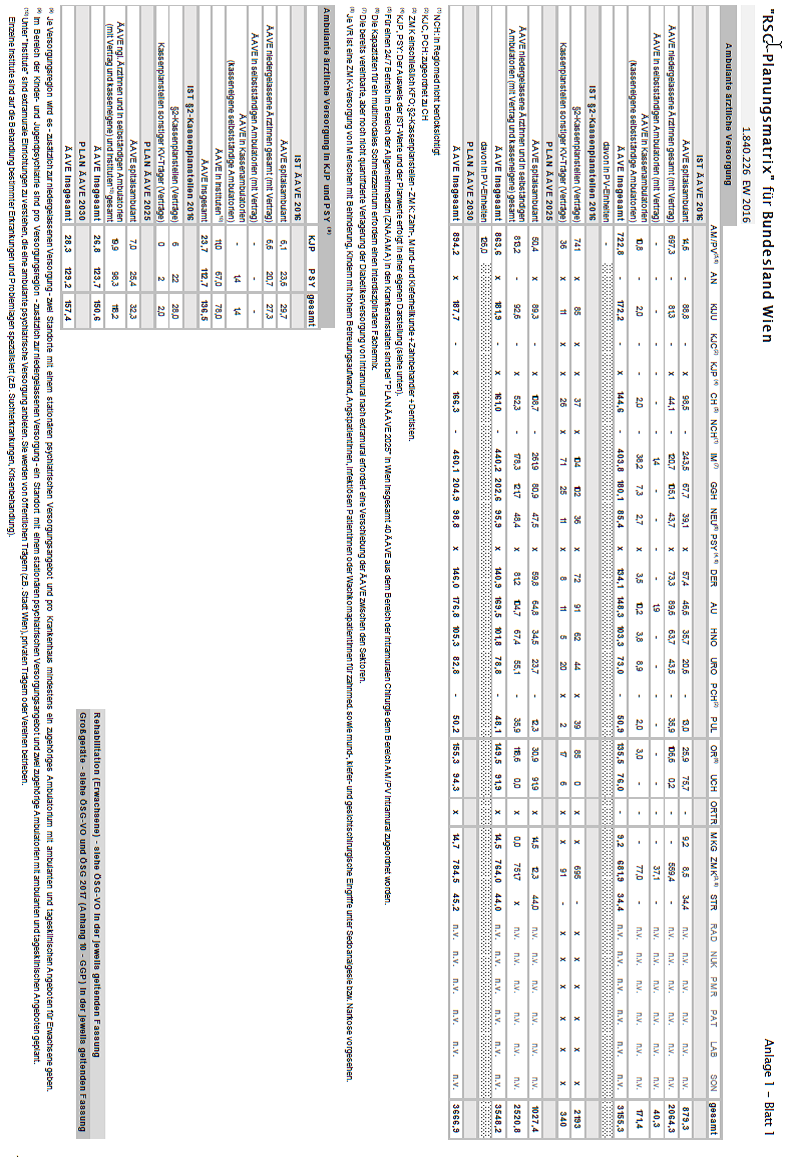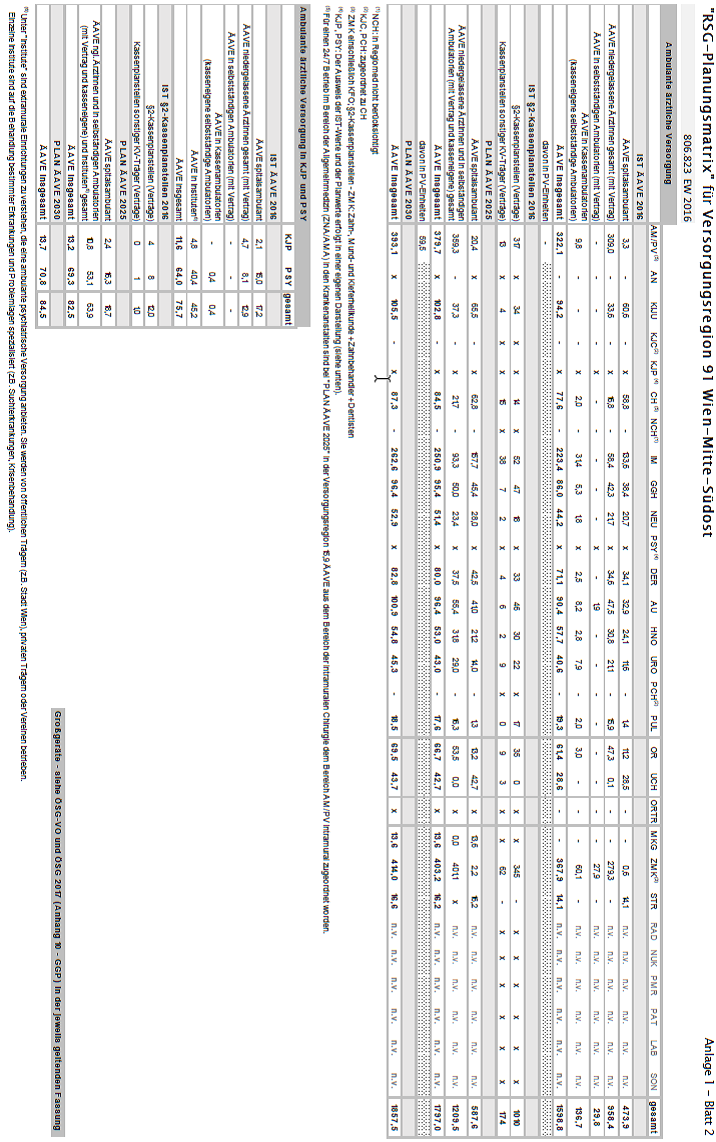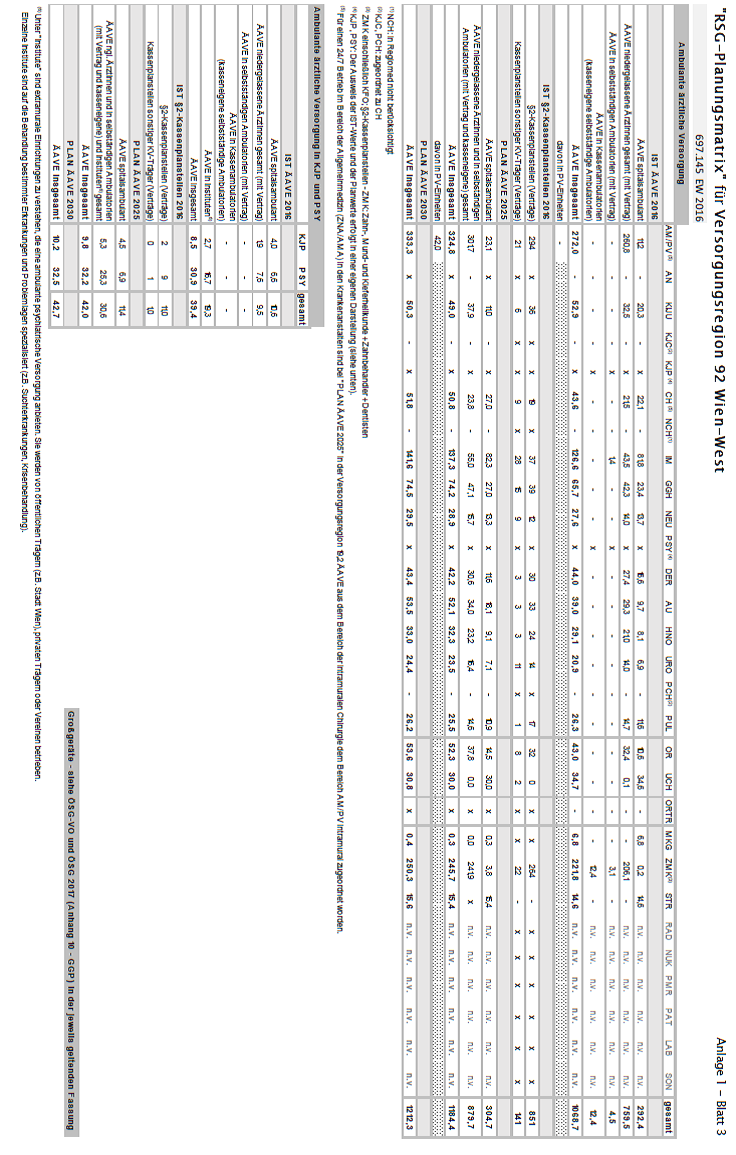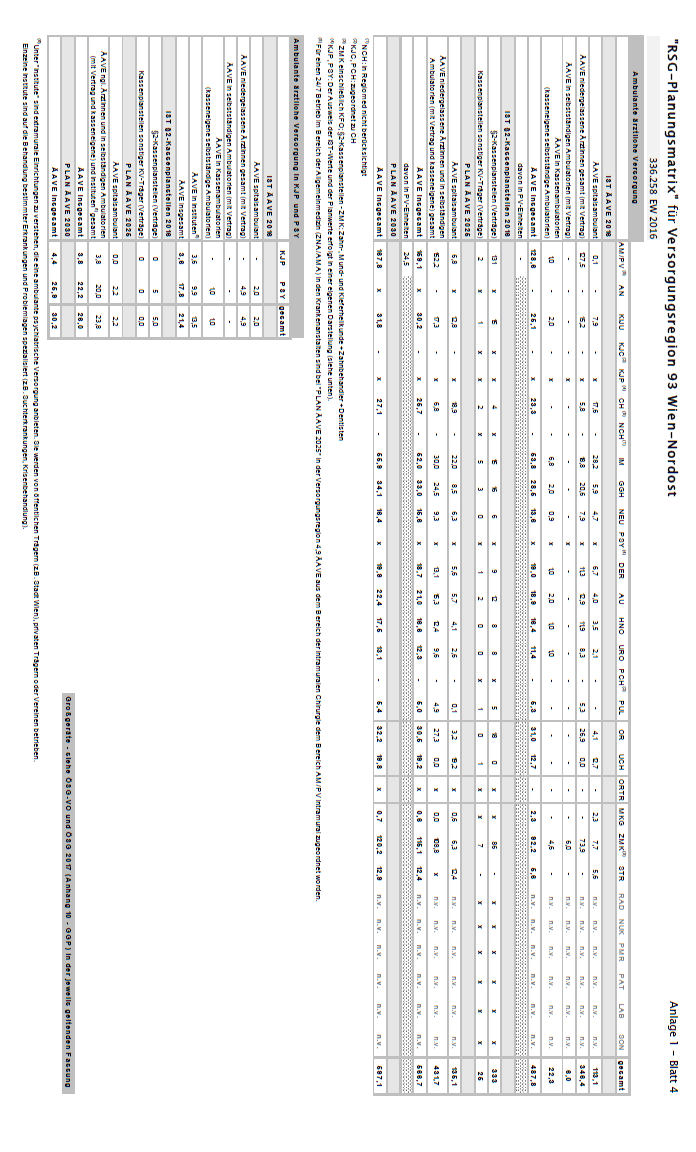Normen
B-VG Art10 Abs1 Z12
B-VG Art12 Abs1 Z1
B-VG Art15a
B-VG Art18 Abs1
B-VG Art20 Abs1
B-VG Art76 Abs1
B-VG Art83 Abs2
B-VG Art102
B-VG Art105 Abs2
B-VG Art139 Abs1 Z1
B-VG Art139 Abs1 Z2
B-VG Art140 Abs1 Z1 litb
B-VG Art142
StGG Art6
Vereinbarung gemäß Art15 B-VG zwischen Bund und Ländern betreffend die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl I 98/2017 Art4, Art5
Vereinbarung gemäß Art15 B-VG zwischen Bund und Ländern betreffend die Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I 97/2017
Gesundheits-ZielsteuerungsG §1, §18, §19, §20, §23 Abs1, §23 Abs2, §23 Abs4, §23 Abs5, §23 Abs6, §23 Abs7, §23 Abs8, §41
KAKuG §3a, §10a, §56a, §59h, §59k
Sbg KAG 2000 §4 Abs1
Nö KAG 1974 §10a, §10b, §10c
Oö KAG 1997 §6a
Wr KAG 1987 §5, §5a, §7
Nö Gesundheits- und SozialfondsG 2006 §2, §8, §9, §16, §17
Oö GesundheitsfondsG 2013 §17a, §17b
Wr GesundheitsfondsG 2017 §1, §2, §4, §7, §8, §9, §10, §20
ASVG §84a, §338
PrimärversorgungsG §2, §8, §14
GmbHG §16, §20, §34
Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018) Anlage 2
Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019) Anlage 2
Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplans Gesundheit Wien 2017 (RSG Wien – VO 2019) Anlage 1
VfGG §7 Abs1
European Case Law Identifier: ECLI:AT:VFGH:2022:G334.2021
Spruch:
I. 1. §23 Abs1 zweiter, dritter und vierter Satz, Abs2 zweiter, dritter, vierter und fünfter Satz und Abs4 bis 8 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G‑ZG), BGBl I Nr 26/2017, wird als verfassungswidrig aufgehoben.
2. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 in Kraft.
3. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.
4. Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser Aussprüche im Bundesgesetzblatt I verpflichtet.
II. Die §§18, 19 und 20 Abs1 und 2 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G‑ZG), BGBl I Nr 26/2017, §3a Abs3a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), BGBl Nr 1/1957, idF BGBl I Nr 26/2017, §17 NÖ Gesundheits- und Sozialfonds‑Gesetz 2006 (NÖGUS‑G 2006), LGBl für Niederösterreich Nr 134/2005 (LGSlg 9450), idF LGBl für Niederösterreich Nr 92/2017, §10c Abs3 NÖ Krankenanstaltengesetz (NÖ KAG), LGBl für Niederösterreich Nr 170/1974 (LGSlg 9440), idF LGBl für Niederösterreich Nr 93/2017, §17a Abs4 des Landesgesetzes über den Oö. Gesundheitsfonds (Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013), LGBl für Oberösterreich Nr 83/2013, idF LGBl für Oberösterreich Nr 96/2017, §6a Abs6a Oö. Krankenanstaltengesetz 1997 (Oö. KAG 1997), LGBl für Oberösterreich Nr 132/1997 (WV), idF LGBl für Oberösterreich Nr 97/2017, und §10 des Gesetzes über die Errichtung (Fortführung) eines Wiener Gesundheitsfonds 2017 (Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017), LGBl für Wien Nr 10/2018, werden nicht als verfassungswidrig aufgehoben.
III. Im Übrigen wird das Gesetzesprüfungsverfahren eingestellt.
IV. 1. Die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), und die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), in der Fassung der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019), kundgemacht am 5. November 2019 unter Nr 6/2019 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), waren, soweit sie als Verordnungen des Bundes in Geltung standen, gesetzwidrig.
2. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser Aussprüche im Bundesgesetzblatt II verpflichtet.
V. §4 und Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), waren, soweit sie als Verordnung des Landes Oberösterreich in Geltung standen, nicht gesetzwidrig.
VI. §4 und Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), in der Fassung der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019), kundgemacht am 5. November 2019 unter Nr 6/2019 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), waren, soweit sie als Verordnung des Landes Niederösterreich in Geltung standen, nicht gesetzwidrig.
Begründung
Entscheidungsgründe
I. Anlassverfahren, Prüfungsbeschluss und Vorverfahren
1. Beim Verfassungsgerichtshof sind folgende, zu V46/2019, V419/2020, V426/2020, V498/2020, V539/2020, V607/2020 und V244/2021 protokollierte, auf Art139 B‑VG gestützte Verordnungsprüfungsanträge anhängig:
1.1. V46/2019
1.1.1. Die Salzburger Landesregierung erteilte mit Bescheid vom 18. Februar 2016 der mitbeteiligten Partei des Anlassverfahrens vor dem Landesverwaltungsgericht Salzburg gemäß §14 Abs2 litc und f iVm §12a Abs1 und §12d Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000 (SKAG) die Bewilligung zur Erweiterung eines selbständigen Ambulatoriums durch Errichtung einer näher beschriebenen MR‑PET‑Anlage, welche Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie kombiniere, in Salzburg (Stadt). Gegen diesen Bescheid erhob der Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger Beschwerde.
1.1.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Landesverwaltungsgericht Salzburg im zweiten Rechtsgang (vgl VwGH 13.12.2018, Ro 2017/11/0009) den auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG gestützten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "§4 iVm der Tabelle betreffend Salzburg auf Seite 7 der Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG‑VO 2018) als gesetzwidrig", in eventu diese Verordnung zur Gänze aufheben.
Begründend führt das Landesverwaltungsgericht Salzburg aus, es habe das Verfahren nach den §§14 Abs2 iVm 12a Abs2a SKAG idF LGBl 25/2018 fortzusetzen. Das anhängige Bewilligungsverfahren habe die Errichtung und den Betrieb eines PET‑MR zum Gegenstand. Infolgedessen habe das Landesverwaltungsgericht §4 iVm der Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018) anzuwenden, da §4 Abs1 ÖSG VO 2018 unter dem Begriff "PET" in einem Klammerausdruck sowohl PET‑CT als auch PET‑MR erfasse und somit beide Gerätetypen unter die einschlägige Festlegung fielen. Die angefochtenen Bestimmungen seien somit präjudiziell.
In der Sache macht das antragstellende Landesverwaltungsgericht geltend, die angefochtene Verordnung sei "kompetenzrechtswidrig"; die Doppelfunktion der Gesundheitsplanungs GmbH führe zur Kompetenzwidrigkeit der Verordnung. Dies führe die Weisungsbefugnisse der obersten Organe "ad absurdum", weil keine umfassenden, klar voneinander abzugrenzenden Weisungsbefugnisse bestünden. Anstelle einer "Mischverordnung" hätten zwei getrennte Verordnungen erlassen werden müssen, weshalb die ÖSG VO 2018 auch gesetzwidrig sei.
1.2. V419/2020
1.2.1. Die mitbeteiligte Partei im Ausgangsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wien stellte mit Schriftsatz vom 30. August 2017 einen Antrag auf Vorabfeststellung des Bedarfs an der Erweiterung des Leistungsangebotes ihrer Krankenanstalt, eines Instituts für Kieferorthopädie (selbständiges Ambulatorium), um fünf weitere Behandlungsstühle zur kieferorthopädischen Behandlung von Patienten mit schwerwiegenden Zahnfehlstellungen samt Ausdehnung der Öffnungszeiten und Aufstockung des Personals gemäß §7 Abs2 iVm §5 Abs1 Wr. KAG. Dies entspricht nach den Feststellungen des antragstellenden Verwaltungsgerichtes Wien einem Versorgungsäquivalent (VEA) zur Versorgung von 100 neu begonnenen Fällen innerhalb eines Kalenderjahres. Die belangte Behörde des Ausgangsverfahrens hat mit Bescheid vom 15. November 2019 dem Antrag Folge gegeben und festgestellt, dass an der geplanten Änderung der Krankenanstalt ein Bedarf bestehe. Gegen diesen Bescheid erhob die Österreichische Zahnärztekammer Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien (§7 Abs2 iVm §5 Abs8 Wr. KAG). Sie begründete ihre Beschwerde unter anderem damit, dass die Bedarfsprüfung durch die Verwaltungsbehörde grob lückenhaft geblieben sei und die eingeholten Gutachten der Gesundheit Österreich GmbH keine taugliche Grundlage für ausreichende Feststellungen zu den bedarfsrelevanten Kriterien des §5 Abs3 Wr. KAG bilden würden. Am 9. Jänner 2020 trat die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplans Gesundheit Wien (RSG Wien – VO 2019), kundgemacht am 8. Jänner 2020 unter Nr 1/2020 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), in Kraft.
1.2.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Verwaltungsgericht Wien, gestützt auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG, den zu V419/2020 protokollierten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien, Kundmachung (RIS) 1/2020, zur Gänze", in eventu §1 Abs1 Z1 sowie Anlage 1 dieser Verordnung als gesetzwidrig aufheben.
Begründend führt das Verwaltungsgericht Wien auf das Wesentliche zusammengefasst aus, §23 G‑ZG als gesetzliche Grundlage der angefochtenen Verordnung verstoße gegen das Staatsorganisationsrecht: Die Konstruktion sei unsachlich. Es fehle den obersten Organen an effektiven Steuerungsmöglichkeiten. Fraglich sei, ob die verbandsübergreifende Beleihung mit dem Grundsatz der Trennung der Vollziehungsbereiche vereinbar sei. Die Verpflichtung der Landesgesetzgebung zur Beleihung einer bestimmten GmbH verstoße gegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG. Hinsichtlich des Gesundheitswesens fehle es an der Zustimmung der Länder iSv Art102 B‑VG. §10 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 ermangle der Zustimmung des Bundes zur Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH iSv Art97 Abs2 B‑VG. Die Kundmachungsbestimmung des §23 Abs6 G‑ZG sehe hinsichtlich der Angelegenheiten nach Art12 Abs1 Z1 B‑VG eine verfassungswidrige Mitwirkung von Bundesorganen, nämlich des das RIS bereitstellenden Bundesminsters, vor. Wenn aber die gesetzlichen Grundlagen unbedenklich sein sollten, so wäre die RSG Wien – VO gesetzwidrig, weil sie als "gemischte Verordnung" gegen den Grundsatz der Trennung der Vollziehungsbereiche verstoße.
1.3. V426/2020
1.3.1. Die mitbeteiligte Partei im Ausgangsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wien stellte mit Schriftsatz vom 8. November 2019 einen Antrag auf Vorabfeststellung des Bedarfs für ein Ambulatorium für Kinder- und Jugendheilkunde in 1100 Wien gemäß §7 Abs2 iVm §5 Abs1 Wr. KAG. Mit Stellungnahme vom 20. Jänner 2020 führte die Österreichische Ärztekammer aus, dass in Anbetracht des Vorhabens der Errichtung einer Gruppenpraxis für Kinder- und Jugendheilkunde am geplanten Standort von keinem Bedarf an einem selbständigen Ambulatorium auszugehen sei. Der Wiener Gesundheitsfonds führte in seiner Stellungnahme vom 20. Jänner 2020 aus, dass das Vorhaben im Hinblick auf die RSG Wien – VO 2019 plankonform sei. Die belangte Behörde des Ausgangsverfahrens stellte daraufhin mit Bescheid vom 26. Februar 2020 gemäß §5 Abs3a Wr. KAG die Plankonformität des Vorhabens fest. Gegen diesen Bescheid erhob die Österreichische Ärztekammer Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien (§7 Abs2 iVm §5 Abs8 Wr. KAG), in der ua geltend gemacht wird, dass eine konkrete Überprüfung des Bedarfs nicht nachvollziehbar sei und dass ein Gutachten zur Übereinstimmung des Vorhabens mit "den Verordnungen" einzuholen gewesen wäre.
1.3.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Verwaltungsgericht Wien, gestützt auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG, den zu V426/2020 protokollierten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien, Kundmachung (RIS) 1/2020, zur Gänze", in eventu §1 Abs1 Z1 sowie Anlage 1 dieser Verordnung als gesetzwidrig aufheben. Die vorgebrachten Bedenken entsprechen den im Verfahren zu V419/2020 geltend gemachten.
1.4. V498/2020
1.4.1. Die mitbeteiligte Partei im Ausgangsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wien stellte mit Schriftsatz vom 6. Februar 2020 einen Antrag auf Feststellung, dass das geplante Ambulatorium für Zahnmedizin an einem näher bezeichneten Standort in 1040 Wien gemäß §5 Abs3a Wr. KAG plankonform sei. Die belangte Behörde des Ausgangsverfahrens stellte daraufhin mit Bescheid vom 11. Mai 2020 gemäß §5 Abs3a Wr. KAG die Plankonformität des Vorhabens fest. Gegen diesen Bescheid erhob die Österreichische Zahnärztekammer Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien, in der ua Rechtswidrigkeit auf Grund der Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend gemacht und die Gesetz- und Verfassungswidrigkeit der Rechtsgrundlagen des angefochtenen Bescheides behauptet wird.
1.4.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Verwaltungsgericht Wien, gestützt auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG, den zu V498/2020 protokollierten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien, Kundmachung (RIS) 1/2020, zur Gänze", in eventu §1 Abs1 Z1 sowie Anlage 1 dieser Verordnung als gesetzwidrig aufheben. Die vorgebrachten Bedenken entsprechen den im Verfahren zu V419/2020 geltend gemachten.
1.5. V539/2020
1.5.1. Die mitbeteiligte Partei im Ausgangsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wien stellte mit Schriftsatz vom 31. Jänner 2020 einen Antrag auf Feststellung, dass das geplante Ambulatorium für Zahnmedizin an einem näher bezeichneten Standort in 1210 Wien gemäß §5 Abs3a Wr. KAG plankonform sei. Die belangte Behörde des Ausgangsverfahrens stellte daraufhin mit Bescheid vom 27. Mai 2020 gemäß §5 Abs3a Wr. KAG die Plankonformität des Vorhabens fest. Gegen diesen Bescheid erhob die Österreichische Zahnärztekammer Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien, in der ua inhaltliche Rechtswidrigkeit und Rechtswidrigkeit auf Grund der Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend gemacht und die Gesetz- und Verfassungswidrigkeit der Rechtsgrundlagen des angefochtenen Bescheides behauptet wird.
1.5.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Verwaltungsgericht Wien, gestützt auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG, den zu V539/2020 protokollierten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien, Kundmachung (RIS) 1/2020, zur Gänze", in eventu §1 Abs1 Z1 sowie Anlage 1 dieser Verordnung als gesetzwidrig aufheben. Die vorgebrachten Bedenken entsprechen den im Verfahren zu V419/2020 geltend gemachten.
1.6. V607/2020
1.6.1. Die mitbeteiligte Partei im Ausgangsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wien stellte mit Schriftsatz vom 30. Jänner 2020 einen Antrag auf Feststellung, dass das geplante Ambulatorium für Innere Medizin an einem näher bezeichneten Standort in 1210 Wien gemäß §5 Abs3a Wr. KAG plankonform sei. Die belangte Behörde des Ausgangsverfahrens stellte daraufhin mit Bescheid vom 21. September 2020 gemäß §5 Abs3a Wr. KAG die Plankonformität des Vorhabens fest. Gegen diesen Bescheid erhoben die Österreichische Gesundheitskasse und die Ärztekammer für Wien Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien. Die Österreichische Gesundheitskasse brachte vor, die Behörde habe nicht berücksichtigt, dass auf Grund des aktuellen Ist-Standes ärztlicher ambulanter Versorgungseinheiten (ÄAVE) bei Genehmigung des gegenständlichen Laboratoriums der verbindliche Planungszielwert für 2020 für Innere Medizin überschritten werde. Die Ärztekammer für Wien machte geltend, dass aus den Zahlen der RSG‑Verordnung kein Bedarf zu ersehen sei.
1.6.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Verwaltungsgericht Wien, gestützt auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG, den zu V607/2020 protokollierten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien, Kundmachung (RIS) 1/2020, zur Gänze", in eventu §1 Abs1 Z1 sowie Anlage 1 dieser Verordnung als gesetzwidrig aufheben. Die vorgebrachten Bedenken entsprechen den im Verfahren zu V419/2020 geltend gemachten Bedenken.
1.7. V244/2021
1.7.1. Die mitbeteiligte Partei im Ausgangsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wien stellte mit Schriftsatz vom 13. März 2020 einen Antrag auf Feststellung, dass das geplante Ambulatorium für Zahnmedizin an einem näher bezeichneten Standort in 1090 Wien gemäß §5 Abs3a Wr. KAG plankonform sei. Die belangte Behörde des Ausgangsverfahrens stellte mit Bescheid vom 15. April 2021 gemäß §5 Abs3a Wr. KAG die Plankonformität des Vorhabens fest. Gegen diesen Bescheid erhob die Österreichische Zahnärztekammer Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien. Sie machte ua geltend, dass die Grundlagen des angefochtenen Bescheides gesetz- und verfassungswidrig seien.
1.7.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Verwaltungsgericht Wien, gestützt auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG, den zu V244/2021 protokollierten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien, Kundmachung (RIS) 1/2020, zur Gänze", in eventu §1 Abs1 Z1 sowie Anlage 1 dieser Verordnung als gesetzwidrig aufheben. Die vorgebrachten Bedenken entsprechen den im Verfahren zu V419/2020 geltend gemachten.
2. Beim Verfassungsgerichtshof sind folgende, zu E2445/2019, zu E2462/2019 und zu E2872/2020 protokollierte, auf Art144 B‑VG gestützte Beschwerden anhängig:
2.1. E2445/2019 und zu E2462/2019
2.1.1. Die beschwerdeführende Gesellschaft vor dem Verfassungsgerichtshof stellte am 26. Juni 2008 den Antrag auf Bewilligung der Errichtung eines Institutes für Magnetresonanztomographie in Rohrbach gemäß Oö. Krankenanstaltengesetz 1997. Nach längerem Ruhen des Verfahrens modifizierte die beschwerdeführende Gesellschaft diesen Antrag mit Schriftsatz vom 3. Oktober 2018 und legte dar, dass ein entsprechender Bedarf bestehe. Mit Bescheid vom 23. Jänner 2019 wies die Oberösterreichische Landesregierung den Antrag der beschwerdeführenden Gesellschaft mangels Bedarfes ab. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich wies die gegen diesen Bescheid erhobene Beschwerde der beschwerdeführenden Gesellschaft mit Erkenntnis vom 14. Mai 2019, LVwG‑050128/2/GS/JW, als unbegründet ab. Begründend wurde dazu im Wesentlichen ausgeführt, dass das "gegenständlich beantragte MR‑Gerät" in §4 iVm Anlage 2 ("Versorgungsregion Mühlviertel") der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukurplanes Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018) nicht vorgesehen sei, weshalb der Bedarf iSv §6a Oö. KAG 1997 zu verneinen sei und sich eine Prüfung der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erübrige. Bedenken gegen §23 G‑ZG und gegen diese Verordnung bestünden nicht (Hinweis auf Souhrada, Verbindliche Planung, SV‑Verträge und Krankenanstalten, SozSi 3/2017, 104 ff.).
2.1.2. Weiters stellte die beschwerdeführende Gesellschaft am 26. November 2010 den Antrag auf Bewilligung der Errichtung eines Institutes für Magnetresonanztomographie in Vöcklabruck gemäß Oö. Krankenanstaltengesetz 1997. Nach längerem Ruhen des Verfahrens modifizierte die beschwerdeführende Gesellschaft diesen Antrag mit Schriftsatz vom 12. Oktober 2017 und legte dar, dass ein entsprechender Bedarf bestehe. Mit Bescheid vom 23. Jänner 2019 wies die Oberösterreichische Landesregierung den Antrag der beschwerdeführenden Gesellschaft mangels Bedarfes ab. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich wies die gegen diesen Bescheid erhobene Beschwerde der beschwerdeführenden Gesellschaft mit Erkenntnis vom 14. Mai 2019, LVwG‑050127/2/GS/JW, als unbegründet ab und führte dazu im Wesentlichen aus, dass der Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukurplanes Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018) zu entnehmen sei, dass in der "Versorgungsregion Traunviertel-Salzkammergut" im extramuralen Sektor ein einziges Magnetresonanzgerät vorgesehen sei. Dem "österreichischen Strukturplan 2017" sei eine detaillierte Darstellung der einzelnen im Großgeräteplan enthalten Geräte zu entnehmen, insbesondere seien die Großgeräte dem jeweiligen extramuralen Anbieter gemäß der Nummer des Ambulatoriums im Krankenanstaltenkataster zugeordnet. Den Planzahlen seien die tatsächlich vorhandenen (auch nicht plankonformen) Geräte gegenübergestellt. In der Versorgungszone Traunviertel-Salzkammergut sei nur ein Gerät extramural vorgesehen. Diese verordnete Planstelle sei im ÖSG‑Anhang 10 (Großgeräteplan) "mit der Krankenanstaltennummer A40705 besetzt", weshalb der Bedarf iSv §6a Oö. KAG 1997 zu verneinen sei und sich eine Prüfung der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erübrige. Bedenken gegen §23 G‑ZG und gegen diese Verordnung bestünden nicht (Hinweis auf Souhrada, SozSi 3/2017, 104 ff.).
2.1.3. Gegen diese beiden Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichtes Oberösterreich richten sich die zu E2445/2019 und zu E2462/2019 protokollierten, auf Art144 B‑VG gestützte Beschwerden, in denen jeweils die Verletzung in den verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten auf Gleichheit vor dem Gesetz (Art7 B‑VG, Art2 StGG), auf Unversehrtheit des Eigentums (Art5 StGG, Art1 1. ZPEMRK) und auf "Erwerbsausübungsfreiheit gemäß Art18 StGG", sowie in Rechten wegen Anwendung eines verfassungswidrigen Gesetzes (§23 G‑ZG) sowie einer gesetzwidrigen Verordnung (ÖSG VO 2018) behauptet und die kostenpflichtige Aufhebung des angefochtenen Erkenntnisses beantragt wird.
Die beschwerdeführende Gesellschaft bringt in beiden Beschwerden im Wesentlichen übereinstimmend vor, dass die Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH die verfassungsrechtlichen Beleihungsgrenzen überschreite, unter anderem, weil die "(rechtsformenmissbrauchende) In‑Sich‑Beleihung" objektiv unsachlich sei, weil Kernaufgaben und nicht bloß vereinzelte Aufgaben übertragen würden, weil hinreichende Leitungsbefugnisse fehlen würden, weil es an der Zustimmung der Länder iSv Art102 B‑VG mangle, weil §23 Abs4 und 5 G‑ZG gegen das Gebot der Trennung der Vollzugsbereiche von Bund und Ländern verstoßen würde und weil §23 Abs6 G‑ZG kompetenzwidrig sei. Weiters sei die ÖSG VO 2018 infolge Bevorzugung des intramuralen Bereiches inhaltlich unsachlich gestaltet.
2.2. E2872/2020
2.2.1. Der Beschwerdeführer im zu E2872/2020 protokollierten Verfahren stellte am 1. Oktober 2020 den Antrag auf Bewilligung der Errichtung eines selbständigen Ambulatoriums zur Durchführung von MRT‑Untersuchungen sowie eines Ambulatoriums zur Durchführung von CT‑Untersuchungen (durch Nutzung des Röntgeninstituts eines näher bezeichneten Krankenhauses) in Hollabrunn gemäß NÖ Krankenanstaltengesetz. Mit Bescheid vom 3. April 2020 wies die Niederösterreichische Landesregierung den Antrag des Beschwerdeführers mangels Bedarfes ab. Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich wies die gegen diesen Bescheid erhobene Beschwerde des Beschwerdeführers mit Erkenntnis vom 16. Juli 2020, LVwG‑AV‑599/001‑2020, als unbegründet ab. Begründend wurde dazu im Wesentlichen ausgeführt, dass der Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukurplanes Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018) zu entnehmen sei, dass in der "Versorgungsregion Weinviertel" im extramuralen Sektor lediglich "je zwei extramurale CT- bzw MRT‑Geräte" vorgesehen seien. Aus der Stellungnahme des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) ergebe sich, dass der Großgeräteplan für die Versorgungsregion Weinviertel keinen Bedarf für ein weiteres extramurales MRT‑Geräte ausweise und dass der Großgeräteplan für das Landesklinikum Hollabrunn keine Kooperation des bestehenden, intramuralen CT‑Gerätes mit dem extramuralen Bereich vorsehe. Der Beschwerdeführer sei dem nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten. Es bestehe daher kein Bedarf iSv §10c Abs3 NÖ KAG.
2.2.2. Gegen diese Entscheidung richtet sich die zu E2872/2020 protokollierte, auf Art144 B‑VG gestützte Beschwerde, in der die Verletzung in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten, insbesondere auf Erwerbsfreiheit gemäß Art6 StGG, sowie in Rechten wegen Anwendung verfassungswidriger Gesetze (§23 Abs5 G‑ZG, §3a Abs3a KAKuG, §10c Abs3 NÖ KAG) sowie einer gesetzwidrigen Verordnung (ÖSG VO 2018) behauptet und die kostenpflichtige Aufhebung des angefochtenen Erkenntnisses beantragt wird.
2.2.3. Begründend führt der Beschwerdeführer auf das Wesentliche zusammengefasst aus: §23 Abs5 G‑ZG lasse der Landesgesetzgebung keinen Spielraum und verstoße deshalb gegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG. Weiters sei es dem Bundesgesetzgeber im Rahmen des Art12 Abs1 Z1 B‑VG verwehrt, die Landesorganisation zu regeln. Die ÖSG VO 2018 sei eine "kompetenzwidrige Mischverordnung". Der Gesundheitsplanungs GmbH würden nicht bloß vereinzelte Aufgaben, sondern vielmehr Kernaufgaben übertragen. Es fehle an einer effektiven Leitung und Steuerung hinsichtlich der Gesundheitsplanungs GmbH. Schließlich sei die Bedarfsprüfung nach §10c Abs3 NÖ KAG (§3a Abs3a KAKuG) überschießend und damit verfassungswidrig.
3. Bei der Behandlung der gegen diese Entscheidungen gerichteten Beschwerden bzw der Gerichtsanträge auf Verordnungskontrolle sind im Verfassungsgerichtshof Bedenken ob der Verfassungsmäßigkeit von
1. §§18, 19, 20 Abs1 und 2, 23 Abs1 zweiter, dritter und vierter Satz, Abs2 zweiter, dritter, vierter und fünfter Satz und Abs4 bis 8 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung‑Gesundheit (Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz – G‑ZG), BGBl I 26/2017,
2. §3a Abs3a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), BGBl 1/1957, idF BGBl I 26/2017,
3. §17 NÖ Gesundheits- und Sozialfonds‑Gesetz 2006 (NÖGUS‑G 2006), LGBl 134/2005 (LGSlg 9450), idF LGBl 92/2017,
4. §17a Abs4 und 5 des Landesgesetzes über den Oö. Gesundheitsfonds (Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013), LGBl 83/2013, idF LGBl 96/2017,
5. §4 Abs1 Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000 (SKAG), LGBl 24/2000 (WV), idF LGBl 25/2018,
6. §10 des Gesetzes über die Errichtung (Fortführung) eines Wiener Gesundheitsfonds 2017 (Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017), LGBl 10/2018,
7. §6a Abs6a Oberösterreichisches Krankenanstaltengesetz 1997 (Oö. KAG 1997), LGBl 132/1997 (WV), idF LGBl 97/2017 und
8. §10c Abs3 Niederösterreichisches Krankenanstaltengesetz (NÖ KAG), LGBl 170/1974 (LGSlg 9440), idF LGBl 93/2017
sowie ob der Gesetzmäßigkeit von
1. §4 und Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit) und
2. §4 und Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit) in der Fassung der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019), kundgemacht am 5. November 2019 unter Nr 6/2019 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit)
entstanden. Der Verfassungsgerichtshof hat daher am 6. Oktober 2021 beschlossen, diese Gesetzes- bzw Verordnungsbestimmungen von Amts wegen auf ihre Verfassungs- bzw Gesetzmäßigkeit zu prüfen.
4. Der Verfassungsgerichtshof legte seine Bedenken, die ihn zur Einleitung des Gesetzes- und des Verordnungsprüfungsverfahrens bestimmt haben, in seinem Prüfungsbeschluss wie folgt dar (ohne Hervorhebungen im Original):
"4. Zur Rechtslage
4.1. Gemäß Art10 Abs1 B‑VG sind unter anderem das Sozial- und Vertragsversicherungswesen (Z11) und das 'Gesundheitswesen mit Ausnahme des Leichen- und Bestattungswesens sowie des Gemeindesanitätsdienstes und Rettungswesens, hinsichtlich der Heil- und Pflegeanstalten, des Kurortewesens und der natürlichen Heilvorkommen jedoch nur die sanitäre Aufsicht' (Z12) in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache. Hingegen sind 'Heil- und Pflegeanstalten' – also im Besonderen das Krankenanstaltenrecht – nach Art12 Abs1 Z1 B‑VG Bundessache nur in der Grundsatzgesetzgebung, hinsichtlich der Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung jedoch Landessache (vgl dazu ua VfSlg 12.023/1992, 17.232/2004). Während also das Berufsrecht der selbständig niedergelassenen Ärzte Bundessache ist (Art10 Abs1 Z12 B‑VG), unterfallen bettenführende Krankenanstalten und selbständige Ambulatorien Art12 Abs1 Z1 B‑VG (vgl näher VfSlg 12.023/1992).
4.2. Vor dem Hintergrund dieser geteilten Kompetenzrechtslage haben der Bund und die Länder die Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG Zielsteuerung Gesundheit (kundgemacht ua in BGBl I 97/2017) und die Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens (kundgemacht ua in BGBl I 98/2017) abgeschlossen. Mit letzterer Vereinbarung sind der Bund und die Länder unter anderem übereingekommen, den Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) und die Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG) als zentrale Planungsinstrumente für die integrative Versorgungsplanung einzusetzen. Mit Art5 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl I 98/2017, haben sich der Bund und die Länder detailliert auf die Vorgangsweise zur Erarbeitung und Verbindlicherklärung des Österreichischen Strukturplans Gesundheit und der Regionalen Strukturpläne Gesundheit geeinigt.
4.3. Diese Vereinbarungen nach Art15a B‑VG binden die jeweiligen Vertragspartner (zB VfSlg 14.146/1995, 15.972/2000, 16.959/2003, 20.177/2017) und haben nicht selbst den Charakter genereller Normen (weshalb ihre Kundmachung auch nicht Teil des Rechtssetzungsverfahrens ist, sondern bloß der Information der Allgemeinheit dient, VfSlg 17.232/2004). Insbesondere stellen sie – wie der Verfassungsgerichtshof in VfSlg 14.146/1995 festgehalten hat – keine Zwischenstufe zwischen einfachem Gesetzesrecht und Verfassungsrecht dar; auch sind sie keine höherrangigen Normen, an denen ein Gesetz gemessen werden kann (zB VfSlg 14.146/1995, 19.747/2013). Vielmehr handelt es sich um Vertragsnormen, die – gegebenenfalls – umsetzungsbedürftig sind (VfSlg 20.177/2017). Gegebenenfalls können Bestimmungen von Art15a B‑VG-Vereinbarungen auch zur Interpretation von einfachgesetzlichen Bestimmungen, die der Umsetzung solcher Vereinbarungen dienen, herangezogen werden (vgl zB VfSlg 19.964/2015). Die Umsetzung kann nach Umständen auch eine Verfassungsänderung bedingen, wenn ansonsten eine verfassungskonforme Verwirklichung des in einer Vereinbarung nach Art15a B‑VG Bedungenen nicht möglich wäre.
4.4. Zur Umsetzung dieser Übereinkommen hat der Bundesgesetzgeber mit dem Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017, BGBl I 26/2017, das Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz (G‑ZG) erlassen, das überwiegend unmittelbar anwendbares Bundesrecht, bisweilen aber auch bloß Bundes‑Grundsatzrecht iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG enthält:
4.4.1. Gemäß §19 Abs1 G‑ZG sind der Österreichische Strukturplan Gesundheit (ÖSG) und die Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG) die zentralen Planungs-instrumente für die integrative Versorgungsplanung; dabei soll der ÖSG der öster-reichweit verbindliche Rahmenplan für die in den RSG vorzunehmende konkrete Gesundheitsstrukturplanung und Leistungsangebotsplanung sein. Der ÖSG hat in näher bestimmten Bereichen verbindliche Vorgaben für die RSG festzulegen (§20 Abs2 G‑ZG; siehe zu den Inhalten des ÖSG und der RSG die §§20 f. G‑ZG).
Der ÖSG ist 'auf der Bundesebene zwischen dem Bund, den Ländern und der Sozialversicherung einvernehmlich abzustimmen' (§20 Abs3 G‑ZG) und in der Bundes‑Zielsteuerungskommission zu beschließen (§20 Abs4 G‑ZG). Die RSG sind 'auf Landesebene zwischen dem jeweiligen Land und der Sozialversicherung festzulegen' (§21 Abs7 G‑ZG, vgl auch die – teilweise grundsatzgesetzlichen – Abs1 bis 6 leg. cit.; §16 Abs4 NÖGUS‑G 2006, §9 Abs4 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017) und in den Landes‑Zielsteuerungskommissionen zu beschließen (vgl §21 Abs10 G‑ZG; vgl aber auch landesgesetzlich §17a Abs2 und 3 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §5 Abs2 und §24 Abs1 Z3 SAGES‑G 2016, §9 Abs1 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Die Planungsvorgaben sind jedenfalls so konkret festzulegen, dass sie für die Bedarfsprüfung herangezogen werden können (§23 Abs2 dritter Satz G‑ZG, §17a Abs3 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §2 Abs4 Z7 lita NÖGUS‑Gesetz 2006, §9 Abs6 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat sodann die jeweils aktuelle Fassung des ÖSG jedenfalls im RIS (§22 Abs1 G‑ZG) zu veröffentlichen; ebenso hat der Landeshauptmann die jeweils aktuelle Fassung des RSG im RIS zu veröffentlichen (§22 Abs2 G‑ZG). §59k Z1 KAKuG qualifiziert den ÖSG (zunächst) als 'objektiviertes Sachverständigengutachten' (vgl idS bereits Art5 Abs9 Z1 der Art15a B‑VG-Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens).
4.4.2. §23 G‑ZG regelt die Verbindlicherklärung von Inhalten des ÖSG und der RSG: Zunächst hat die Bundes‑Zielsteuerungskommission (siehe §25 Abs1 Z1 und §26 G‑ZG) die 'für die nachhaltige Versorgung der Bevölkerung unerlässlichen Teile des ÖSG', die eine 'rechtlich verbindliche Grundlage für Planungsentscheidungen des RSG bilden sollen', als solche 'auszuweisen' (§23 Abs1 G‑ZG). Hinsichtlich der RSG wendet sich der – unmittelbar anwendbare – §23 Abs2 G‑ZG an die Vertreter des Bundes und der Sozialversicherung in der jeweiligen Landes‑Zielsteuerungskommission: diese haben 'sicherzustellen', dass jene Planungsvorgaben des RSG, die rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen, als solche ausgewiesen werden. (Für den Fall, dass kein Einvernehmen über die verbindlich zu erklärenden Teile des RSG 'bzw deren Änderungen' in der Landes‑Zielsteuerungskommission zustande kommt, verweist §24 G‑ZG grundsatzgesetzlich auf §10a KAKuG zu Krankenanstaltenplänen; vgl landesgesetzlich zB §39 Abs4 Oö. KAG 1997, §4 Abs1a Sbg KAG 2000, §10 Abs4 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017.)
Die rechtliche Verbindlichkeit der solcherart ausgewiesenen Teile des ÖSG bzw der RSG wird durch Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH hergestellt (§23 Abs1 zweiter Satz bzw Abs2 zweiter Satz, Abs4 und Abs5 G‑ZG), die zunächst ein Begutachtungsverfahren durchzuführen hat; wenn sich dabei Änderungen ergeben, ist vor der Verbindlicherklärung eine nochmalige Beschlussfassung in der Bundes‑Zielsteuerungskommission (im Fall des ÖSG) bzw der Landes‑Zielsteuerungskommission (im Fall eines RSG) 'herbeizuführen' (§23 Abs1 und 2 G‑ZG, jeweils vorletzter und letzter Satz). Gemäß §23 Abs4 G‑ZG erklärt die Gesundheitsplanungs GmbH die von der Bundes‑Zielsteuerungskommission bzw den Landes‑Zielsteuerungskommissionen ausgewiesenen Teile des ÖSG bzw der RSG, insoweit sie Angelegenheiten des Art10 B‑VG betreffen, für verbindlich. §23 Abs5 G‑ZG weist als Grundsatzbestimmung die Landesgesetzgeber an, die solcherart ausgewiesenen Teile des ÖSG bzw der jeweiligen RSG, soweit sie Angelegenheiten des Art12 B‑VG betreffen, durch die Gesundheitsplanungs GmbH für verbindlich erklären zu lassen (entsprechende ausführungsgesetzliche Bestimmungen finden sich etwa in §17 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §4 Abs1 Sbg KAG 2000 und §10 Abs1 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Gemäß §23 Abs6 G‑ZG hat die Gesundheitsplanungs GmbH 'die für verbindlich zu erklärenden Teile im Wege einer Verordnung zu erlassen und im RIS (www.ris.bka.gv.at ) kundzumachen' (eine Kundmachungspflicht im RIS sehen auch §17 Abs1 NÖGUS‑G 2006 und §17a Abs1 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013 [vor].)
4.4.3. Die Rechtsstellung der Bundes‑Zielsteuerungskommission, der Landes‑Zielsteuerungskommissionen und der Gesundheitsplanungs GmbH stellt sich folgendermaßen dar:
4.4.3.1. Die Bundes‑Zielsteuerungskommission ist ein Organ der Bundesgesundheitsagentur (§25 Abs1 Z1 G‑ZG), die durch (den unmittelbar anwendbaren) §56a KAKuG als Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit eingerichtet ist. Ihr gehören vier Vertreter des Bundes, vier Vertreter der Sozialversicherung sowie neun Vertreter der Länder an (§26 Abs1 G‑ZG), wobei jede 'Kurie' eine Stimme hat. Die Bundes‑Zielsteuerungskommission fasst ihre Beschlüsse in Angelegenheiten des ÖSG einstimmig (§26 Abs3 Z1 und Abs4 Z2 litj G‑ZG). Die Bundes‑Zielsteuerungskommission ist nicht (ausdrücklich) Weisungen staatlicher Organe unterworfen.
4.4.3.2. Die Landes‑Zielsteuerungskommissionen sind landesgesetzlich als Organe der Landesgesundheitsfonds eingerichtet (vgl zB §4 Abs1 Z2 NÖGUS‑G 2006, §5 Abs1 Z2 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §17 Abs1 Z3 SAGES‑Gesetz 2016, §4 Abs1 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Diese sind als Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit gestaltet (vgl zB §1 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §1 Abs1 Oö. [Gesundheitsfonds‑Gesetz] 2013, §1 Abs1 SAGES‑Gesetz 2016, §1 Abs1 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Den Landes‑Zielsteuerungskommissionen gehören fünf Vertreter des Landes, fünf Vertreter der Sozialversicherungsträger und ein Bundesvertreter an (zB §8 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §10 Abs1 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §22 Abs1 SAGES‑Gesetz 2016, §7 Abs1 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Gemäß §28 Abs1 G‑ZG hat der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister einen Vertreter in die jeweilige Landes‑Zielsteuerungskommission zu entsenden, der durch §28 Abs2 leg. cit. ermächtigt ist, ua gegen rechtswidrige Beschlüsse ein Veto einzulegen. Gemäß §29 Abs2 G‑ZG haben die gesetzlichen Krankenversicherungsträger (jeweils) fünf Vertreter in die Landes‑Zielsteuerungskommissionen zu entsenden, die dort (jeweils) eine 'Kurie mit einer Stimme' bilden (§29 Abs3 G‑ZG). Für die Beschlussfassung in der Landes‑Zielsteuerungskommission ist das Einvernehmen zwischen der Kurie des Landes und der Kurie der Sozialversicherungsträger erforderlich (zB §8 Abs4 Z1 NÖGUS‑G 2006, §12 Abs2 Z1 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §23 Abs4 SAGES‑Gesetz 2016, §7 Abs10 Z4 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017); der Bundesvertreter ist vetoberechtigt (zB §8 Abs4 Z2 NÖGUS‑G 2006, §12 Abs2 Z3 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §23 Abs4 Z3 SAGES‑Gesetz 2016, §7 Abs10 Z5 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Die Landes‑Zielsteuerungskommissionen sind nicht (ausdrücklich) Weisungen staatlicher Organe unterworfen (vgl auch §19 NÖGUS‑G 2006, §28 SAGES‑Gesetz 2016 und §20 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 über die 'Aufsicht' über den Fonds).
4.4.3.3. Die Gesundheitsplanungs GmbH ist eine auf Grundlage von §23 Abs3 G‑ZG eingerichtete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Gesellschafter der Bund, die Länder und der Dachverband der Sozialversicherungsträger sind. Die Gesellschafter entsenden jeweils einen Vertreter in die Generalversammlung der Gesellschaft, deren Beschlussfassung einstimmig erfolgt (§23 Abs3 G‑ZG). Die Gesellschafter bestellen die Geschäftsführung der Gesundheitsplanungs GmbH; sie besteht aus einem Geschäftsführer und zwei Stellvertretern (§23 Abs3 G‑ZG). Gemäß §7 Abs2 des vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz im Vorverfahren zu V419/2020 vorgelegten Gesellschaftsvertrages wird die Gesellschaft 'durch den Geschäftsführer vertreten. Im Verhinderungsfall wird dieser durch die Stellvertreter gemeinsam vertreten.' Gemäß §7 Abs3 dieses Gesellschaftsvertrages hat 'die Geschäftsführung […] alle Entscheidungen und Verfügungen zu treffen, die nicht durch das Gesetz, diesen Gesellschaftsvertrag oder allenfalls durch die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Beschlussfassung der Generalversammlung vorbehalten sind'.
§7 Abs5 des Gesellschaftsvertrages ermächtigt die Generalversammlung, eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung zu erlassen. §1 der vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz vorgelegten (außen als 'Entwurf' bezeichneten) 'Geschäfts- und Verfahrensordnung' (der Verfassungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass es sich dabei um die im maßgeblichen Zeitraum geltende Version handelt) zählen die 'Durchführung von allgemeinen Begutachtungsverfahren zu Verordnungen zum ÖSG und zu Verordnungen zu den RSG' und die 'Kundmachung der Verordnungen zum ÖSG und der Verordnungen zu den RSG' zu den Aufgaben des Geschäftsführers, die von ihm 'im Einvernehmen mit beiden Stellvertretern auszuüben sind'. Unter dem Titel der 'Kundmachung der Verordnungen' legt §3 der Geschäfts- und Verfahrensordnung fest, dass der 'Geschäftsführer' den Verordnungsentwurf nach der Rückmeldung im Begutachtungsverfahren 'zu unterzeichnen' und 'im Anschluss gemäß §23 Abs6 [G‑ZG] im Rechtsinformationssystem des Bundes als Verordnung zu veröffentlichen' hat.
Gemäß §23 Abs7 G‑ZG unterliegt 'die Tätigkeit der Gesellschaft', soweit Angelegenheiten des Art10 B‑VG berührt sind, der Aufsicht des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers und es ist die 'Gesellschaft' bei Besorgung ihrer diesbezüglichen Aufgaben an dessen Weisungen gebunden. Die Grundsatzbestimmung des §27 Abs8 G‑ZG verpflichtet die Landesgesetzgeber, die 'Tätigkeit der Gesellschaft', soweit Angelegenheiten des Art12 B‑VG berührt sind, der Aufsicht und den Weisungen der jeweiligen Landesregierung zu unterstellen. Die Landes‑Ausführungsgesetze sehen entsprechende Bestimmungen vor (vgl zB §17 Abs2 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs5 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §4 Abs1 Sbg KAG 2000, §10 Abs3 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017).
4.4.4. Die Krankenanstaltengesetze der Länder sehen in Ausführung der Grundsatzbestimmung des §3a KAKuG ua vor, dass die Bewilligung der Errichtung von selbständigen Ambulatorien grundsätzlich einen Bedarf voraussetzt, der im Fall der Existenz von Verordnungen nach den §§23 und 24 G‑ZG am Maßstab dieser Verordnungen, also vor allem am Maßstab der als verbindlich erklärten Teile des ÖSG bzw der RSG zu beurteilen ist. Vergleichbare Bestimmungen finden sich auch in §52c Abs2 Ärztegesetz (siehe ferner §47a Abs2 leg. cit.) und in §26b Zahnärztegesetz für die Bewilligung von Gruppenpraxen. Die Bindung der Sozialversicherungsträger ergibt sich ua aus §84a Abs1 ASVG. Die §§8 und 14 Primärversorgungsgesetz sichern die Beachtung der RSG bei der Einrichtung von Primärversorgungseinheiten.
5. Der Verfassungsgerichtshof hegt gegen die hiemit in Prüfung gezogenen Bestimmungen folgende Bedenken:
5.1. Hinsichtlich der gesetzlichen Grundlagen der ÖSG‑Verordnungen bzw der RSG Wien – Verordnung 2019
5.1.1. §23 Abs4 und 5 G‑ZG sieht die Erlassung von Teilen des ÖSG bzw der RSG als Verordnung vor, und zwar sowohl solcher Teile, die – als Verordnung – Gesundheitswesen iSv Art10 B‑VG regeln, als auch solcher Teile, die – als Verordnung – Krankenanstaltenrecht iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG zum Gegenstand haben.
5.1.1.1. Diese Verordnungen dürften durch die §§18, 19, 20 Abs1 und 2 G‑ZG determiniert werden, die als unmittelbar anwendbares Bundesrecht erlassen wurden. Der Verfassungsgerichtshof hegt daher zunächst das Bedenken, dass diese Bestimmungen als gesetzliche Determinierung von – auch – krankenanstalten-rechtlichen Verordnungen (insofern) entgegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG als Bundesgesetz und nicht als Grundsatzgesetz erlassen wurden.
5.1.1.2. §23 Abs1 vorletzter und letzter Satz und Abs2 vorletzter und letzter Satz G‑ZG regelt das von der Gesundheitsplanungs GmbH durchzuführende Verfahren vor Erlassung dieser Verordnungen als unmittelbar anwendbares Bundesrecht. Der Verfassungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass sich diese Verfahrensbestimmungen – lege non distinguente – auch auf [ÖSG]- und RSG‑Verordnungen beziehen, soweit sie krankenanstaltenrechtliche Inhalte iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG zum Gegenstand haben. Der Verfassungsgerichtshof hegt daher vorläufig das Bedenken, dass diese Bestimmungen, soweit sie durch unmittelbar anwendbares Bundesrecht (auch) das Verfahren zur Erlassung von krankenanstaltenrechtlichen Verordnungen iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG regeln, in Widerspruch zur bundesstaatlichen Kompetenzverteilung, konkret zu Art12 Abs1 Z1 B‑VG, stehen.
5.1.1.3. Die ÖSG- und RSG‑Verordnungen kommen, so die vorläufige Annahme des Verfassungsgerichtshofes, derart zustande, dass zunächst der ÖSG zwischen Vertretern des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung bzw die RSG zwischen Vertretern der Länder und der Sozialversicherung (unter Einbeziehung des Bundes) akkordiert werden. Dieser Abstimmungsvorgang dürfte zumindest teilweise nicht hoheitlicher Natur sein (so dürfte etwa die Beteiligung von Bundesvertretern am Abstimmungsvorgang hinsichtlich des ÖSG in Belangen, die der Sache nach Krankenanstaltenrecht betreffen, schon aus Gründen der Kompetenzverteilung nicht hoheitlich deutbar sein). In einem weiteren Schritt dürfte das Ergebnis dieser Abstimmungen von den Zielsteuerungskommissionen zu beschließen sein (womit ihm zunächst einmal der Charakter eines 'objektivierten Sachverständigengutachtens' zukommen dürfte; vgl §59k Z1 KAKuG) und dürften Teile für die Verbindlicherklärung auszuwählen sein. Die Tätigkeit dieser Zielsteuerungskommissionen dürfte, wenn sie hoheitlich als Teilschritt des Verordnungserlassungsverfahrens zu deuten wäre, mangels Weisungsingerenz der obersten Organe der Vollziehung (siehe zur Konstruktion der Zielsteuerungskommissionen oben 4.4.3.1. und 4.4.3.2.) verfassungswidrig sein.
Die – zweifellos hoheitlich handelnde – Gesundheitsplanungs GmbH dürfte hingegen keinen Einfluss auf den Inhalt der ÖSG- und RSG‑Verordnungen haben, insbesondere dürfte sie nicht zu entscheiden haben, welche Teile eines ÖSG oder von RSG für verbindlich zu erklären sind. Sie dürfte vielmehr verpflichtet sein, abgestimmte und von der zuständigen Zielsteuerungskommission beschlossene, ausgewiesene Teile des ÖSG bzw der RSG als verbindlich zu erklären.
Damit dürfte aber die maßgebliche Festlegung des Verordnungsinhaltes – zumindest in wesentlichen Teilen – der Gesundheitsplanungs GmbH entzogen und (zumindest teilweise) nicht-hoheitlich handelnden oder (zumindest teilweise) der Ingerenz der (im Hinblick auf Art10 Abs1 Z12 bzw Art12 Abs1 Z1 B‑VG zuständigen) obersten Organe der Vollziehung nicht unterworfenen Organen überantwortet sein. Dies dürfte wiederum die verfassungsrechtlich gebotenen Verantwortungszusammenhänge unterlaufen. Daran dürfte auch nichts ändern, dass nach der Gesamtkonstruktion – zumindest in der Praxis – ein Verordnungsinhalt, der nicht vom Willen sowohl des Bundes als auch des Landes getragen ist, ausgeschlossen oder zumindest unwahrscheinlich scheint. Im Ergebnis dürfte damit die gewählte Konstruktion, die in §23 Abs4 und 5 G‑ZG und den entsprechenden Landes-Ausführungsbestimmungen ihren Sitz hat, den Anforderungen der Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG an die Leitungsbefugnis oberster Organe der Vollziehung widersprechen.
Dabei wird zu erörtern sein, welche Bedeutung dem Umstand zukommt, dass es sich bei den hier in Rede stehenden Verordnungen um Planungsakte handeln dürfte, die auf die finanziellen Verhältnisse zwischen staatlichen Organen und in der Folge insbesondere auf privatwirtschaftliche Maßnahmen abzielen.
In diesem Zusammenhang wird auch zu prüfen sein, ob ein verordnungserlassendes Organ durch die Zielsteuerungskommission derart gebunden werden darf, dass es im Ergebnis keine Entscheidungsbefugnis mehr hat.
Zudem wird im Gesetzesprüfungsverfahren zu prüfen sein, ob die vorläufig angenommene Prämisse dieser Bedenken, dass die Gesundheitsplanungs GmbH keinen Entscheidungsspielraum hat und jedenfalls zur Erlassung der von den Zielsteuerungskommissionen bezeichneten Teile der Strukturpläne als Verordnungen verpflichtet ist, tragfähig ist.
5.1.1.4. §23 G‑ZG und die für verbindlich zu erklärenden Teile des ÖSG und der RSG dürften nach der vorläufigen Annahme des Verfassungsgerichtshofes auch Regelungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens iSv Art10 Abs1 Z12 B‑VG enthalten bzw zu enthalten haben. Auch wenn die Anlassfälle lediglich die Wirkung des ÖSG und der RSG in Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG zum Gegenstand haben dürften, dürfte §23 G‑ZG diese beiden Kompetenzangelegenheiten in einer Weise verbinden, dass eine allfällige Verfassungswidrigkeit des §23 Abs4 G‑ZG in Bezug auf Art10 Abs1 Z12 iVm Art102 B‑VG auf die Verfassungskonformität der Gesamtregelung durchschlagen dürfte. Dies jedenfalls dann, wenn sich – entgegen der unten (5.3.2.) dargelegten Annahme – ergeben sollte, dass §23 G‑ZG die Erlassung 'gemischter' Verordnungen auf den Gebieten des Gesundheitswesens und des Krankenanstaltenrechts vorsieht.
Art102 B‑VG sieht für die Belange des Gesundheitswesens den Grundsatz der mittelbaren Bundesverwaltung vor, wonach die Vollziehung des Bundes im Bereich der Länder 'der Landeshauptmann und die ihm unterstellten Landesbehörden' ausüben. Soweit in Angelegenheiten, die in mittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden, 'Bundesbehörden' mit der Vollziehung betraut werden, unterstehen diese Bundesbehörden dem Landeshauptmann und es dürfen Gesetze, die die Einbindung von Bundesbehörden in Unterordnung unter den Landeshauptmann anordnen, nur mit Zustimmung der beteiligten Länder kundgemacht werden (Art102 Abs1 zweiter Satz B‑VG). Die Einrichtung von eigenen 'Bundesbehörden' für andere als die in Art102 Abs2 B‑VG genannten Angelegenheiten kann nach Art102 Abs4 B‑VG ebenfalls nur mit Zustimmung der beteiligten Länder erfolgen.
Der Verfassungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass auch mit der Erlassung von Verordnungen beliehene Rechtsträger als (funktionelle) 'Bundesbehörden' iSv Art102 B‑VG zu verstehen sind (vgl VfSlg 20.323/2019 und VfGH 12.6.2020, G252/2019 zu Fällen der mittelbaren Staatsverwaltung durch beauftragte Rechtspersonen des öffentlichen Rechts).
Der Verfassungsgerichtshof hegt daher das Bedenken, dass die Betrauung der Gesundheitsplanungs GmbH (auch) mit der Erlassung von Verordnungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens mangels – soweit ersichtlich – Zustimmung der Länder weder den Anforderungen des Art102 Abs1 zweiter Satz noch jenen des Art102 Abs4 B‑VG entsprechen dürfte; ein Fall des Art102 Abs1 zweiter Satz B‑VG dürfte schon deshalb nicht vorliegen, weil die Gesundheitsplanungs GmbH in den Belangen des Gesundheitswesens nicht den Landeshauptleuten unterstellt sein dürfte.
Der Verfassungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass auch die Vereinbarung nach Art15a B‑VG über Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl I 98/2017, schon deshalb nicht als Zustimmung iSv Art102 B‑VG gedeutet werden kann, weil Art5 Abs9 und 10 dieser Vereinbarung vorsieht, die Bundesgesundheitsagentur (hinsichtlich des ÖSG) bzw die Landesgesundheitsfonds (hinsichtlich der RSG), nicht aber die Gesundheitsplanungs GmbH als Urheber dieser Verordnungen einzusetzen. Somit hegt der Verfassungsgerichtshof das Bedenken, dass die Beleihung nach §23 Abs4 G‑ZG in Widerspruch zu Art102 B‑VG steht.
5.1.1.5. §23 Abs1, 2, 4, 5 und 6 G‑ZG sieht vor, dass die 'Gesundheitsplanungs GmbH' die ausgewiesenen Teile des ÖSG bzw der RSG für verbindlich zu erklären hat. Gemäß §23 Abs3 G‑ZG verfügt die Gesundheitsplanungs GmbH (zumindest) über zwei Organe, nämlich das Kollegialorgan Generalversammlung, die schon kraft gesetzlicher Anordnung ihre Beschlüsse einstimmig zu fassen hat, und die monokratisch organisierte Geschäftsführung (arg.: Geschäftsführer und zwei Stellvertreter).
§23 Abs4 G‑ZG dürfte damit als unmittelbar anwendbare Bestimmung nicht festlegen, welches Organ der Gesundheitsplanungs GmbH für den Akt der Verord-nungserlassung zuständig sein soll. Auch das NÖGUS‑Gesetz 2006, das Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, das SKAG und das Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 dürften (für ihren Anwendungsbereich) keine Festlegung des zuständigen willensbildenden Organes enthalten.
Erst aus dem Gesellschaftsvertrag und der Geschäfts- und Verfahrensordnung der Gesundheitsplanungs GmbH dürfte sich ergeben, dass die Verordnungserlassung in die Zuständigkeit der Geschäftsführung fällt; dies dürfte auch der Praxis der Gesundheitsplanungs GmbH entsprechen.
Der Verfassungsgerichtshof hegt daher vorläufig das Bedenken, dass es Art18 Abs1 B‑VG iVm Art83 Abs2 B‑VG und dem daraus abzuleitenden Gebot der exakten Regelung von Behördenzuständigkeiten widerstreiten dürfte, wenn die zitierten Bestimmungen zwar die Gesundheitsplanungs GmbH mit Aufgaben der Erlassung von Verordnungen beleihen, aber offen lassen dürften, welches von mehreren in Betracht kommenden Gesellschaftsorganen konkret zuständig sei. Dies zumal das G‑ZG sowohl ein Kollegialorgan als auch ein monokratisch organisiertes Organ vorzusehen scheint, weshalb erhebliche Unterschiede in der Willensbildung bestehen dürften.
Im Gesetzesprüfungsverfahren wird insbesondere zu erörtern sein, ob der Gesetzgeber den Anforderungen des Art18 Abs1 B‑VG iVm Art83 Abs2 B‑VG genügt, wenn er eine Rechtsperson als solche mit Hoheitsgewalt beleiht und die Frage der Aufgabenverteilung und damit auch die Zuständigkeit zur Erlassung von Verordnungen für diese Rechtsperson deren innerer Organisation überlässt. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob sich allenfalls aus §18 Abs1 GmbH‑Gesetz oder einer anderen Bestimmung des Gesellschaftsrechts Anhaltspunkte für die Zuständigkeit ergeben.
Sollte sich hingegen ergeben, dass aus dem Gesetz – wie in der Literatur vermutet wurde (Stöger, Die Gesundheitsreform 2017 im Überblick – Neue Rechtsprobleme in der Gesundheitsplanung, in Jahrbuch Öffentliches Recht 2018, 11 [19]) – die Zuständigkeit der Generalversammlung der Gesundheitsplanungs GmbH abzuleiten ist, hegt der Verfassungsgerichtshof das Bedenken, dass die in Prüfung gezogenen Verordnungen vom unzuständigen Organ erlassen worden sind.
5.1.1.6. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zu den verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung setzt diese insbesondere voraus, dass eine mit Hoheitsgewalt beliehene Rechtsperson der Weisungsbefugnis (letztlich) des zuständigen obersten Organs der Vollziehung unterworfen ist und dass hinreichende Instrumente zur Effektuierung der Weisungsbefugnis vorhanden sind (vgl nur VfSlg 14.473/1996).
Zwar ist die Gesundheitsplanungs GmbH bundesrechtlich (§23 Abs7 G‑ZG) bzw landesrechtlich (§17 Abs2 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs5 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §4 Abs1 SKAG, §10 Abs3 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017) den Weisungen und der Aufsicht (letztlich) des jeweils zuständigen obersten Organs der Verwaltung unterworfen. Der Verfassungsgerichtshof hegt jedoch das Bedenken, dass diese Weisungs- und Aufsichtsbefugnisse nach der Konstruktion der Gesundheitsplanungs GmbH nicht hinreichend effektiv sein dürften: So dürften es die zitierten Bestimmungen nicht ermöglichen, eine Missachtung von Weisungen effektiv abzustellen. Auch die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen der Gesundheits-planungs GmbH dürften angesichts des Umstandes, dass der Bund bzw die Länder nur jeweils ein Mitglied in die Generalversammlung der Gesundheitsplanungs GmbH, die kraft Gesetzes einstimmig zu entscheiden hat, zu entsenden befugt sein dürften, nicht ausreichen, die verfassungsrechtlichen Anforderungen an effektive Steuerungsmöglichkeiten zu erfüllen. Sollten sich die Steuerungsmöglichkeiten des Bundes bzw des Landes also als unzureichend erweisen, so dürfte die Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH mit der Befugnis zur Verordnungserlassung (§23 Abs4 und 5 G‑ZG, §17 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §4 Abs1 SKAG, §10 Abs1 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017) verfassungswidrig sein. Dabei wird auch zu prüfen sein, welche Bedeutung dem Umstand zukommt, dass §23 G‑ZG nicht festzulegen scheint, im Ausmaß welcher Gesellschaftsanteile der Bund, die Länder und der Dachverband der Sozialversicherungsträger an der Gesundheitsplanungs GmbH beteiligt sind.
5.1.1.7. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ist eine Beleihung weiters auf einzelne Aufgaben der staatlichen Verwaltung beschränkt und sind jedenfalls Kernaufgaben von der Übertragung auf Beliehene ausgeschlossen (vgl abermals VfSlg 14.473/1996). Der Verfassungsgerichtshof hegt idS auch Zweifel, ob die Übertragung der (auch finanziellen) Planung für wesentliche Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung überschreitet. Im Gesetzesprüfungsverfahren wird in diesem Zusammenhang auch die Frage zu erörtern sein, welche Bedeutung insofern dem Umstand zukommt, dass die Gesundheitsplanungs GmbH – so die vorläufige Annahme des Verfassungsgerichtshofes – keinen Spielraum bei der Erlassung ihrer Verordnungen haben dürfte.
5.1.1.8. §23 Abs5 G‑ZG regelt als Grundsatzbestimmung, dass die Landesgesetzgebung vorzusehen hat, dass die Gesundheitsplanungs GmbH Teile des ÖSG und der jeweiligen RSG, welche Angelegenheiten des Art12 B‑VG betreffen, für verbindlich zu erklären hat. Im Rahmen der Kompetenz des Art12 Abs1 Z1 B‑VG dürfte der Bundesgesetzgeber zwar auch befugt sein, wenn grundsätzliche Fragen betroffen sind, die Zuständigkeit zu Vollzugsakten auf dem Gebiet der Krankenanstalten grundsatzgesetzlich – bestehenden – Landesbehörden zuzuordnen, weil die Festlegung der sachlichen Zuständigkeit zum materiellen Recht iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG zählen dürfte (vgl VfSlg 17.232/2004). Dem Bundesgesetzgeber dürfte es im Rahmen des Art12 Abs1 Z1 B‑VG jedoch verwehrt sein, den Landesgesetzgeber zur Einrichtung neuer Landesbehörden zu verpflichten, weil er damit in die Landes-Organisationskompetenz (Art15 Abs1 B‑VG) eingreifen dürfte (vgl VfSlg 8833/1980, 8834/1980). Entsprechend dürfte es dem Bundes‑Grundsatzgesetzgeber aber auch verwehrt sein, die Länder zu Beleihungen zu verpflichten, weil auch damit ein – organisatorisches – Abweichen von der landesrechtlich zu regelnden Landesorganisation verbunden sein dürfte. §23 Abs5 G‑ZG begegnet daher dem Bedenken, dass diese Bestimmung in Widerspruch zu Art12 Abs1 Z1 B‑VG steht.
5.2. Hinsichtlich der Bedarfsprüfung
Nach der Grundsatzbestimmung des §3a KAKuG ist die Errichtung selbständiger Ambulatorien grundsätzlich bewilligungspflichtig. Gemäß §3a Abs2 KAKuG darf die Errichtungsbewilligung ua nur erteilt werden, wenn nach dem angegebenen Anstaltszweck und dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot im Hinblick auf das (näher beschriebene) bestehende Versorgungsangebot 'eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann', wobei bei der Beurteilung dieser Frage die in Abs3 leg. cit. genannten Kriterien zu berücksichtigen sind. Gemäß §3a Abs3a KAKuG ist jedoch, wenn der Leistungsumfang in Verordnungen nach den §§23 f. G‑ZG geregelt ist, 'hinsichtlich des Bedarfs' die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen; ist das Vorhaben nicht in den genannten Verordnungen geregelt, ist Abs3 sinngemäß anzuwenden. §6a Oö. KAG 1997 und §10c Nö. KAG enthalten entsprechende ausführungsgesetzliche Bestimmungen. Mit diesen Regelungen ist im Ergebnis eine Bedarfsprüfung für selbständige Ambulatorien angeordnet.
Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner bisherigen Rechtsprechung Regelungen zu krankenanstaltenrechtlichen Bedarfsprüfungen aufgehoben, wenn sie lediglich dem Konkurrenzschutz zwischen privaten Krankenanstalten gedient haben (vgl VfSlg 13.023/1992, 14.552/1996, 15.740/2000), im Übrigen aber verhältnismäßige Bedarfsprüfungen im öffentlichen Interesse als verfassungskonform angesehen (vgl VfSlg 14.840/1997, 14.456/1999, 15.610/1999, 15.613/1999). Der Verfassungsgerichtshof hegt vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung keine Bedenken gegen das gesetzlich vorgesehene Tatbestandsmerkmal, dass die Errichtung eines selbständigen Ambulatoriums, dessen Genehmigung begehrt wird, zu einer wesentlichen Verbesserung des Versorgungsangebots führen muss (§3a Abs2 Z1 KAKuG, §10c Abs1 lita Nö. KAG, §6a Abs5 Z1 Oö. KAG).
Mit §10c Abs3 Nö. KAG und §6a Abs6a Oö. KAG wird jedoch – in Ausführung der Grundsatzbestimmung des §3a Abs3a KAKuG – unter den gegebenen Voraussetzungen an die Stelle dieser Prüfung die Vereinbarkeit mit Verordnungen nach §23 G‑ZG gesetzt, wobei diese Verordnungen ua die Zahl bestimmter Großgeräte taxativ festsetzen. Damit werden im Ergebnis selbständige Ambulatorien, die in den Anwendungsbereich dieser Bestimmungen fallen, starr kontingentiert.
Art6 StGG garantiert das Recht auf Erwerbsfreiheit, die von freiem Wettbewerb geprägt ist. Rechtliche Berufsantrittshindernisse, die außerhalb der vom Berufsantrittswerber beeinflussbaren Sphäre liegen, greifen nach der Rechtsprechung besonders schwer in die verfassungsrechtlich garantierte Erwerbsfreiheit ein. Der Verfassungsgerichtshof hegt daher vorläufig das Bedenken, dass eine starre Kontingentierung bestimmter selbständiger Ambulatorien, wie sie (die nach vorläufiger Annahme des Verfassungsgerichtshofes zu den anhängigen Erkenntnisbeschwerden präjudiziellen) §3a Abs3a KAKuG, §10c Abs3 Nö. KAG bzw §6a Abs6a Oö. KAG vorsehen, überschießend in den Schutzbereich des Grundrechtes auf Erwerbsfreiheit (Art6 StGG) eingreifen dürfte und damit verfassungswidrig wäre. Im Gesetzesprüfungsverfahren wird unter anderem zu erörtern sein, inwiefern die öffentlichen Interessen an der Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems, insbesondere im Bereich der Großgeräte, auch eine solche Kontingentierung zu rechtfertigen vermögen.
5.3. Zu den in Prüfung gezogenen Verordnungen
Der Verfassungsgerichtshof hegt gegen die in den zu E2445/2019 und zu E2462/2019 protokollierten Beschwerdeverfahren präjudiziellen Teile der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), Nr 1/2018 der Sonstigen Kundmachungen (RIS), und gegen die in dem zu E2872/2020 protokollierten Beschwerdeverfahren präjudiziellen Teile der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), Nr 1/2018 der Sonstigen Kund-machungen (RIS), idF der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019), Nr 6/2019 der Sonstigen Kundmachungen (RIS), folgende Bedenken:
5.3.1. Die genannten Verordnungen dürften jedenfalls auch auf Grundlage von §23 Abs4 G‑ZG, §17 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §4 SKAG und §10 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 ergangen sein. Sollten sich die oben dargelegten Bedenken gegen diese Gesetzesbestimmungen als zutreffend erweisen und zur Aufhebung zumindest einzelner dieser Bestimmungen führen, so dürfte es diesen Verordnungen an einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage fehlen. Daran dürfte auch nichts ändern, dass sich diese Verordnungen weiterhin auf entsprechende Verordnungsermächtigungen anderer Bundesländer stützen könnten.
5.3.2. Ferner geht der Verfassungsgerichtshof vorläufig davon aus, dass §23 Abs4 und 5 G‑ZG vor dem Hintergrund der Trennung der Vollzugsbereiche des Bundes und der Länder die gesonderte Erlassung von Verordnungen einerseits für Angelegenheiten iSd Art10 B‑VG und anderseits für Angelegenheiten iSd Art12 Abs1 Z1 B‑VG vorsieht. Die Gesundheitsplanungs GmbH hat mit der ÖSG VO 2018 bzw mit der ÖSG VO 2018 idF der ÖSG VO 2019 übergreifende, 'gemischte' Verordnungen erlassen, die sich sowohl auf Angelegenheiten iSd Art10 B‑VG als auch auf Angelegenheiten iSd Art12 Abs1 Z1 B‑VG beziehen. Der Verfassungsgerichtshof hegt daher vorläufig das Bedenken, dass die ÖSG VO 2018 bzw die ÖSG VO 2018 idF der ÖSG VO 2019 insofern in Widerspruch zu ihren gesetzlichen Grundlagen stehen.
5.3.3. Sollte das Gesetzesprüfungsverfahren ergeben, dass die Erlassung des ÖSG und der RSG als Verordnungen in die Zuständigkeit der Generalversammlung der Gesundheitsplanungs GmbH fällt, bestünde überdies das Bedenken, dass die in Prüfung gezogenen Verordnungsbestimmungen von der unzuständigen Behörde erlassen worden wären (siehe näher oben bereits 5.1.1.5.).
Der Verfassungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass im zu E2445/2019 protokollierten Verfahren jedenfalls §4 iVm Anlage 2 Spalte 43 ÖSG VO 2018, dass im zu E2462/2019 protokollierten Verfahren jedenfalls §4 iVm Anlage 2 Spalte 45 ÖSG VO 2018 und dass im zu E2872/2020 protokollierten Verfahren jedenfalls §4 iVm Anlage 2 Spalte 33 der ÖSG VO 2018 idF der ÖSG VO 2019 präjudiziell sind. Eine isolierte Aufhebung dieser Spalten der Anlage 2 zu diesen Verordnungen dürfte jedoch dazu führen, dass für die betroffenen Versorgungsregionen eine Null‑Festlegung angeordnet wäre, weshalb neben §4 der genannten Verordnungen jeweils die gesamte Anlage 2 in Prüfung zu ziehen ist. Im Zuge des Verordnungsprüfungsverfahrens wird auch zu prüfen sein, ob eine allfällige Aufhebung oder Feststellung der Gesetzwidrigkeit iSv Art139 Abs3 B‑VG auf die gesamte Verordnung zu beziehen ist."
5. Die Bundesregierung hat eine Äußerung erstattet, in der sie beantragt, das Verfahren einzustellen, in eventu auszusprechen, dass die in Prüfung gezogenen Bestimmungen nicht als verfassungswidrig aufgehoben werden, für den Fall der Aufhebung aber eine Frist von 18 Monaten gemäß Art140 Abs5 B‑VG zu setzen, und im Übrigen der Zulässigkeit des Gesetzesprüfungsverfahrens bzw den im Prüfungsbeschluss dargelegten Bedenken wie folgt entgegentritt (ohne Hervorhebungen im Original):
"[…]
II. Zur Zulässigkeit:
1. Zum Prüfungsumfang:
1.1. Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes soll ein Gesetzesprüfungsverfahren dazu dienen, die behauptete Verfassungswidrigkeit – wenn sie tatsächlich vorläge – zu beseitigen. Der Prüfungsumfang ist insbesondere so abzugrenzen, dass durch die Aufhebung der in Prüfung gezogenen Bestimmungen die angenommene Verfassungswidrigkeit gänzlich beseitigt werden kann (vgl mutatis mutandis VfSlg 16.191/2001, 18.397/2008, 18.891/2009, 19.178/2010, 19.674/2012).
1.2. Vor diesem Hintergrund scheint der Prüfungsbeschluss den Prüfungsumfang nicht richtig abzugrenzen:
1.3. Der Verfassungsgerichtshof hegt im Hinblick auf die §§18, 19, 20 Abs1 und 2 G‑ZG das Bedenken, dass diese Bestimmungen als gesetzliche Determinierung von (auch) krankenanstaltenrechtlichen Verordnungen, welche die Verbindlicherklärung von Teilen des ÖSG bzw der RSG zum Inhalt haben, entgegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG nicht als Grundsatzbestimmung erlassen wurden (Rz 100 des Prüfungsbeschlusses). Dabei übersieht er jedoch offenbar, dass die Determinierung der RSG nicht (nur) in den genannten Bestimmungen erfolgt, sondern (auch) durch den nicht vom Prüfungsumfang mit umfassten §21 G‑ZG, welcher ebenso inhaltliche Vorgaben für die RSG enthält […] und damit in untrennbarem Zusammenhang mit den genannten Bestimmungen steht.
1.4. Des Weiteren hegt der Verfassungsgerichtshof das Bedenken, dass §23 Abs4 und 5 G‑ZG den Anforderungen der Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG an die Leitungsbefugnis oberster Organe der Vollziehung widersprechen, da die maßgebliche Festlegung des Verordnungsinhaltes der Bundes- und den Landes‑Zielsteuerungskommissionen überantwortet sei (Rz 102 bis 107 des Prüfungsbeschlusses). Letzteres ergibt sich jedoch nicht aus §23 Abs4 und 5 G‑ZG, sondern aus §23 Abs1 erster Satz und Abs2 erster Satz G‑ZG […]. Doch auch diese Bestimmungen sind vom Prüfungsumfang nicht mit umfasst.
1.5. Durch die Aufhebung der §§18, 19, 20 Abs1 und 2 sowie §23 Abs4 und 5 G‑ZG würde daher nicht eine Rechtslage hergestellt, auf die die genannten Bedenken des Verfassungsgerichtshofes nicht mehr zuträfen.
1.6. Nach Auffassung der Bundesregierung erweist sich der Prüfungsbeschluss daher insoweit als unzulässig.
2. Zur Darlegung der Bedenken:
2.1. Gemäß dem – aufgrund von §65 Z2 VfGG im amtswegigen Gesetzesprüfungsverfahren sinngemäß anzuwendenden – §62 Abs1 zweiter Satz VfGG hat der Antrag, ein Gesetz als verfassungswidrig aufzuheben, die gegen die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes sprechenden Bedenken im Einzelnen darzulegen. Dieses Erfordernis ist nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nur dann erfüllt, wenn die Gründe der behaupteten Verfassungswidrigkeit – in überprüfbarer Art– präzise ausgebreitet werden, dh dem Antrag mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen ist, mit welcher Verfassungsbestimmung die jeweils bekämpfte Gesetzesstelle in Widerspruch stehen soll und welche Gründe für diese Annahme sprechen (vgl VfSlg 11.150/1986, 13.851/1994, 14.802/1997, 19.933/2014).
2.2. Diesem Erfordernis genügt der Prüfungsbeschluss nur zum Teil:
2.3. Der Verfassungsgerichtshof hegt das Bedenken, dass die Übertragung der (auch finanziellen) Planung für wesentliche Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge auf einen privaten Rechtsträger gegen die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung verstoße (Rz 121 des Prüfungsbeschlusses). Er ordnet jedoch in der Folge diese Bedenken keiner spezifischen Bestimmung des G‑ZG oder des KAKuG zu.
2.4. Darüber hinaus werden im Prüfungsbeschluss keinerlei Bedenken gegen den – wiewohl in Prüfung gezogenen – §23 Abs8 G‑ZG vorgebracht.
2.5. Schließlich hegt der Verfassungsgerichtshof auch das Bedenken, dass §3a Abs3a KAKuG auf verfassungswidrige Weise in den Schutzbereich der Erwerbsfreiheit (Art6 StGG) eingreife (Rz 124 bis 127 des Prüfungsbeschlusses), weil durch die in den durch Verordnung für verbindlich erklärten Plänen die Zahl bestimmter Großgeräte taxativ festgesetzt sei. Dieses Bedenken betrifft jedoch seinem Grunde nach – allenfalls bloß – §20 Abs1 Z10 und 11 G‑ZG, in dem inhaltliche Vorgaben für den ÖSG auch im Hinblick auf Großgeräte getroffen werden. Mit §3a Abs3a KAKuG wird allerdings keinerlei Kontingentierung von Großgeräten angeordnet.
2.6. Der Prüfungsbeschluss ist daher auch aus diesem Grund insoweit unzulässig.
3. Im Übrigen sind für die Bundesregierung keine Anhaltspunkte erkennbar, die gegen die vorläufigen Annahmen des Verfassungsgerichtshofes hinsichtlich der Zulässigkeit des Prüfungsbeschlusses sprächen.
III. In der Sache:
Die Bundesregierung verweist einleitend auf die ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, wonach dieser in einem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes gemäß Art140 B‑VG auf die Erörterung der aufgeworfenen Fragen beschränkt ist (vgl zB VfSlg 19.532/2011) und ausschließlich beurteilt, ob die in Prüfung gezogene Bestimmung aus den in der Begründung des Einleitungsbeschlusses dargelegten Gründen verfassungswidrig ist. Die Bundesregierung beschränkt sich daher im Folgenden auf die Erörterung der im Einleitungsbeschluss dargelegten Bedenken.
1. Zu den Bedenken im Hinblick auf Art12 B‑VG:
1.1. Der Verfassungsgerichtshof hegt die Bedenken, dass die §§18, 19, 20 Abs1 und 2 G‑ZG sowie §23 Abs1 vorletzter und letzter Satz und Abs2 vorletzter und letzter Satz G‑ZG kompetenzwidrig seien (Rz 100 und 101 des Prüfungsbeschlusses): Die Bestimmungen determinieren nach der vorläufigen Annahme des Gerichtshofes (auch) den Inhalt und das Verfahren von krankenanstaltenrechtlichen Verordnungen. Entgegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG seien sie aber nicht als Grundsatzbestimmung ausgewiesen, sondern als (unmittelbar anwendbares) Bundesgesetz erlassen worden.
1.2. Dem ist zu entgegnen, dass diese Bestimmungen auf Kompetenztatbestände gestützt werden können, die eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes begründen, nämlich auf Art10 Abs1 Z11 ('Sozialversicherungswesen') und Art10 Abs1 Z12 B‑VG ('Gesundheitswesen'). Die Bundesregierung geht davon aus, dass die (Bundes‑)Gesetzgebung im Hinblick auf den Umstand, dass keine entsprechenden (ausdrücklich als solche bezeichneten) Grundsatzbestimmungen erlassen wurden, von ihrer Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung in den Angelegenheiten der 'Heil- und Pflegeanstalten' (Art12 Abs1 Z1 B‑VG) keinen Gebrauch gemacht hat, zumal im G‑ZG an anderen Stellen sehr wohl von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht wird (siehe §21 Abs2, 4 und 6, §23 Abs5 und 8 und §24 G‑ZG). Insoweit der Bund keine Grundsätze aufgestellt hat, kann die Landesgesetzgebung die Angelegenheit frei regeln (Art15 Abs6 fünfter Satz B‑VG).
1.3. Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass der Anwendungsbereich der genannten Bestimmungen nicht auf die Angelegenheiten des Art10 Abs1 Z11 und 12 B‑VG eingeschränkt wird (so wie dies in den Grundsatzbestimmungen in Bezug auf Art12 Abs1 Z1 B‑VG gehandhabt wird), da eine solche Einschränkung in den sonstigen Bestimmungen, die – zumindest theoretisch – auch Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG betreffen können, einerseits nur dort vorgesehen ist, wo eine Klarstellung unbedingt erforderlich ist (vgl §23 Abs4 und 7 G‑ZG), und sich andererseits ein solch eingeschränkter Anwendungsbereich ohnedies aus der salvatorischen Klausel in §1 Abs1 G‑ZG ergibt.
1.4. Die Bundesregierung ist daher der Auffassung, dass die in Prüfung gezogenen Bestimmungen kompetenzkonform sind.
2. Zu den Bedenken im Hinblick auf Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG:
2.1. Der Verfassungsgerichtshof hegt weiters das Bedenken, dass die im G‑ZG gewählte 'Konstruktion' den Anforderungen der Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG nicht entspreche (Rz 102 bis 107 des Prüfungsbeschlusses): Die Gesundheitsplanungs GmbH habe als zuständige Behörde keinen Einfluss auf den Inhalt der zu erlassenden Verordnung. Vielmehr dürfte sie verpflichtet sein, solche Inhalte für verbindlich zu erklären, die von anderen Stellen festgelegt wurden, welche (zumindest teilweise) nicht-hoheitlich handeln oder (oder zumindest teilweise) der Ingerenz der obersten Organe der Vollziehung nicht unterliegen. Damit, so der Prüfungsbeschluss, werden die verfassungsrechtlich gebotenen Verantwortungszusammenhänge unterlaufen.
2.2. Was zunächst die Rechtsnatur der Akkordierung des ÖSG und der RSG durch Bund, Länder und Sozialversicherung betrifft (vgl §20 Abs3 und §21 Abs7 G‑ZG), schließt sich die Bundesregierung der Auffassung (Rz 102 des Prüfungsbeschlusses) an, wonach diese Tätigkeiten nicht hoheitlicher Natur seien.
2.3.1. Nach Auffassung der Bundesregierung sind auch die im G‑ZG geregelten Aufgaben der Zielsteuerungskommissionen nicht als hoheitliche Tätigkeiten aufzufassen, weshalb auch keine Weisungsingerenz der obersten Organe der Vollziehung gesetzlich vorgesehen werden müsste:
2.3.2. Die Zielsteuerungskommissionen sind unstrittig nicht mit der Setzung von Hoheitsakten betraut, sodass ihr Handeln lediglich als schlicht-hoheitliches Verwaltungshandeln qualifiziert werden könnte. Es ist aber im Allgemeinen davon auszugehen, dass eine 'Beleihung' ausgegliederter öffentlich-rechtlicher Rechtsträger zur Voraussetzung hat, dass dem Rechtsträger eine Befugnis zur Setzung von Rechtsakten übertragen wird. Die Übertragung einer Befugnis lediglich zu einem Handeln, das, würde es durch Behörden erfolgen, als schlicht-hoheitliches Verwaltungshandeln (und damit dennoch als 'Vollziehung' in einem verfassungsrechtlichen Sinn) zu verstehen wäre, führt demnach noch nicht zur Qualifikation als Beleihung (vgl etwa Wiederin, Die Beleihung, in Fuchs/Merli/Pöschl/Sturn/Wiederin/Wimmer [Hrsg.], Staatliche Aufgaben, private Akteure, Band 2, 2017, 31 [42 f mwN]).
2.3.3. Sollte der Verfassungsgerichtshof der Auffassung sein, dass eine Beleihung auch dann vorliegen kann, wenn der Rechtsträger mit der Befugnis zu schlicht-hoheitlichem Handeln ermächtigt wird, stellt die Bundesregierung zur Erwägung, das Handeln der Zielsteuerungskommissionen nicht als schlicht-hoheitliches Handeln ('Vollziehung' in einem verfassungsrechtlichen Sinn) zu qualifizieren, sondern als einen gesetzlich geordneten politischen Prozess.
2.4. Die Bundesregierung ist daher der Auffassung, dass das Bedenken des Verfassungsgerichtshofes, wonach die im G‑ZG vorgesehene Konstruktion aufgrund fehlender Weisungsingerenz der obersten Organe hinsichtlich der Tätigkeit der Zielsteuerungskommissionen verfassungswidrig sei (Rz 102 des Prü-fungsbeschlusses), nicht zutrifft.
2.5. Die Bundesregierung ist weiters der Auffassung, dass es keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, wenn ein Verwaltungsorgan wie die Gesundheitsplanungs GmbH durch Gesetz verpflichtet wird, einen Inhalt durch Verordnung für verbindlich zu erklären, der nicht vom Verwaltungsorgan selbst, sondern von anderen Stellen festgelegt wird. Im Einzelnen führt sie hiezu Folgendes aus:
2.6.1. Unproblematisch ist es zunächst, wenn im Gesetz eine Pflicht der Behörde zur Erlassung einer Verordnung bestimmten Inhalts vorgesehen wird:
2.6.2. Nach Lehre und Rechtsprechung ist es zulässig, eine Verwaltungsbehörde durch das Gesetz zur Erlassung einer Verordnung zu verpflichten (Rill, Art18 B‑VG, in Kneihs/Lienbacher [Hrsg.], Rill-Schäffer-Kommentar. Bundesverfassungsrecht, 1. Lfg. 2001, Rz 91 mwN; Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5, 2017, Rz 777; Muzak, B‑VG6, 2020, Art18 B‑VG, Rz 32, mit Verweis auf VfSlg 13.714/1994, 14.295/1995). Dies wird umso mehr für beliehene Rechtsträger gelten, zumal diese keine originäre Kompetenz zur Erlassung von Verordnungen gemäß Art18 Abs2 B‑VG haben (vgl VfSlg 16.995/2003).
2.7.1. Unbedenklich ist es auch, dass die Gesundheitsplanungs GmbH nur auf Initiative anderer eine Verordnung erlassen darf:
2.7.2. Der Verfassungsgerichtshof hat zwar aus der Stellung oberster Organe der Vollziehung abgeleitet, dass diese nur unter bestimmten Voraussetzungen an Anträge anderer Stellen gebunden werden dürfen (vgl zB VfSlg 14.977/1997). Dies gilt aber nicht für Organe, die keine obersten Organe sind (vgl VfSlg 13.880/1994). Es ist daher von vornherein nicht unzulässig, die Gesundheitsplanungs GmbH an Anträge anderer Stellen zu binden. Insofern ist es auch verfassungsrechtlich unproblematisch, dass die Gesundheitsplanungs GmbH nur dann zum Handeln ermächtigt (und verpflichtet) ist, wenn die jeweils zuständige Zielsteuerungskommission für verbindlich zu erklärende Teile des ÖSG oder der RSG ausweist.
2.8.1. Verfassungsrechtlich unbedenklich ist nach Auffassung der Bundesregierung schließlich auch, dass die Gesundheitsplanungs GmbH keinen Einfluss auf den Inhalt der für verbindlich zu erklärenden Pläne hat:
2.8.2. Welchen Inhalt eine Verordnung haben muss, ist Verwaltungsbehörden regelmäßig heteronom vorgegeben, dies insbesondere durch das die Verordnung bestimmende Gesetz (vgl Art18 Abs2 B‑VG). So kann zB die Kultusbehörde verpflichtet sein, eine bestimmte Religionsgemeinschaft durch Verordnung anzuerkennen, also eine Verordnung mit einem bestimmten Inhalt zu erlassen (vgl VfSlg 11.931/1988). Die Straßenpolizeibehörde kann verpflichtet sein, auf Antrag einer Person mit Behinderung eine Verordnung mit einem bestimmten Inhalt (Errichtung eines 'Behindertenparkplatzes') zu erlassen (vgl VwGH 28.1.2021, Ro 2019/02/0017).
2.8.3. Über die Determinierung des Inhalts von Verordnungen hinausgehend ist in einigen Gesetzen auch vorgesehen, dass die Behörde Inhalte, die von anderen Stellen stammen, durch Verordnung verbindlich erklärt, so etwa bei der Erklärung eines Kollektivvertrags zur Satzung durch das Bundeseinigungsamt auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft […], bei der Verbindlicherklärung der deutschsprachigen Fassung des Europäischen Arzneibuchs durch den Bundesminister für Gesundheit […] oder bei der Verbindlicherklärung einer nationalen Norm, die von der Normungsorganisation angenommen wurde […].
2.9.1. Schließlich weist die Bundesregierung darauf hin, dass das G‑ZG sicherstellt, dass die jeweils zuständigen obersten Organe – ihrer Verantwortlichkeit entsprechend – Einfluss auf den Inhalt des ÖSG und der RSG ausüben können:
2.9.2. Die obersten Organe haben zunächst im Rahmen der Akkordierung (vgl §20 Abs3 und §21 Abs7 G‑ZG) Einfluss auf den Inhalt der Gesundheitsplanungsakte. In der Bundes‑Zielsteuerungskommission, deren Vorsitz vom für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister geführt wird (§26 Abs2 G‑ZG), kann der ÖSG nur im Einvernehmen zwischen den Kurien des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung beschlossen werden (§26 Abs3 Z1 G‑ZG). Die RSG können von der Landes‑Zielsteuerungskommission nur im Einvernehmen zwischen den Kurien des Landes und der Sozialversicherung beschlossen werden (vgl Art26 Abs2 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG). Der Vertreter des Bundes hat ein Vetorecht (vgl §28 Abs2 G‑ZG).
2.9.3. Die Strukturpläne sind daher regelmäßig vom gemeinsamen politischen Willen des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung getragen. Es erscheint damit geradezu ausgeschlossen, dass ein Gesundheitsplan gegen den Willen der zuständigen obersten Organe der Vollziehung zustande kommt und Verbindlichkeit erlangt.
2.10. Zusammengefasst ist die Bundesregierung daher der Auffassung, dass die in Prüfung gezogenen Bestimmungen nicht den Anforderungen des Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG widersprechen.
3. Zu den Bedenken im Hinblick auf Art102 B‑VG:
3.1. Der Verfassungsgerichtshof hegt weiters das Bedenken, dass die in §23 Abs4 G‑ZG vorgesehene Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH gegen Art102 B‑VG verstoße (Rz 108 bis 112): §23 Abs4 G‑ZG sei (auch) eine Regelung auf dem Gebiet des 'Gesundheitswesens' (Art10 Abs1 Z12 B‑VG); das Gesundheitswesen sei gemäß Art102 B‑VG in mittelbarer Bundesverwaltung zu vollziehen. Ein mit der Erlassung von Verordnungen beliehener Rechtsträger sei als (funktionelle) 'Bundesbehörde' iSd. Art102 B‑VG zu verstehen. Da die Länder dem entsprechenden Gesetzesbeschluss nicht zugestimmt haben, erfülle die Betrauung der Gesundheitsplanungs GmbH mit der Erlassung von Verordnungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens weder die Anforderungen des Art102 Abs1 zweiter Satz B‑VG noch jene des Art102 Abs4 B‑VG.
3.2.1. Vorweg weist die Bundesregierung darauf hin, dass das im Prüfungsbeschluss gehegte Bedenken die grundsätzliche Frage aufwirft, wie sich die Ausgliederung von Staatsaufgaben zu den verfassungsrechtlich vorgesehenen Modellen der Vollziehung verhält; nämlich, ob die verfassungsrechtlichen Vorgaben, die im Fall der Vollziehung durch staatliche Organe zur Anwendung gelangen, gleichermaßen dann zur Anwendung gelangen, wenn die Vollziehung nicht durch staatliche Organe, sondern durch ausgegliederte Rechtsträger besorgt wird.
3.2.2. Wäre es zutreffend, dass Art102 B‑VG auf die Angelegenheiten des Gesundheitswesens schlechthin anzuwenden wäre, könnte daraus der Schluss gezogen werden, dass diese Bestimmung einer (über vereinzelte Angelegenheiten hinausgehenden) Ausgliederung von Aufgaben per se entgegensteht und die Vollziehung in den Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung dem Landeshauptmann und den ihm unterstellten Behörden (das sind ausschließlich die Bezirksverwaltungsbehörden bzw Städte mit eigenem Statut; vgl §8 Abs5 litb ÜG 1920) verfassungsrechtlich vorbehalten ist (vgl auch Wielinger, BVG ÄmterLReg. §8/5 lita und b ÜG 1920, in Korinek/Holoubek [Hrsg.], Österreichisches Bundesverfassungsrecht. Kommentar, 10. Lfg. 2011, Rz 19, nach dem es unzulässig ist, einen Rechtsträger 'ausschließlich oder primär zu dem Zweck zu schaffen, ihm die Besorgung hoheitlicher Aufgaben aus der Landesvollziehung oder der mittelbaren Bundesverwaltung zu übertragen').
3.2.3. Dieser Auffassung steht freilich die jüngere Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes entgegen, wonach Beleihungen grundsätzlich zulässig sind (vgl insb. VfSlg 14.473/1996). Soweit ersichtlich hat der Verfassungsgerichtshof in dieser jüngeren Rechtsprechung – siehe demgegenüber das Erk. VfSlg 3685/1960, in dem ausdrücklich auf Art102 B‑VG abgestellt wird – zur Beurteilung der Zulässigkeit der Beleihung an sich nie auf Art102 B‑VG Bezug genommen.
3.3.1. Abgesehen davon kann Art102 B‑VG auf Beleihungen nur dann anwendbar sein, wenn der beliehene Rechtsträger als 'Bundesbehörde' im Sinn dieser Bestimmung zu qualifizieren ist; nur in einem solchen Fall würde das Zustimmungsrecht der Länder zu Anwendung gelangen. Im Einzelnen führt die Bundesregierung hiezu Folgendes aus:
3.3.2. Ob Art102 B‑VG auf die Begründung von Zuständigkeiten privater Rechtsträger anwendbar ist, ist in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes bisher nicht entschieden worden. In einem obiter dictum (VfSlg 19.721/2012) hat der Gerichtshof die Auffassung vertreten, dass Art102 Abs4 B‑VG auch auf Beleihungen anwendbar sei. In einem Prüfungsbeschluss hat er diese Frage – lediglich – aufgeworfen (VfSlg 19.728/2012), ist in weiterer Folge jedoch nicht darauf eingegangen.
3.3.3. Nach Auffassung der Bundesregierung liegt dem Begriff der 'Bundesbehörde' iSd. Art102 Abs1 und Abs4 B‑VG ein – wie weitreichend auch immer geartetes – organisatorisches Verständnis zugrunde. Die Bundesregierung verkennt dabei nicht, dass der Verfassungsgerichtshof in seinem Erk. VfSlg 20.323/2019 implizit (jedoch ohne nähere Begründung) die zuvor in der Lehre vertretene enge Auslegung des Begriffs der 'Bundesbehörde' (vgl Pernthaler, Die verfassungsrechtlichen Schranken der Selbstverwaltung in Österreich, 3. ÖJT, Bd. I/3, 1967, 77) ablehnt und auch Selbstverwaltungskörper als 'Bundesbehörden' ansieht. Daraus aber folgt – entgegen der in der Literatur vertretenen Auffassung (vgl Wiederin, [Anmerkung zu VfSlg 20.323/2019], RdM 2019, 181 [184]) – nicht, dass beliehene private Rechtsträger gleichermaßen als 'Bundesbehörden' anzusehen sind, legt man diesem Begriff ein (wenn auch etwas abgeschwächtes) staatsorganisatorisches Verständnis zu Grunde.
3.3.4. Das Argument von Wiederin, aaO, wonach Zweifel an der Richtigkeit des (engen) organisatorischen Begriffs der 'Bundesbehörden' in Art102 B‑VG angebracht seien, ist jenes, dass dieser Begriff nicht nur in Art102 Abs1 und 4 B‑VG genannt wird, sondern auch in Art102 Abs2 B‑VG. Stellten Selbstverwaltungskörper keine 'Bundesbehörden' iSd. Art102 Abs2 B‑VG dar, wäre es demnach unzulässig, die in dieser Bestimmung genannten Angelegenheiten durch Selbstverwaltungskörper besorgen zu lassen. Dies hätte etwa zur Konsequenz, dass die Vollziehung des 'Sozialversicherungswesens' durch Selbstverwaltungskörper in unmittelbarer Bundesverwaltung ausgeschlossen wäre. Nach Ansicht der Bundesregierung verfängt dieses Argument aber in Bezug auf die Vollziehung durch beliehene private Rechtsträger nicht in gleichem Maße, wenn man annimmt, dass Beliehene überhaupt nicht als 'Bundesorgane' iSd. Art102 B‑VG (und auch nicht dessen Abs2) anzusehen sind.
3.3.5. Während für Selbstverwaltungskörper nämlich noch gesagt werden kann, dass sie in einem bestimmten 'Vollziehungsbereich' eingerichtet sind (vgl VfSlg 4413/1963) und sich demnach staatliches Handeln auch auf die Organisation des Selbstverwaltungskörpers selbst beziehen kann (wobei die Kompetenz zur Vollziehung nicht mit jener der Gesetzgebung zusammenfallen muss – vgl Art11 Abs1 Z2 B‑VG), kann dies für beliehene private Rechtsträger nicht gleichermaßen gesagt werden. Diese müssen nicht durch das jeweilige (die Kompetenz zur Regelung der Organisation des Beliehenen einschließende) Materiengesetz geschaffen werden, sondern es kann das Materiengesetz auch die Zuständigkeit solcher privater Rechtsträger begründen, die nicht erst gesetzlich errichtet werden, sondern schon zuvor durch privatrechtlichen Rechtsakt errichtet wurden (vgl Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5, 2017, Rz 115). In einem solchen Fall kann aber nicht beurteilt werden, in welchem Vollziehungsbereich der private Rechtsträger eingerichtet ist und ob es sich sohin um eine 'Bundesbehörde' handelt.
3.3.6. Auch vor dem Hintergrund des Erkenntnisses VfSlg 17.421/2004, betreffend die Gebühreninkasso Service GmbH, ist davon auszugehen, dass auch der Verfassungsgerichtshof in seiner bisherigen Rechtsprechung implizit die Auffassung vertreten dürfte, dass Beliehene nicht als in einem bestimmten Vollziehungsbereich eingerichtete Behörden anzusehen sind und sich sohin die Frage der Trennung der Vollziehungsbereiche gar nicht stellt (siehe Mayr, Organisationsrechtliche Fragen einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle, in Lienbacher/Wielinger [Hrsg.], Öffentliches Recht. Jahrbuch 2010, 2010, 93 [102 f]; Pürgy, Die Mitwirkung von Beliehenen des Bundes an der Landesvollziehung, ZfV 2011, 745 [746 f, 753]).
3.3.7. Die gegenteilige Deutung, wonach eine beliehene Gesellschaft des Privatrechts eine 'Bundesbehörde' iSd. Art102 Abs1 und 4 B‑VG darstellt, erscheint auch mit der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs zur Anwendbarkeit sonstiger verfassungsgesetzlicher Bestimmungen auf Beleihungen nur schwer vereinbar. So sollen auch Art18 Abs2 B‑VG und Art20 Abs1 B‑VG nicht unmittelbar auf Beliehene anwendbar (VfSlg 16.995/2003 bzw 16.400/2001) und die Begriffe der 'Verwaltungsbehörden' bzw der 'Organe' in den genannten Bestimmungen in einem organisatorischen Sinne aufzufassen sein.
3.3.8. Wären beliehene Private als 'Bundesbehörden' anzusehen, sodass die bundesstaatliche Kompetenzverteilung auch auf diese anzuwenden wäre, so hätte dies überdies zur Folge, dass eine Beleihung Privater in den Angelegenheiten des Art11 B‑VG gänzlich ausgeschlossen wäre, zumal diese Angelegenheiten (ausschließlich) durch Landesbehörden zu vollziehen sind und eine davon abweichende Zuständigkeit von 'Bundesbehörden' mangels verfassungsrechtlicher Ermächtigung – auch mit Zustimmung der Länder – nicht begründet werden dürfte (vgl Wiederin, Öffentliche und private Umweltverantwortung – Verfassungsrechtliche Vorgaben, in ÖWAV [Hrsg.], Staat und Privat im Umweltrecht. Österreichische Umweltrechtstage 2000, 2000, 75 [89]).
3.4. Die Bundesregierung übersieht indes nicht, dass dem Prinzip der mittelbaren Bundesverwaltung in der jüngeren Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes eine Schutzfunktion zugunsten der Stellung des Landeshauptmannes zugeschrieben wird, nämlich dahingehend, dass Art102 B‑VG einen Vollziehungsvorbehalt zu Gunsten der in dieser Bestimmung genannten Behörden (des Landeshauptmanns und der ihm unterstellten Bezirksverwaltungsbehörden und Städte mit eigenem Statut) enthält. Die Bundesregierung gibt jedoch zu bedenken, dass der Vorbehalt zu Gunsten dieser Behörden schon immer dann nicht zum Tragen kommt, wenn ein privater Rechtsträger beliehen wird.
3.5. Nach Ansicht der Bundesregierung sprechen daher die besseren Gründe dafür, dass eine beliehene Gesellschaft des Privatrechts wie die Gesundheitsplanungs GmbH keine Bundesbehörde iSd. Art102 B‑VG ist und die entsprechende in Prüfung gezogene Bestimmung daher nicht verfassungswidrig ist.
4. Zu den Bedenken im Hinblick auf Art18 Abs1 iVm. Art83 Abs2 B‑VG:
4.1. §23 Abs1, 2, 4, 5 und 6 G‑ZG sieht vor, dass die Gesundheitsplanungs GmbH die ausgewiesenen Teile des ÖSG und der RSG durch Verordnung für verbindlich zu erklären hat. Der Verfassungsgerichtshof hegt im Prüfungsbeschluss das Bedenken, dass diese Zuständigkeitsregelung gegen das aus Art18 Abs1 B‑VG iVm. Art83 Abs2 B‑VG abzuleitende Gebot der exakten Regelung von Behördenzuständigkeiten verstoße, da die zitierten Bestimmungen offen lassen, welches der Organe der beliehenen Gesellschaft konkret zuständig sei (Rz 113 bis 118).
4.2. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass es im Hinblick auf Art18 Abs1 B‑VG iVm. Art83 Abs2 B‑VG zulässig ist, einer GmbH durch Gesetz die Kompetenz zur Ausübung von Hoheitsgewalt zu übertragen, ohne im Gesetz ausdrücklich festzulegen, welches Organ der beliehenen Gesellschaft zur Willensbildung betreffend die Erlassung des Hoheitsakts zuständig ist. Begründend führt sie dazu Folgendes aus:
4.3. Gemäß Art83 Abs2 B‑VG darf niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Diese Bestimmung bindet nicht nur die Vollziehung, sondern auch die Gesetzgebung. Das bedeutet nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, dass die sachliche Zuständigkeit der Behörde im Gesetz selbst festgelegt sein muss (VfSlg 2909/1955, 3156/1957, 6675/1972). Art18 iVm. Art83 Abs2 B‑VG verpflichtet die Gesetzgebung zu einer – strengen Prüfungsmaßstäben standhaltenden – präzisen Regelung der Behördenzuständigkeit (vgl zB VfSlg 19.991/2015 mwH). Eine Zuständigkeitsfestlegung muss klar und unmissverständlich sein (VfSlg 19.965/2015).
4.4.1. In §23 Abs1, 2, 4, 5 und 6 G‑ZG wird übereinstimmend die Gesundheitsplanungs GmbH zur Erlassung einer Verordnung ermächtigt. Behörde ist somit nach dem klaren Wortlaut die Gesundheitsplanungs GmbH selbst, nicht jedoch eines ihrer Organe. Auch aufgrund der Materialien ist nicht zweifelhaft, dass die Gesundheitsplanungs GmbH selbst beliehen werden soll (vgl ErlRV 1333 BlgNR XXV. GP , 9 f).
4.4.2. Es ist der Gesetzgebung auch grundsätzlich erlaubt, eine juristische Person des Privatrechts zur Ausübung von Hoheitsgewalt zu ermächtigen und damit dieser selbst die Stellung einer Behörde einzuräumen. Es ist nicht ersichtlich, dass es verfassungsrechtlich geboten sei, dass nicht der Rechtsträger selbst, sondern lediglich eines seiner Organe Behörde sein dürfe (vgl Wiederin, Verbandskompetenzen, Behördenzuständigkeiten und Organbefugnisse in der sonstigen Selbstverwaltung, in FS Kopetzki, 2019, 723 [727 ff]). So wurden auch in anderen Fällen juristische Personen des Privatrechts – nicht jedoch eines ihrer Organe – gesetzlich zur Ausübung von Hoheitsgewalt ermächtigt, so zB die Austro Control GmbH, […] die GIS Gebühren Info Service GmbH, […] die Schienen-Control‑GmbH […] oder die Rundfunk und Telekom Regulierungs‑GmbH […]. Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner bisherigen Rechtsprechung zu Beleihungen keine grundsätzlichen Bedenken dagegen erhoben, eine juristische Person des Privatrechts selbst zu beleihen (vgl zB VfSlg 14.473/1996 zur Austro Control GmbH, VfSlg 19.307/2011 zur Rundfunk und Telekom Regulierungs‑GmbH).
4.5. Da der Gesundheitsplanungs GmbH selbst – in verfassungsrechtlich zulässiger Weise – die Stellung einer Behörde zukommen soll, entspricht es nach Auffassung der Bundesregierung auch den Anforderungen des Art18 Abs1 B‑VG iVm. Art83 Abs2 B‑VG, die Gesundheitsplanungs GmbH (und eben nicht eines ihrer Organe) als zuständige Behörde im Gesetz zu bezeichnen (vgl Wiederin, Die Beleihung, in Fuchs/Merli/Pöschl/Sturn/Wiederin/Wimmer [Hrsg.], Staatliche Aufgaben, private Akteure, Band 2, 2017, 31 [62]).
4.6.1. Im Schrifttum wird demgegenüber teilweise die Auffassung vertreten, dass die Beleihung einer juristischen Person des Privatrechts gegen das Recht auf den gesetzlichen Richter verstoße, wenn sich das zuständige Organ nicht schon aus dem Gesetz ergebe (Kopetzki, Unterbringungsrecht, Band 1, 1995, 205 FN 1369 mwN).
4.6.2. Diesem Bedenken wird aber – nach Ansicht der Bundesregierung: zutreffend – entgegengehalten, dass es nur dann stichhaltig wäre, wenn ein bestimmtes Organ der juristischen Person und nicht die juristische Person selbst Behörde wäre. Soll jedoch die juristische Person selbst Behörde sein, dann ist mit ihrer Benennung im beleihenden Gesetz dem Recht auf einen gesetzlichen Richter Genüge getan (vgl Wiederin, Die Beleihung, in Fuchs/Merli/Pöschl/Sturn/Wiederin/Wimmer [Hrsg.], Staatliche Aufgaben, private Akteure, Band 2, 2017, 31 [62]).
4.7.1. Welches Organ der Gesundheitsplanungs GmbH zuständig ist, den behördlichen Willen zu bilden und die Kundmachung des Hoheitsakts zu bewirken, muss sich nicht bereits aus dem Gesetz ergeben. Denn insofern die juristische Person selbst Behörde ist, betreffen diese Fragen nicht die behördliche Zuständigkeit, sondern lediglich die innerbehördliche Organisation. Diese muss aber nicht im Gesetz geregelt werden:
4.7.2. Der Verfassungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung ausgesprochen, dass die innere Einrichtung der Behörde, ihre Gliederung in Sektionen, Abteilungen usw durch interne Verwaltungsmaßnahmen geregelt werden kann (VfSlg 13.578/1993 mwH). Auch die Regelung der Approbationsbefugnis ist nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs eine Angelegenheit der inneren Organisation, die die Zuständigkeit der Behörde und damit auch das Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter nicht berührt (VfSlg 10.338/1985). Diese Grundsätze können nach Auffassung der Bundesregierung auch auf die innere Organisation von beliehenen Gesellschaften des Privatrechts übertragen werden.
4.7.3. Insoweit der Verfassungsgerichtshof zu bedenken gibt, dass erhebliche Unterschiede in der Willensbildung zwischen den Organen der Gesundheitsplanungs GmbH bestehen dürften (Rz 116 des Prüfungsbeschlusses), weist die Bundesregierung darauf hin, dass solche Divergenzen in jeder Behörde auftreten können. Art18 Abs1 B‑VG iVm. Art83 Abs2 B‑VG wird hiedurch aber nicht berührt, weil innerbehördliche Divergenzen nicht die Zuständigkeit der Behörde anbelangen.
4.8. Zusammengefasst ist die Bundesregierung daher der Auffassung, dass §23 Abs1, 2, 4, 5 und 6 G‑ZG im Hinblick auf Art18 Abs1 iVm. Art83 Abs2 B‑VG unbedenklich ist.
4.9.1. Es kann daher in diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben, ob sich aus den gesetzlichen Regelungen des Gesellschaftsrechts Anhaltspunkte für die innergesellschaftliche Zuständigkeit ergeben und welches Organ der Gesundheitsplanungs GmbH zuständig ist, den behördlichen Willen zu bilden und die Verordnung kundzumachen. Der Vollständigkeit halber weist die Bundesregierung auf Folgendes hin:
4.9.2. Die Bundesregierung geht davon aus, dass der Geschäftsführer einer beliehenen Gesellschaft gemäß den §§18 und 19 des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung (im Folgenden: GmbHG), RGBl Nr 58/1906, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr 86/2021, zur Willensbildung betreffend die Erlassung von Hoheitsakten zuständig ist. Denn nach diesen Vorschriften wird die Gesellschaft nach außen vom Geschäftsführer vertreten, und bei einem Hoheitsakt wie einem Bescheid oder einer Verordnung handelt es sich um einen Akt, der nach außen gerichtet ist. Demgemäß ist auch in der Geschäfts- und Verfahrensordnung der Gesundheitsplanungs GmbH vorgesehen, dass der Geschäftsführer zuständig ist, den jeweiligen Verordnungsentwurf zu unterzeichnen und ihn als Verordnung der GmbH im RIS kundzumachen (§1 Z1 litb und §3 der Geschäfts- und Verfahrensordnung).
4.9.3. Die Geschäftsführung – bestehend aus einem Geschäftsführer und zwei Stellvertretern – wird durch die Generalversammlung bestellt (vgl §23 Abs3 G‑ZG). Die Bestellung kann gemäß §16 Abs1 GmbHG jederzeit widerrufen werden. Nach allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen kann die Generalversammlung dem Geschäftsführer auch jederzeit Weisungen erteilen (vgl Enzinger, in Straube/Ratka/Rauter, WK GmbHG §20 Rz 30 [Stand 1.11.2018, rdb.at]).
4.9.4. Vor diesem Hintergrund erweisen sich nach Ansicht der Bundesregierung auch die im Prüfungsbeschluss dargelegten Bedenken des Verfassungsgerichtshofes, wonach erhebliche Unterschiede in der Willensbildung zwischen den Organen der Gesundheitsplanungs GmbH bestehen dürften (Rz 116 des Prüfungsbeschlusses), als unbegründet. Denn die Geschäftsführung ist insofern von der Generalversammlung 'abhängig', als sie von dieser ernannt und abberufen wird und an ihre Weisungen gebunden ist. Divergenzen zwischen den Organen der Gesellschaft werden daher in der Praxis kaum vorkommen bzw können von der Generalversammlung – durch eine Weisung oder Neubestellung der Geschäftsführung – ausgeräumt werden.
5. Zu den Bedenken im Hinblick auf die Steuerungsbefugnisse oberster Organe der Vollziehung:
5.1. Der Verfassungsgerichtshof hegt weiters das Bedenken, dass die in §23 Abs7 G‑ZG vorgesehenen Weisungs- und Aufsichtsbefugnisse des Bundesministers nicht hinreichend effektiv seien (Rz 119 bis 120), weil sie es nicht ermöglichen dürften, eine Missachtung von Weisungen effektiv abzustellen.
5.2. Der Verfassungsgerichtshof hat mehrfach ausgesprochen, dass die Steuerungsbefugnisse oberster Organe gegenüber beliehenen Rechtsträgern effektiv sein müssen; Art20 Abs1 B‑VG wirkt hier nicht unmittelbar, sondern verpflichtet die Gesetzgebung, Rechtsvorschriften zu erlassen, die einem obersten Organ eine effektive Leitungs- und Steuerungsfunktion einräumen (vgl VfSlg 16.400/2001, 17.421/2004). Die Beachtung von Weisungen muss in einer dem Art20 B‑VG entsprechenden Weise durchgesetzt werden können (vgl VfSlg 15.946/2000). Der Verfassungsgerichtshof hat auch eine direkte Steuerungsbefugnis hinsichtlich des Personals verlangt (vgl VfSlg 16.400/2001).
5.3.1. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die in §23 Abs7 G‑ZG vorgesehenen Befugnisse diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben genügen:
5.3.2. In §23 Abs7 G‑ZG wird ein umfassendes Aufsichts- und Weisungsrecht des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers in Bezug auf die Tätigkeit 'der Gesellschaft' normiert, insoweit Angelegenheiten des Art10 B‑VG berührt sind. Adressat der Weisungen ist somit die Gesundheitsplanungs GmbH im Ganzen, also sowohl die Vertreter in der Generalversammlung als auch die Geschäftsführung. Da zur Kundmachung der Verordnung der Geschäftsführer zuständig ist (siehe oben Punkt I.3.4.3.), kann der Bundesminister – sofern Angelegenheiten des Art10 B‑VG betroffen sind – unmittelbar durch Weisung auf die Verordnungserlassung Einfluss nehmen.
5.3.3. Bestellt wird die Geschäftsführung durch einstimmigen Beschluss der Generalversammlung (vgl §23 Abs3 vierter und siebenter Satz G‑ZG). Auch die Mitglieder der Generalversammlung unterliegen, sofern Angelegenheiten des Art10 B‑VG berührt sind, den Weisungen des Bundesministers, und zwar auch dann, wenn sie von anderen Rechtsträgern (Länder und Sozialversicherung) entsandt wurden (so auch Stöger, Die Gesundheitsreform 2017 im Überblick – Neue Rechtsprobleme in der Gesundheitsplanung, Jahrbuch Öffentliches Recht 2018, 11 [23]). Der Bundesminister kann daher durch Weisung auf die Bestellung der Geschäftsführung Einfluss nehmen. Sollte sich die Geschäftsführung im Hinblick auf Angelegenheiten des Art10 B‑VG rechtswidrig verhalten (also etwa eine Verordnung nicht kundmachen), kann der Bundesminister die Generalversammlung anweisen, eine neue Geschäftsführung zu bestellen.
5.4.1. Eine unmittelbare Bestellungs- oder Abberufungsbefugnis der Geschäftsführung durch den Bundesminister ist im Gesetz zumindest nicht ausdrücklich vorgesehen. Aufgrund der Funktion der Gesundheitsplanungs GmbH erscheint eine solche Befugnis in der Praxis nach Auffassung der Bundesregierung auch nicht erforderlich:
5.4.2. Die Gesundheitsplanungs GmbH hat von Bund, Ländern und Sozialversicherung abgestimmte (vgl §20 Abs3 und §21 Abs7 G‑ZG) und in der zuständigen Zielsteuerungskommission beschlossene Planungsakte, den ÖSG und die RSG, für verbindlich zu erklären, soweit sie von der zuständigen Zielsteuerungskommission gemäß §23 Abs1 erster Satz und Abs2 erster Satz G‑ZG ausgewiesen wurden. Einen Einfluss auf den Inhalt der Planungsakte hat die Gesundheitsplanungs GmbH nicht. Der ÖSG kann nur im Einvernehmen zwischen den Kurien des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung beschlossen werden (§26 Abs3 Z1 G‑ZG). Bei der Beschlussfassung über die RSG hat der Vertreter des Bundes ein Vetorecht (vgl §28 Abs2 G‑ZG). Gesundheitsplanungsakte sind daher regelmäßig vom gemeinsamen Willen des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung getragen. Sollte sich die Geschäftsführung der Gesundheitsplanungs GmbH im Zusammenhang mit der Verbindlicherklärung der Planungsakte rechtswidrig verhalten (etwa eine Verordnung nicht kundmachen), so wird dies daher regelmäßig nicht nur dem Willen des Bundes, sondern auch dem Willen der Länder und dem des Dachverbands der Sozialversicherungsträger widersprechen. In solchen Fällen kann dann durch die Vertreter des Bundes, der Länder und des Dachverbands der Sozialversicherungsträger in der Generalversammlung eine neue Geschäftsführung bestellt werden, wodurch die Gesetzmäßigkeit der Tätigkeit der Gesundheitsplanungs GmbH sichergestellt werden kann.
5.4.3. Da die Funktion der Gesundheitsplanungs GmbH darin besteht, bereits abgestimmte Planungsakte für verbindlich zu erklären, erscheint eine einseitige Befugnis des Bundesministers zur Abberufung des Geschäftsführers in der Praxis nicht erforderlich. Vor diesem Hintergrund wird erklärlich, warum eine solche Befugnis im Gesetz nicht ausdrücklich genannt wird.
5.5. Dessen ungeachtet ist die Bundesregierung der Auffassung, dass §23 Abs7 G‑ZG auch ein Abberufungsrecht des Bundesministers in Bezug auf die Geschäftsführung einschließt. Denn im ersten Satz dieser Bestimmung wird ein (unbeschränktes) Aufsichtsrecht des Bundesministers normiert, insoweit Angelegenheiten des Art10 B‑VG berührt sind. Im Wesen der Aufsicht (iSd. Art20 Abs1 B‑VG) liegt auch das Recht, nachgeordnete Organe des Amtes zu entheben (Grabenwarter/Frank, B‑VG, 2020, Art20 B‑VG, Rz 10). Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass auch das Aufsichtsrecht gemäß §23 Abs7 erster Satz G‑ZG ein solches Recht einschließt, zumal Bestellungs- und Abberufungsrechte in §23 Abs7 G‑ZG nicht ausdrücklich geregelt werden und somit auch nicht ausgeschlossen sind.
5.6. Zusammengefasst ist die Bundesregierung daher der Auffassung, dass die in §23 Abs7 G‑ZG normierten Steuerungsbefugnisse hinreichend effektiv sind und die Bestimmung daher nicht verfassungswidrig ist.
6. Zu den Bedenken im Hinblick auf die Grenzen der Beleihung:
6.1.1. Eine Beleihung ist nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes auf einzelne Aufgaben der staatlichen Verwaltung beschränkt; staatliche Kern-aufgaben dürfen auf ausgegliederte Rechtsträger nicht übertragen werden (vgl VfSlg 14.473/1996, 16.400/2001, 16.995/2003, 17.341/2004).
6.1.2. Der Verfassungsgerichtshof hegt das Bedenken, dass die Übertragung der (auch finanziellen) Planung für wesentliche Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge auf einen privaten Rechtsträger gegen diese verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung verstoßen könnte (Rz 121 des Prüfungsbeschlusses).
6.2. Vorweg hält die Bundesregierung fest, dass die Frage, ob in einem konkreten Fall die Grenzen der Ausgliederung von Aufgaben der Hoheitsverwaltung auf private Rechtsträger überschritten werden oder nicht, von Wertungen abhängt, die verbindlich vorzunehmen in der Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes liegt (vgl Holoubek, Öffentlich-rechtliche Rahmenbedingungen von Ausgliederungen und Privatisierungen, ÖGZ 2000, 22 [23], unter Hinweis auf VfSlg 14.473/1996).
6.3. In der Literatur wird überwiegend die Meinung vertreten, dass die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung im Fall der Gesundheitsplanungs GmbH nicht überschritten werden (Souhrada, Verbindliche Planung, SV‑Verträge und Krankenanstalten, SozSi 2017, 104 [117]; Baumgartner, Die Verbindlicherklärung von Strukturplänen durch die Gesundheitsplanungs GmbH, ZfV 2018, 255 [259 f]; Friedrich, Strukturprobleme und Lösungen im österreichischen Gesundheitswesen anhand der 'Gesundheitsplanungs GmbH', SPRW 2019, 25 [44 f]; Schrattbauer, Verbindlichkeit der Gesundheitsplanung – ÖSG‑VO 2018 verfassungskonform?, SozSi 2020, 56 [58]; wohl auch Stöger, Die Gesundheitsreform 2017 im Überblick – Neue Rechtsprobleme in der Gesundheitsplanung, Jahrbuch Öffentliches Recht 2018, 11 [21 f]; siehe auch Berka, Die Verantwortung des Staates für die medizinische Versorgung, RdM 2019, 227 [228]; aA Kopetzki/Perthold-Stoitzner, Die Verbindlicherklärung der Strukturpläne aus verfassungsrechtlicher Sicht, RdM 2018, 44 [46 f]).
6.4. Die Bundesregierung schließt sich dieser (überwiegenden) Auffassung an.
6.5.1. Zum einen handelt es sich bei der Gesundheitsplanung um keine staatliche Kernaufgabe:
6.5.2. Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner Rechtsprechung die Vorsorge für die Sicherheit im Inneren und nach außen wie die allgemeine Sicherheitspolizei und das Militärwesen (einschließlich des Wehrersatzdienstes), die Ausübung der (Verwaltungs‑)Strafgewalt und die außenpolitischen Beziehungen zu anderen Staaten zu den ausgliederungsfesten Kernaufgaben des Staates gezählt (VfSlg 14.473/1996, 16.400/2001, 16.995/2003, 17.341/2004). Vor diesem Hintergrund erschiene es inkonsistent, auch die Gesundheitsplanung zu den staatlichen Kernaufgaben zu rechnen. Denn die vom Verfassungsgerichtshof genannten Aufgaben hängen allesamt mit dem Gewaltmonopol des Staates und seinen Beziehungen zu anderen Staaten zusammen. Die Planung der Gesundheitsversorgung steht aber mit diesen Bereichen nicht in Zusammenhang.
6.5.3. Soweit in der Literatur erwogen wurde, eine Kernaufgabe des Staates in der Gesundheitsversorgung unter Verweis auf grundrechtliche Schutzpflichten zu begründen (Kopetzki/Perthold-Stoitzner, Die Verbindlicherklärung der Strukturpläne aus verfassungsrechtlicher Sicht, RdM 2018, 44 [46]), kann dies nach Auffassung der Bundesregierung nicht überzeugen. Denn grundrechtliche Schutzpflichten zielen auf den effektiven Schutz der Rechtspositionen Einzelner ab. Sofern die Rechte Einzelner auch unter Einsatz von Privaten effektiv geschützt werden können, kann aus Schutzpflichten daher nicht abgeleitet werden, dass eine bestimmte Aufgabe ausschließlich vom hoheitlich handelnden Staat selbst besorgt werden müsste.
6.6.1. Zum anderen handelt es sich bei der Verbindlicherklärung des ÖSG und der RSG durch Verordnung auch lediglich um eine einzelne Aufgabe der staatlichen Verwaltung:
6.6.2. Die Gesundheitsplanung umfasst nur einen Teilbereich der Angelegenheiten, die unter die Kompetenztatbestände 'Sozialversicherungswesen' (Art10 Abs1 Z11 B‑VG), 'Gesundheitswesen' (Art10 Abs1 Z12 B‑VG) und 'Heil- und Pflegeanstalten' (Art12 Abs1 Z1 B‑VG) fallen. Zahlreiche Regelungsbereiche der staatlichen Gesundheitsverwaltung, welche auch unter diese Kompetenztatbestände fallen, sind daher von der Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH von vornherein nicht betroffen. Bereits dies spricht nach Auffassung der Bundesregierung gegen die Annahme, dass der Gesundheitsplanungs GmbH mehr als nur vereinzelte Aufgaben der staatlichen Verwaltung übertragen werden.
6.6.3. Auch innerhalb der Aufgabe der Gesundheitsplanung kommt der Gesundheitsplanungs GmbH lediglich eine einzelne Befugnis zu, nämlich die Kompetenz zur Verbindlicherklärung der ausgewiesenen Teile des ÖSG und der RSG durch Verordnung. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ist die Übertragung einer Befugnis zur Erlassung von Verordnungen auf Beliehene auch grundsätzlich zulässig (VfSlg 16.995/2003, 19.307/2011).
6.6.4. Andere Zuständigkeiten, die mit der Gesundheitsplanung in Zusammenhang stehen, sind von der Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH nicht betroffen, so zB die Zuständigkeit der Landesregierungen zur Erlassung von Krankenanstatenplänen (vgl §10a KAKuG), aber auch die Zuständigkeit zur Erteilung krankenanstaltenrechtlicher Bewilligungen (vgl insb. die §§3 Abs1, 3a Abs1 KAKuG), wodurch auch planungsrechtliche Vorgaben umgesetzt werden. Unberührt bleibt grundsätzlich auch die Verpflichtung der Länder zur Sicherstellung öffentlicher Krankenanstaltspflege (§18 KAKuG).
6.6.5. Die Kompetenz der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verordnungserlassung stellt zudem nur einen einzelnen Schritt bei der Umsetzung des ÖSG und der RSG dar. Wie oben unter Punkt I.3.5. dargestellt wurde, geht der Verordnungserlassung ein Verfahren voraus, in dessen Rahmen der Inhalt der Pläne und der Umfang der für verbindlich zu erklärenden Teile bestimmt wird. Die Funktion der Gesundheitsplanungs GmbH erschöpft sich darin, die von den zuständigen Zielsteuerungskommissionen ausgewiesenen Teile einem Begutachtungsverfahren zu unterziehen und sie durch Verordnung für verbindlich zu erklären. Die Gesundheitsplanungs GmbH hat keinen Einfluss auf den Inhalt der für verbindlich zu erklärenden Planungsakte.
6.7. Schließlich hält die Bundesregierung fest, dass die Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH dem öffentlichen Interesse der umfassenden und integrativen Planung des österreichischen Gesundheitswesens dient (ErlRV 1333 BlgNR XXV. GP , 9 f). Hierdurch wird ein geordnetes Vorgehen von Bund und Ländern erreicht, was letztlich auch dem in Lehre und Rechtsprechung angenommenen Effizienzgebot der Bundesverfassung entspricht (so auch Stöger, Die Gesundheitsreform 2017 im Überblick – Neue Rechtsprobleme in der Gesundheitsplanung, Jahrbuch Öffentliches Recht 2018, 11 [21]; ähnlich Baumgartner, Die Verbindlicherklärung von Strukturplänen durch die Gesundheitsplanungs GmbH, ZfV 2018, 255 [260]). Auch dies spricht nach Auffassung der Bundesregierung gegen die Annahme, dass die Grenzen der Ausgliederung von Aufgaben der Hoheitsverwaltung auf private Rechtsträger durch die Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH überschritten werden.
6.8. Zusammengefasst ist die Bundesregierung daher der Auffassung, dass durch die Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH mit der Kompetenz, die ausgewiesenen Teile des ÖSG und der RSG durch Verordnung für verbindlich zu erklären, weder eine staatliche Kernaufgabe noch mehr als nur vereinzelte Aufgaben der staatlichen Verwaltung übertragen werden. Die in Prüfung gezogenen Bestimmungen überschreiten daher diese verfassungsrechtlichen Grenzen von Beleihungen nicht.
7. Zu den Bedenken im Hinblick auf die Kompetenzkonformität des §23 Abs5 G‑ZG:
7.1. Nach der Grundsatzbestimmung des §23 Abs5 G‑ZG hat die Landesgesetzgebung vorzusehen, dass die Gesundheitsplanungs GmbH jene ausgewiesenen Teile des ÖSG und der jeweiligen RSG, welche Angelegenheiten des Art12 B‑VG betreffen, durch Verordnung für verbindlich erklärt. Der Verfassungsgerichtshof hegt das Bedenken, dass diese Bestimmung kompetenzwidrig sei, weil die Verpflichtung der Länder zur Beleihung die Organisationskompetenz der Länder (Art15 Abs1 B‑VG) missachte.
7.2. Die Bundesregierung teilt dieses Bedenken nicht:
7.3. Die Festlegung der behördlichen Zuständigkeit fällt in die Kompetenz der jeweiligen Materiengesetzgebung (vgl VfSlg 2425/1952). Die Bundesgesetzgebung ist daher im Rahmen ihrer Grundsatzkompetenz gemäß Art12 Abs1 Z1 B‑VG ('Heil- und Pflegeanstalten') als Materiengesetzgebung grundsätzlich auch zuständig, die behördliche Zuständigkeit zu regeln.
7.4.1. Die Grundsatzgesetzgebung hat sich auf die Aufstellung von Grundsätzen zu beschränken und darf über diese im Art12 B‑VG gezogene Grenze hinaus nicht Einzelregelungen treffen, die der Landesgesetzgebung vorbehalten sind (VfSlg 16.244/2001 mwH). Diese Grenzen werden im Allgemeinen dann nicht überschritten, wenn das Grundsatzgesetz Fragen von grundsätzlicher Bedeutung regelt, die einer für das ganze Bundesgebiet einheitlichen Regelung bedürfen (vgl VfSlg 2087/1951).
7.4.2. Der Grundsatzgesetzgebung ist es auch nicht verwehrt, Regelung betreffend die Zuständigkeit zur Vollziehung des Ausführungsgesetzes vorzusehen. So hat der Verfassungsgerichtshof eine grundsatzgesetzliche Regelung, nach der die Landesgesetzgebung die Landesregierungen zu verpflichten hat, einen Landeskrankenanstaltenplan durch Verordnung zu erlassen, im Hinblick auf Art12 Abs1 Z1 B‑VG als unbedenklich qualifiziert (VfSlg 17.232/2004).
7.5. Vor diesem Hintergrund geht die Bundesregierung davon aus, dass die Grundsatzgesetzgebung die Ausführungsgesetzgebung auch verpflichten darf, die Zuständigkeit eines bestimmten Organs zur Erlassung einer Verordnung vorzusehen, durch die ausgewiesene Teile des ÖSG und der RSG für verbindlich erklärt werden. Denn durch diese Verordnungserlassung wird eine umfassende und integrative Planung des österreichischen Gesundheitswesens sichergestellt (vgl ErlRV 1333 BlgNR XXV. GP , 9 f). Die Zuständigkeit zur Erlassung dieser Verordnungen stellt damit eine Frage grundsätzlicher Bedeutung dar, die einer für das ganze Bundesgebiet einheitlichen Regelung bedarf und daher vom Bund als Grundsatzgesetzgeber geregelt werden darf. In diesem Sinne hat auch der Verfassungsgerichtshof in VfSlg 17.232/2004 anerkannt, dass die Krankenanstaltenplanung nach bundesweit einheitlichen Grundsätzen und Zielen erfolgt, um ihren Zweck zu erfüllen.
7.6.1. Die Grundsatzgesetzgebung darf auch vorsehen, dass ein privater Rechtsträger durch die Landesgesetzgebung mit einer bestimmten Kompetenz zu beleihen ist. Denn dies ist eine Regelung über die behördliche Zuständigkeit, welche die Organisation der Behörden der Länder nicht betrifft:
7.6.2. Durch eine Beleihung wird eine Person, welche im organisatorischen Sinne kein Staatsorgan ist, zu einem Staatsorgan im funktionellen Sinne (vgl Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5, 2017, Rz 109, 114). Die Organisation der staatlichen Behörden (iSd. Art10 Abs1 Z16 B‑VG und Art15 Abs1 B‑VG) bleibt hiedurch grundsätzlich unberührt. Aufgrund dieser Organisationskompetenzen sind Bund und Länder nämlich nur zuständig, ihre jeweiligen Organe im organisatorischen Sinne zu errichten und einzurichten (vgl Lukan, Die Kreation von Verwaltungsorganen, 2018, 183 mwN). Durch eine Beleihung wird aber weder ein Staatsorgan im organisatorischen Sinne errichtet noch erfolgt eine Umbildung der bestehenden Organisation der staatlichen Behörden.
7.6.3. Folgte man der gegenteiligen Auffassung, so müsste man konsequenterweise annehmen, dass zur Übertragung von Hoheitsgewalt an Private allein die Organisationsgesetzgebung (vgl insb. Art10 Abs1 Z16 B‑VG, Art15 Abs1 B‑VG) zuständig sei, was jedoch mit der Auffassung, dass Zuständigkeitsregelungen durch Materiengesetz zu treffen sind, nur schwer vereinbar wäre (siehe zur Zuständigkeitsordnung auch Baumgartner, Die Verbindlicherklärung von Strukturplänen durch die Gesundheitsplanungs GmbH, ZfV 2018, 255 [262 FN 86 mwN]).
7.6.4. Träfe das Bedenken des Verfassungsgerichtshofs zu, so hätte dies schließlich zur Folge, dass in allen Angelegenheiten, die in Gesetzgebung Landessache sind (wozu strukturell auch jene des Art12 B‑VG gehören), die Beleihung einer nicht durch Landesgesetz errichteten 'Landesbehörde' ausgeschlossen wäre. Denn auch eine solche Regelung müsste – so man ihr die Prämissen des Prüfungsbeschlusses zugrunde legt – dahingehend gedeutet werden, dass sich die Landesgesetzgebung ihrer Kompetenz zur Organisation der Landesbehörden entledigt, was aber verfassungsrechtlich nicht zulässig wäre. Auch eine Delegation der Gesetzgebungskompetenz der Länder betreffend ihre Landesbehörden auf den Bund sieht das B‑VG nicht vor. Dass es – im Hinblick auf die Trennung der Vollziehungsbereiche von Bund und Ländern – aber zulässig ist, landesgesetzlich einer durch Bundesgesetz eingerichteten privatrechtlichen Gesellschaft hoheitliche Befugnisse der Landesvollziehung zu übertragen, hat der Verfassungsgerichtshof in VfSlg 17.421/2004 zumindest implizit vorausgesetzt (siehe Pürgy, Die Mitwirkung von Beliehenen des Bundes an der Landesvollziehung, ZfV 2011, 745 [746 f]). Vor diesem Hintergrund begegnet auch die Beleihung einer bundesgesetzlich eingerichteten GmbH in den Angelegenheiten des Art12 B‑VG keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.
7.6.5. Ob es der Grundsatzgesetzgebung auch erlaubt wäre, die Ausführungsgesetzgebung zur Errichtung (und Beleihung) eines bestimmten privaten Rechtsträgers zu verpflichten, kann in diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben (wäre aber wohl zu verneinen).
7.7. Die Bundesregierung kann daher nicht erkennen, dass §23 Abs5 G‑ZG eine kompetenzwidrige Regelung über die Organisation der Landesbehörden wäre. Durch die Bestimmung werden die Länder verpflichtet, eine bestimmte hoheitliche Zuständigkeit eines bestimmten privaten Rechtsträgers zu begründen. Nicht jedoch werden die Länder verpflichtet, spezielle Landesbehörden zu errichten oder die Organisation der Landesbehörden in sonstiger Weise umzubilden.
7.8.1. Im Schrifttum wird in diesem Zusammenhang auch auf die früheren krankenanstaltenrechtlichen Schiedskommissionen verwiesen (vgl Stöger, Die Gesundheitsreform 2017 im Überblick – Neue Rechtsprobleme in der Gesundheitsplanung, Jahrbuch Öffentliches Recht 2018, 11 [22]).
7.8.2. In den §§28a und 28b des Krankenanstaltengesetzes (KAG), BGBl Nr 1/1957, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr 281/1974, war (als Grundsatzbestimmung) vorgesehen, dass in jedem Land eine Schiedskommission einzurichten ist. Die Vorschriften enthielten nähere organisationsrechtliche Vorgaben etwa über die Zusammensetzung der Schiedskommissionen.
7.8.3. Diese Bestimmungen wurden durch ArtI Z22 des Bundesgesetzes BGBl Nr 282/1988 aufgehoben. In den Materialien wird dazu ausgeführt, dass die Aufhebung der Bestimmungen über Schiedskommissionen im Hinblick auf die durch die Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1974, BGBl Nr 444/1974, erfolgte Aufhebung der Grundsatzkompetenz des Bundes betreffend die 'Organisation der Verwaltung in den Ländern' geboten sei: Da die Bildung und Errichtung von Verwaltungsbehörden nunmehr ausschließlich Sache der Landesgesetzgebung nach Art15 Abs1 B‑VG geworden sei, könnten auch im (grundsatzgesetzlichen) Krankenanstaltengesetz des Bundes Vorschriften über Schiedskommissionen nicht mehr getroffen werden, da es sich bei diesen um (Sonder‑)Verwaltungsbehörden der Länder handle (ErlRV 546 BlgNR XVII. GP , 16 f.).
7.8.4. Daraus kann aber nach Ansicht der Bundesregierung kein Argument gegen die Kompetenzkonformität des §23 Abs5 G‑ZG gewonnen werden. Denn im Unterschied zu den §§28a und 28b KAG wird die Landesgesetzgebung durch §23 Abs5 G‑ZG nicht verpflichtet, spezielle Landesbehörden im organisatorischen Sinn einzurichten, sondern einem privaten Rechtsträger eine Zuständigkeit zu übertragen. Die kompetenzrechtlichen Bedenken gegen die Einrichtung von Schiedskommissionen verfangen daher gegen §23 Abs5 G‑ZG nicht.
7.9. Zusammengefasst ist die Bundesregierung daher der Auffassung, dass §23 Abs5 G‑ZG kompetenzkonform ist.
8. Zu den Bedenken im Hinblick auf die Erwerbsfreiheit (Art6 StGG):
8.1.1. Der Verfassungsgerichtshof hegt das Bedenken, dass §3a Abs3a KAKuG überschießend in den Schutzbereich der Erwerbsfreiheit (Art6 StGG) eingreife und damit verfassungswidrig sei (Rz 124 bis 127 des Prüfungsbeschlusses). §3a Abs2 KAKuG sehe zunächst eine Bedarfsprüfung für selbstständige Ambulatorien vor; solche Ambulatorien dürfen (ua) nur bewilligt werden, wenn ihre Errichtung zu einer wesentlichen Verbesserung des Versorgungsangebots führt. Zwar greifen solche Bedarfsprüfungen in die Erwerbsfreiheit ein, solche Eingriffe können aber gerechtfertigt sein, wovon der Verfassungsgerichtshof im vorliegenden Fall ausgeht.
8.1.2. Für den Fall, dass der verfahrensgegenständliche Leistungsumfang in einer Verordnung, mit der Teile des ÖSG und der RSG verbindlich gemacht wurden, (oder in einem Landeskrankenanstaltenplan) enthalten ist, entfällt die Bedarfsprüfung im Einzelfall und ist gemäß §3a Abs3a KAKuG hinsichtlich des Bedarfs die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen. Der Verfassungsgerichtshof geht davon aus, dass es dadurch zu einer 'starren Kontingentierung' der selbstständigen Ambulatorien komme, die überschießend in den Schutzbereich des Grundrechtes auf Erwerbsfreiheit eingreife. Auch werde zu klären sein, inwiefern die öffentlichen Interessen an der Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems, insbesondere im Bereich der Großgeräte, auch eine solche Kontingentierung zu rechtfertigen vermögen.
8.2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zum verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Freiheit der Erwerbsbetätigung gemäß Art6 StGG (vgl VfSlg 10.179/1984, 12.921/1991, 15.038/1997, 15.700/1999, 16.120/2001, 16.734/2002 und 17.932/2006) sind gesetzliche, die Erwerbs(ausübungs)freiheit beschränkende Regelungen auf Grund des Gesetzesvorbehaltes des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts nur dann zulässig, wenn sie durch das öffentliche Interesse geboten, zur Zielerreichung geeignet, adäquat und auch sonst sachlich zu rechtfertigen sind.
8.3. Nach Auffassung der Bundesregierung ist §3a Abs3a KAKuG zur Erreichung legitimer Ziele geeignet und adäquat und auch sonst sachlich gerechtfertigt:
8.4.1. Gemäß §3a Abs3a KAKuG ist für den Fall, dass der verfahrensgegenständliche Leistungsumfang des selbständigen Ambulatoriums in den Verordnungen gemäß §23 (oder §24) G‑ZG geregelt ist, hinsichtlich des Bedarfs die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen.
8.4.2. Diese Regelung ist Konsequenz des im G‑ZG vorgesehenen Konzepts: Der ÖSG und die RSG dienen der integrativen Planung der Gesundheitsversorgungsstruktur in Österreich (vgl die §§18 Abs1, 19 Abs1 G‑ZG). Dieses Ziel kann insbesondere dann effektiv verwirklicht werden, wenn die Gesundheitspläne rechtsverbindlich sind (siehe oben Punkt I.3.1. bis I.3.2.; zum Problem der fehlenden Rechtsverbindlichkeit von Gesundheitsplanungsakten vgl auch Souhrada, Verbindliche Planung, SV‑Verträge und Krankenanstalten, SozSi 2017, 104 [107 ff]; Schrattbauer, Verbindlichkeit der Gesundheitsplanung – ÖSG‑VO 2018 verfassungskonform?, SozSi 2020, 56 [56 f]). Die Rechtsverbindlichkeit wird im Rahmen des im G‑ZG vorgesehenen Verfahrens hergestellt (siehe oben Punkt I.3.5.). §3a Abs3a KAKuG setzt die Rechtsverbindlichkeit der Gesundheitspläne im Genehmigungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb selbständiger Ambulatorien um, indem die Behörde verpflichtet wird, anstatt einer Bedarfsprüfung im Einzelfall (vgl §3a Abs2 Z1 KAKuG) ausschließlich zu prüfen, ob das Vorhaben mit den durch Verordnung für verbindlich erklärten Gesundheitsplänen übereinstimmt (vgl ErlRV 1333 BlgNR XXV. GP , 11).
8.4.3. §3 Abs3a KAKuG verwirklicht damit die legitimen Ziele der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Dies kommt auch und vor allem den Bewilligungswerbern selbst zugute. Denn auf Grundlage der verbindlichen Planungsakte können sie besser Klarheit über die Aussichten eines Bewilligungsantrags gewinnen.
8.4.4. Nach Ansicht der Bundesregierung macht es auch keinen Unterschied, ob die Bewilligungsvoraussetzungen im Einzelfall anhand der gesetzlichen Vorgaben geprüft werden oder ob diese – gesetzlichen, gleichermaßen zur Anwendung gelangenden – antizipierend in einer Verordnung rechtsverbindlich hinreichend konkret festgelegt werden. Auch aus Sicht des Rechtsunterworfenen macht es – in normativer Hinsicht – keinen Unterschied, ob die Kontingentierung im Einzelfall anhand des Gesetzes oder unter denselben Kriterien anhand der Verordnung erfolgt. Schließlich führen auch Bedarfsprüfungen im Einzelfall im Ergebnis zur Kontingentierung von Leistungsangeboten. §3a Abs3a KAKuG (iVm. den Vorschriften des G‑ZG) zielt nicht etwa darauf ab, das Leistungsangebot zu verringern und die Erwerbsfreiheit dadurch zusätzlich zu beschränken, sondern das Leistungsangebot in einem einheitlichen Verfahren festzulegen und damit bessere Planungssicherheit für alle Betroffenen – und damit auch für die Ausübung der Erwerbsfreiheit – herzustellen.
8.4.5. Durch diese Konstruktion wird auch der Rechtsschutz der Bewilligungswerber nicht geschmälert: Der ÖSG und die RSG können, sofern sie durch Verordnung für verbindlich erklärt werden, durch den Verfassungsgerichtshof geprüft werden. Sollte ein Bewilligungswerber eine bestimmte in einem für verbindlich erklärten Gesundheitsplan vorgesehene Beschränkung für rechtswidrig halten, kann er diese Bedenken schließlich im Verfahren gemäß Art139 B‑VG an den Verfassungsgerichtshof herantragen. Bei einer Einzelfallprüfung ist gemäß §3a Abs3 KAKuG von den Festlegungen des (nicht durch Verordnung für verbindlich erklärten) jeweiligen RSG (als Sachverständigengutachten) auszugehen. Diese unterliegen in diesem Fall aber keiner entsprechenden Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof. Im Schrifttum ist §3a Abs3a KAKuG (und §3 Abs2b KAKuG) daher – nach Auffassung der Bundesregierung: zutreffend – als 'deutliche Verbesserung' des Rechtsschutzes der Bewilligungswerber bezeichnet worden (vgl Stöger, Die Gesundheitsreform 2017 im Überblick – Neue Rechtsprobleme in der Gesundheitsplanung, Jahrbuch Öffentliches Recht 2018, 11 [27]).
8.4.6. Ferner kann §3a Abs3a KAKuG auch zu Ersparnissen an Sachverständigenkosten führen, die notwendig wären, um das Vorliegen eines Bedarfs im Einzelfall zu prüfen (Souhrada, Verbindliche Planung, SV‑Verträge und Krankenanstalten, SozSi 2017, 104 [119]). Insofern dient die Regelung auch verwaltungsöko[no]mischen Zwecken.
8.5.1 Zur Erforderlichkeit der Kontingentierung der Großgeräte weist die Bundesregierung auf den Zusammenhang mit dem Sozialversicherungsrecht hin: Gemäß §338 Abs2a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes – ASVG, BGBl Nr 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr 210/2021, haben sich die Versicherungsträger beim Abschluss von Verträgen an den von der Bundesgesundheitskommission (nunmehr: Bundes‑Zielsteuerungskommission; vgl IA 2172/A, XXVII. GP ) im Rahmen des ÖSG beschlossenen Großgeräteplans zu halten.
8.5.2. Daran knüpft auch das Leistungsrecht in der Krankenversicherung an. Gemäß §131 Abs1 ASVG gebührt dem Anspruchsberechtigten ein Ersatz der Kosten einer Krankenbehandlung in Höhe von 80 %, wenn er nicht einen Vertragspartner eines Versicherungsträgers oder eigene Einrichtungen eines Versicherungsträgers zur Erbringung einer Sachleistung einer Krankenbehandlung in Anspruch nimmt (Kostenerstattung). Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes gebührt dem Anspruchsberechtigten eine solche Kostenerstattung jedoch dann nicht, wenn die Versicherungsträger auf Grund des §338 Abs2a ASVG einen Vertrag nicht abschließen durften (OGH 1.6.1999, 10 ObS 365/98v, 29.6.1999, 10 ObS 6/99a und 1.6.2010, 10 ObS 79/10f). Das mit §338 Abs2a ASVG verfolgte Ziel, teurere Großgeräte auf einige wenige Standorte beschränken zu können, würde sonst unterlaufen. In der Praxis wird dies als 'Wahlarztsperre' bezeichnet. Aus §338 Abs2a ASVG ist auch abzuleiten, dass Untersuchungen mit Großgeräten als Sachleistung nur durch Betreiber von Krankenanstalten und nicht auch durch niedergelassene Ärzte erbracht werden dürfen (arg.: 'bezüglich der nicht landesfondsfinanzierten Krankenanstalten sowie des extramuralen Bereiches auch nach Abstimmung mit der für diese Krankenanstalten in Betracht kommenden Interessenvertretung [Anm: die Wirtschaftskammer Österreich] im Einvernehmen mit den Ländern').
8.5.3. Die in §338 Abs2a ASVG vorgesehene Beschränkung des Vertragspartnerrechts dient, wie auch der Oberste Gerichtshof ausgesprochen hat, dem öffentlichen Interesse an einer Steuerung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung im Hinblick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit. Sie soll die Rentabilität der bestehenden Großgeräte sicherstellen und ein Überangebot verhindern (OGH 1.6.2010, 10 ObS 79/10f) und damit auch die hohe Versorgungsqualität und die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung sicherstellen (vgl auch Grillberger, Wahlärzte, in Grillberger/Mosler, Ärztliches Vertragspartnerrecht, 2012, 240 [253 ff]). Dabei handelt es sich ohne Zweifel um ein legitimes öffentliches Interesse. Dieses Interesse ist für den sogenannten intramuralen Bereich dasselbe wie für den extramuralen Bereich. Die durchschnittlichen Tarife für Untersuchungen durch CT- und MRT‑Großgeräte durch nicht verrechnungsbefugte Ärzte beginnen für CT ab ca. 150 Euro und für MRT ab ca. 220 Euro. Es handelt sich somit um kostenintensive Untersuchungen, weshalb ein besonderes öffentliches Interesse an Steuerungsmechanismen zur Kostenbegrenzung gegeben ist.
8.5.4. Dass die Zahl der Großgeräte limitiert werden soll, erklärt sich auch daraus, dass in Österreich die Zahl der MRT‑Einheiten in der öffentlichen Gesundheitsversorgung (Stand 2019) mit 19,8 je eine Million Einwohner über dem OECD‑Durchschnitt von 16,9 MRT‑Einheiten je eine Million Einwohner liegt. Vergleichbares gilt für die Versorgung mit CT‑Geräten (26,1 Einheiten je eine Million Einwohner gegenüber 25,9 Einheiten je eine Million Einwohner im OECD‑Durchschnitt). Durch diese Zahl an Großgeräten ist demnach eine ausreichende und bedarfsgerechte Versorgung der Versicherten und ihrer anspruchsberechtigten Angehörigen sichergestellt.
8.5.5. Dem gegenüber könnte die Auffassung vertreten werden, dass eine Limitierung der Großgeräte unverhältnismäßig wäre, weil sie nicht nur der Verhinderung von Überkapazitäten diene, sondern auch der Beschränkung der Leistungen der Krankenversicherung. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass eine solche Maßnahme zur Steuerung der Gesundheitsversorgung geeignet und sachgerecht ist, da in diesem Bereich eine angebotsinduzierte Nachfrage besteht (siehe Österle, Markt und Wettbewerb im Gesundheitswesen, in Grillberger/Mosler [Hrsg.], Europäisches Wirtschaftsrecht und soziale Krankenversicherung, 2003, 173 ff). Würde demnach die (ohnedies: relativ hohe) Zahl der Großgeräte nicht kontingentiert, so hätte dies zwangsläufig eine unverhältnismäßig höhere finanzielle Belastung des Gesundheitswesens zur Folge.
8.6. Zusammengefasst ist die Bundesregierung daher der Auffassung, dass §3a Abs3a KAKuG im Hinblick auf Art6 StGG verfassungskonform ist.
9. Zusammenfassend wird daher festgehalten, dass die in Prüfung gezogenen Bestimmungen nach Ansicht der Bundesregierung nicht verfassungswidrig sind.
10. Abschließend weist die Bundesregierung hinsichtlich des Aufhebungsumfangs bezüglich §19 G‑ZG auf Folgendes hin: Der Verfassungsgerichtshof begründet den vom Prüfungsbeschluss gezogenen (Prüfungs- und) Aufhebungsumfang damit, dass ua §19 G‑ZG (auch) krankenanstaltenrechtliche Verordnungen determiniere, ohne als grundsatzgesetzliche Bestimmung erlassen worden zu sein. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Aufhebung einer Bestimmung die vom Verfassungsgerichtshof erkannte Verfassungswidrigkeit zu beseitigen hat. Nach Auffassung der Bundesregierung kann diesem Bedenken durch Aufhebung allein des §19 Abs2 G‑ZG Rechnung getragen werden. Eine Aufhebung auch des §19 Abs1 G‑ZG ist hingegen nicht erforderlich. Diese Bestimmung trifft nämlich keinerlei Vorgaben für den Inhalt von (krankenanstaltenrechtlichen oder anderen) Verordnungen, sondern stellt lediglich – auf deskriptive Weise (vgl Punkt I.3.3.3.) – fest, dass es sich bei ÖSG und RSG um die zentralen Planungsinstrumente für die integrative Versorgungsplanung handelt und dass der ÖSG der Rahmenplan für die RSG ist.
[…]"
6. Die Niederösterreichische Landesregierung hat eine Äußerung erstattet, in der sie beantragt, die in Prüfung gezogenen Gesetzesstellen bzw Verordnungen nicht aufzuheben, im Fall der Aufhebung aber eine Frist von einem Jahr bzw sechs Monaten gemäß Art140 Abs5 bzw Art139 Abs5 B‑VG zu setzen, und im Übrigen den im Prüfungsbeschluss dargelegten Bedenken wie folgt entgegentritt (ohne Hervorhebungen im Original):
"[…]
I. Zu den gesetzlichen Grundlagen der ÖSG‑Verordnungen:
1. Den Ausführungen des Verfassungsgerichtshofes zufolge sieht §23 Abs4 und 5 G‑ZG die Erlassung von Teilen des ÖSG bzw der RSG als Verordnung vor, und zwar sowohl solcher Teile, die – als Verordnung – Gesundheitswesen iSv Art10 B‑VG regeln, als auch solcher Teile, die – als Verordnung – Krankenanstaltenrecht iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG zum Gegenstand haben. Diese Verordnungen dürften durch die §§18, 19, 20 Abs1 und 2 G‑ZG determiniert werden, die als unmittelbar anwendbares Bundesrecht erlassen wurden. Der Verfassungsgerichtshof hegt Bedenken, dass diese Bestimmungen als gesetzliche Determinierung von – auch – krankenanstaltenrechtlichen Verordnungen (insofern) entgegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG als Bundesgesetz und nicht als Grundsatzgesetz erlassen wurden.
1.1 Dem ist aus Sicht der NÖ Landesregierung entgegen zu halten, dass die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung in Österreich beim Bund, bei den Ländern und Gemeinden sowie bei der Sozialversicherung liegt. Für ein reibungsloses Funktionieren der Gesundheitsversorgung ist es erforderlich, dass die verschiedenen Versorgungssektoren in den verschiedenen Verantwortungsbereichen aufeinander abgestimmt werden und wie ein einheitliches System zusammenarbeiten. Dem entsprechend ist die ganzheitliche Sichtweise in der Versorgungsplanung unverzichtbar.
Gerade die Notwendigkeit der ganzheitlichen Sichtweise und die aus Sicht der PatientInnen optimal zu steuernden Versorgungsstrukturen sowie damit verbunden auch der Versorgungsprozesse führte im Jahr 2013 zur Einführung der Zielsteuerung-Gesundheit. Im Mittelpunkt der Zielsteuerung-Gesundheit stehen die PatientInnen und ihre bestmögliche medizinische Behandlung durch eine bessere Abstimmung zwischen dem niedergelassenen Versorgungsbereich und den Krankenanstalten. Den Zielen der Zielsteuerung-Gesundheit kann nur dann entsprechend Rechnung getragen werden, wenn das von Bund, Ländern und Sozialversicherung in der Bundes‑Zielsteuerungskommission beschlossene Planungsinstrument Österreichischer Strukturplan Gesundheit (ÖSG) auch in Teilbereichen einen entsprechenden Verbindlichkeitsgrad erhält. Nicht zuletzt führte der Umstand, dass der ÖSG allein bisher als qualifiziertes Sachverständigengutachten anzusehen war und darüber hinaus keine Wirkung entfaltete, für die Rechtsanwender zu erheblichen Schwierigkeiten, mit denen der Verfassungsgerichtshof in den letzten Jahren auch immer wieder befasst war.
1.2 Das nunmehrige von Bund und Ländern im Rahmen einer Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG festgelegte Konzept, in dem sich die Vertragspartner über Angelegenheiten ihres jeweiligen Wirkungsbereiches verständigen, sieht als Beitrag zur Rechtssicherheit der Normadressaten folgenden Prozess für die Planung und Steuerung vor:
Der ÖSG basiert einerseits auf dem Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (G‑ZG; BGBl I Nr 26/2017), andererseits auf den zwischen dem Bund und allen Bundesländern getroffenen Vereinbarungen gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens (BGBl I Nr 98/2017) sowie Zielsteuerung-Gesundheit (BGBl I Nr 97/2017). Zur Verbesserung der Transparenz wird die aktuelle Fassung des ÖSG sowohl im Rechtsinformationssystem des Bundes als auch auf der Webseite des Gesundheitsressorts veröffentlicht.
Wie oben erwähnt hat der ÖSG selbst die Qualität eines Sachverständigengutachtens und stellt einen gemeinsamen österreichweiten Rahmenplan dar, den der Bund, alle Länder und die Sozialversicherung gemeinsam in der Bundes‑Zielsteuerungskommission (B‑ZK), dem Entscheidungsgremium der Bundesgesundheitsagentur, beschließen. Damit wird ungeachtet der geteilten Verantwortlichkeit ein gemeinsames Bild über die Weiterentwicklung des österreichischen Gesundheitssystems geschaffen.
Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung ist es im öffentlichen Interesse, jene für die nachhaltige Versorgung der Bevölkerung unerlässlichen Teile des ÖSG verbindlich zu machen. Dementsprechend sieht §23 G‑ZG vor, dass einvernehmlich in der B‑ZK als normativ gekennzeichnete Teile des ÖSG als verbindlich festgelegt und durch Verordnung kundgemacht werden. Um eine umfassende und integrative Planung des österreichischen Gesundheitswesens im Rahmen der kompetenz- und verfassungsrechtlichen Gegebenheiten umzusetzen, wurde zur Sicherstellung, dass diese Verordnungen abgestimmte Vorgaben sowohl für den niedergelassenen Bereich als auch für den Krankenanstaltenbereich enthalten, die nicht gewinnorientierte Gesundheitsplanungs GmbH eingerichtet und seitens des Bundes und der Länder mit der Erlassung von Verordnungen bezüglich der verbindlichen Teile der Strukturpläne (ÖSG, RSG) beliehen (§23 Abs4 G‑ZG).
Die Konstruktion der Gesundheitsplanungs‑GmbH mag zwar ungewöhnlich sein und verfassungsrechtliche Aspekte ansprechen, bei einer genauen Betrachtung sieht man allerdings, dass viele der einschlägigen Fragestellungen bereits Vorbilder in der Rechtsordnung haben, die dogmatisch auch akzeptiert sind (Stöger, Die Gesundheitsreform 2017 im Überblick – Neue Rechtsprobleme in der Gesundheitsplanung, in Jahrbuch Öffentliches Recht 2018, 11 [24]). So existieren Beispiele der Beleihung von juristischen Personen, etwa Österreichische Nationalbank, Austro Control GmbH, RTR GmbH, ASFINAG, Österreichische Kontrollbank AG ua (vgl etwa: Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Rz 115 ff).
Aufgabe der Gesundheitsplanungs GmbH ist laut §2 des Gesellschaftsvertrages die Erlassung von Verordnungen gemäß §23 Abs1, Abs2, Abs4 und Abs5 G‑ZG einschließlich der dafür vorgesehenen Begutachtungsverfahren, mit denen die von der B‑ZK nach §23 Abs1 G‑ZG ausgewiesenen Teile des ÖSG für verbindlich erklärt werden, und die Kundmachung dieser Verordnungen im RIS.
Die B‑ZK übermittelt nach Beschlussfassung den durch Verordnung verbindlich zu erklärenden Text des ÖSG samt Erläuterungen an die Gesundheitsplanungs GmbH. Die Gesundheitsplanungs GmbH hat hinsichtlich des Inhaltes der von ihr zu erlassenden Verordnungen keinerlei Gestaltungsspielraum (siehe §23 Abs4 und 5 G‑ZG).
Die Verbindlichmachung von Planungsgrundlagen bzw Planungsvorgaben hat die Rechtssicherheit und ‑klarheit sowohl für Behörden als auch für Bewilligungswerber deutlich erhöht.
2. Der Verfassungsgerichtshof hegt zudem Bedenken, dass es sich bei der ÖSG‑VO 2018 bzw der ÖSG‑VO 2019 um eine kompetenzwidrige Mischverordnung handeln könnte, weil in dieser sowohl der Bundesvollziehung zuzuordnende Angelegenheiten (Art10 Abs1 Z12 B‑VG; 'Gesundheitswesen') als auch der Landesvollziehung zuzuordnende Angelegenheiten (Art12 Abs1 Z1 B‑VG; 'Heil- und Pflegeanstalten') geregelt werden.
2.1 Dem ist entgegen zu halten, dass §23 Abs4 und 5 G‑ZG vorsehen, dass die Gesundheitsplanungs GmbH bestimmte Teile von ÖSG und RSG durch Verordnung für verbindlich zu erklären hat, und zwar einerseits Teile, die Angelegenheiten des Art10 B‑VG betreffen (Abs4), andererseits Teile, die Angelegenheiten des Art12 B‑VG betreffen (Abs5). Dass die Gesundheitsplanungs GmbH eine Verordnung erlässt, die sowohl Angelegenheiten des Vollziehungsbereiches des Bundes (Art10 B‑VG) als auch Angelegenheiten des Vollziehungsbereiches der Länder (Art12 B‑VG) regelt, ergibt sich somit aus den geltenden einfachen Gesetzen.
Zudem beziehen sich die Absätze 4 und 5 des §23 G‑ZG auf die Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH mit Agenden des Art10 B‑VG (Absatz 4) und Art12 B‑VG (Absatz 5). Diese Trennung war erforderlich, da Absatz 4 auf Art10 B‑VG gestützt ist, wohingegen es sich bei Absatz 5 um eine Grundsatzbestimmung handelt. Aus dieser Trennung ist jedoch nicht zwingend ableitbar, dass das G‑ZG nach Kompetenzmaterien getrennt zwei oder mehrere zu erlassende Verordnungen vorschreibt.
Vielmehr führen die entsprechenden Erläuterungen zum G‑ZG (1333 BlgNR 25. GP 10) aus, dass 'einvernehmlich zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung als normativ gekennzeichnete Teile des ÖSG bzw einvernehmlich zwischen Ländern und Sozialversicherung als normativ gekennzeichnete Teile des RSG als verbindlich festgelegt und durch Verordnung kundgemacht werden. Um eine umfassende und integrative Planung des österreichischen Gesundheitswesens im Rahmen der kompetenz- und verfassungsrechtlichen Gegebenheiten umzusetzen, wird zur Sicherstellung, dass diese Verordnungen abgestimmte Vorgaben sowohl für den niedergelassenen Bereich als auch für den Krankenanstaltenbereich enthalten, die Einrichtung einer nicht gewinnorientierten GmbH vorgesehen, die seitens des Bundes und der Länder mit der Erlassung dieser Verordnungen beliehen wird.'
Aus der Formulierung 'sowohl für den niedergelassenen Bereich als auch den Krankenanstaltenbereich' ergibt sich deutlich, dass das G‑ZG Verordnungen vorsieht, die sowohl Art10 B‑VG als auch Art12 B‑VG Materien beinhalten. Da jedenfalls eine ÖSG‑Verordnung und neun RSG‑Verordnungen vorgesehen sind, wurde der Plural beim Begriff 'Verordnung' verwendet.
Die aufgrund des G‑ZG, des NÖGUS‑G und des ÖSG erlassene ÖSG‑Verordnung lässt zudem erkennen, welche ausgewiesenen Teile einerseits der Angelegenheit 'Gesundheitswesen' und damit der Bundesvollziehung und andererseits der Angelegenheit 'Krankenanstaltenrecht' und damit der Landesvollziehung zuzurechnen sind.
Da es auch materiengesetzlich nicht untersagt ist, eine mehrere Kompetenzbereiche umfassende Verordnung zu erlassen, ist auch diesbezüglich keine Gesetzwidrigkeit der ÖSG‑Verordnung gegeben.
Auch die ständige Rechtsprechung des VfGH zeigt, dass die Erlassung kompetenzbereichsübergreifender hoheitlicher Rechtsakte zulässig ist. So ist beispielsweise die Zusammenfassung von Bescheiden mehrerer Behörden in einer Ausfertigung verfassungsrechtlich unbedenklich (VfSlg 9380/1982 und VfSlg 8304/1978 mit Hinweisen auf die Vorjudikatur). Das gilt umso mehr auch für Verordnungen, die sich naturgemäß an einen unbestimmten Adressatenkreis richten. Auch ist diese Rechtsfrage keineswegs neu: Es gibt zahlreiche Verwaltungsorgane, die funktionell sowohl in der Bundesvollziehung als auch in der Landesvollziehung tätig werden und dabei auch jeweils Verordnungen erlassen.
Es spricht daher nichts dagegen, dass die Gesundheitsplanungs GmbH, soweit sie durch §23 Abs4 G‑ZG und durch in Ausführung des §23 Abs5 G‑ZG ergangenen Landesgesetze (§17 Abs1 NÖGUS‑G) mit der Verbindlichmachung von Teilen des ÖSG und der RSG beliehen ist, eine einzige Verordnung zur Verbindlichmachung erlässt. Selbst wenn einzelne Bestimmungen der gegenständlichen Verordnung nicht eindeutig einem Vollziehungsbereich zugeordnet werden könnten, somit janusköpfigen Charakter aufweisen sollten, erachtet dies etwa Jabloner, aaO 242f, auf untergesetzlicher Ebene als zulässig.
3. Der Verfassungsgerichtshof hegt weiters Zweifel, ob die Übertragung der (auch finanziellen) Planung für wesentliche Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung überschreitet.
3.1 Dazu ist zunächst festzustellen, dass nach der Judikatur des VfGH lediglich 'vereinzelte Aufgaben' übertragen werden können und staatliche 'Kernaufgaben' einer Beleihung nicht zugänglich sind (VfSlg 18.808/2009; 17.421/[2004]).
3.2 In der Literatur wird überwiegend vertreten, dass verfassungsrechtliche Grenzen durch die Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH mit der Umwandlung von Teilen der Strukturpläne in Verordnungen nicht verletzt werden (in diesem Sinne etwa Baumgartner, ZfV 2018/22, 255 (258 f.); Stöger, Jahrbuch Öffentliches Recht 2018, 11 (20); Souhrada, Soziale Sicherheit 2017, 104 (117); zuletzt auch (im Hinblick auf die fragliche Bewertung der Gesundheitsplanung als ausgliederungsfeste 'Kernaufgabe' des Staates) Berka, Die Verantwortung des Staates für die medizinische Versorgung, RdM 2019/121, 227 (228).
3.3 Eine verfassungskonforme Beleihung erfordert nach der Rechtsprechung des VfGH unter anderem die Sicherstellung ausreichender Steuerungsmöglichkeiten, die es dem gemäß Art76 Abs1 bzw Art105 Abs2 sowie Art142 B‑VG rechtlich verantwortlichen obersten Organ ermöglichen, in effektiver Weise für die Gesetzmäßigkeit der Vollziehung zu sorgen.
Der NÖ Landesgesetzgeber hat dem aus der Beleihungsjudikatur des VfGH entwickelten Erfordernis einer ausdrücklichen Einräumung von Weisungsbefugnissen Rechnung getragen: So wird in §17 Abs2 NÖGUS‑G explizit angeordnet, dass die Gesundheitsplanungs GmbH in ihrer Tätigkeit, soweit Landesangelegenheiten im Sinne des Art12 B‑VG berührt sind, der Aufsicht und den Weisungen der Landesregierung unterliegen und dieser auf Verlangen zur jederzeitigen Information verpflichtet ist.
Der Verfassungsgerichtshof hegt Bedenken gegen die effektive Leitungs- und Steuerungsfunktion der obersten Verwaltungsorgane gegenüber der Gesundheitsplanungs GmbH.
Da die Bestellung der Geschäftsführung der Gesundheitsplanungs GmbH durch die Länder, den Bund und den Dachverband der Sozialversicherungsträger erfolgt und für Beschlüsse der Gesundheitsplanungs GmbH Einstimmigkeit in der Generalversammlung erforderlich ist, die Generalversammlung jeweils aus einem Vertreter der Länder, des Bundes und des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger besteht, ist aus Sicht der NÖ Landesregierung eine effektive Leitungs- und Steuerungsfunktion des obersten Organes, der Landesregierung, gegeben.
Insgesamt wurden aus Sicht der NÖ Landesregierung die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH nicht überschritten.
4. Zu den Bedenken des Verfassungsgerichtshofes zur Verfassungsmäßigkeit des §17 NÖGUS‑G wird ausgeführt, dass diese Bestimmung in Ausführung der §23 Abs5 und 8 G‑ZG (Grundsatzbestimmungen) ergangen ist.
Es wird diesbezüglich auf die Erläuterungen des Motivenberichts zur Novelle des NÖGUS‑G, LGBl Nr 92/2017 verwiesen:
'Durch Einfügung des §17 Abs1 erfolgt die Ausführung der Grundsatzbestimmung des §23 Abs5 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I Nr 26/2017. §17 Abs1 bildet die landesgesetzliche Grundlage für das hoheitliche Tätigwerden der Gesundheitsplanungs‑GmbH, sodass die von der Landes‑Zielsteuerungskommission als normativ gekennzeichneten Teile des RSG und ÖSG (überregionale Planung von Großgeräten, ausgenommen ECT, PET, Strahlentherapiegeräte, Coronarangiographie‑Geräte) von der Gesundheitsplanungs‑GmbH für verbindlich erklärt werden können. Die im Gesetzestext verwendete Wendung "im Rahmen der Vollziehung des Landes" soll dabei zum Ausdruck bringen, dass sich die Verbindlicherklärung von Teilen des Österreichischen Strukturplanes Gesundheit und des Regionalen Strukturplanes Gesundheit im Anwendungsbereich des Entwurfes auf Angelegenheiten des Art12 (Krankenanstalten) und Art15 B‑VG (Soziales) bezieht. Durch die normierte sinngemäße Anwendung des §23 Abs2 vierter und fünfter Satz wird sichergestellt, dass vor Verordnungserlassung ein Begutachtungsverfahren zu erfolgen hat. Die von der Gesundheitsplanungs‑GmbH für verbindlich erklärten Teile des ÖSG und des RSG sind nach Information der Landesregierung im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS – www.ris.bka.gv.at ) kundzumachen. Durch §17 Abs2 erfolgt die Ausführung des §23 Abs8 Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz, BGBl I Nr 26/2017.
Hiermit wird landesgesetzlich verankert, dass die Tätigkeit der Gesundheitsplanungs‑GmbH, soweit sie Angelegenheiten des Art12 und 15 B‑VG betrifft, der Aufsicht und den Weisungen der Landesregierung unterliegt und auf deren Verlangen zur Information verpflichtet ist.'
Aus Sicht der NÖ Landesregierung entspricht §17 NÖGUS‑G den Grundsatzbestimmungen der §23 Abs5 und 8 G‑ZG und liegt keine Verfassungswidrigkeit dieser Bestimmung vor.
II. Zur krankenanstaltenrechtlichen Bedarfsprüfung:
1. Der Verfassungsgerichtshof führt aus, dass er in seiner bisherigen Rechtsprechung Regelungen zu krankenanstaltenrechtlichen Bedarfsprüfungen aufgehoben habe, wenn sie lediglich dem Konkurrenzschutz zwischen privaten Krankenanstalten gedient haben (vgl VfSlg 13.023/1992, 14.552/1996, 15.740/2000), im Übrigen aber verhältnismäßige Bedarfsprüfungen im öffentlichen Interesse als verfassungskonform angesehen habe (vgl VfSlg 14.840/1997, 14.456/1999, 15.610/1999, 15.613/1999). Der Verfassungsgerichtshof hegt vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung keine Bedenken gegen das gesetzlich vorgesehene Tatbestandsmerkmal, dass die Errichtung eines selbständigen Ambulatoriums, dessen Genehmigung begehrt wird, zu einer wesentlichen Verbesserung des Versorgungsangebots führen muss (§3a Abs2 Z1 KAKuG, §10c Abs1 lita Nö. KAG).
Mit §10c Abs3 Nö. KAG werde jedoch – in Ausführung der Grundsatzbestimmung des §3a Abs3a KAKuG – an die Stelle dieser Prüfung die Vereinbarkeit mit Verordnungen nach §23 G‑ZG gesetzt, wobei diese Verordnungen ua die Zahl bestimmter Großgeräte taxativ festsetzen. Damit werden im Ergebnis selbständige Ambulatorien, die in den Anwendungsbereich dieser Bestimmungen fallen, starr kontingentiert. Der Verfassungsgerichtshof hegt daher das Bedenken, dass eine starre Kontingentierung bestimmter selbständiger Ambulatorien überschießend in den Schutzbereich des Grundrechtes auf Erwerbsfreiheit (Art6 StGG) eingreifen dürfte und damit verfassungswidrig wäre.
1.1 Dem ist aus Sicht der NÖ Landesregierung entgegen zu halten, dass ein solcher Eingriff zulässig ist, wenn dieser durch ein öffentliches Interesse geboten, zur Zielerreichung geeignet, adäquat und auch sonst sachlich zu rechtfertigen ist. Im seinem Erkenntnis vom 26.06.2008 (VfSlg 18.513/2008) kommt der VfGH zu dem Schluss, dass durch die Regelung der Konzessionserteilung kein Eingriff in die Erwerbsausübungsfreiheit vorliegt, weil die Regelung im öffentlichen Interesse, zur Erreichung der Ziele einer bestmöglichen Heilmittel- und ärztlichen Versorgung geeignet und nicht unverhältnismäßig ist.
Auch das Bedarfsprüfungsverfahren im Krankenanstaltenrecht ist zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung im öffentlichen Interesse gelegen und für die nachhaltige Versorgung der Bevölkerung unerlässlich. Nur so kann für sämtliche Versorgungsbereiche eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung auf hohem Qualitätsniveau gewährleistet und Versorgungslücken verhindert werden.
Beim Verfassungsgerichtshof waren ua zu G290/09, G116/10, G117/10, und G119/10 Anträge des Verwaltungsgerichtshofes gemäß Art140 Abs1 B‑VG auf Aufhebung von [–] die Bedarfsprüfung hinsichtlich selbständiger Ambulatorien betreffenden [–] Bestimmungen des NÖ KAG, anhängig. Diese angefochtenen Bestimmungen des NÖ KAG zur Bedarfsprüfung erwiesen sich jedoch aus den im Erkenntnis vom 06.10.2011, G41/10, 42/10 ua, genannten Gründen als nicht verfassungswidrig, weshalb die Anträge des Verwaltungsgerichtshofes abzuweisen waren.
1.2 Aus Sicht der NÖ Landesregierung stellt §10c Abs3 NÖ KAG insofern eine sachliche Regelung dar, als die Qualitätskriterien im ÖSG darauf abzielen, in den verschiedenen Versorgungsstrukturen österreichweit gleiche Versorgungsstandards zu erreichen. Mit dem ÖSG wird sichergestellt, dass Gesundheitsversorgung in ganz Österreich ausgewogen verteilt und gut erreichbar ist und in vergleichbarer Qualität auf hohem Niveau angeboten wird. Der am 30. Juni 2017 von der Bundes‑Zielsteuerungskommission beschlossene ÖSG 2017 enthält quantitative und qualitative Planungsvorgaben und ‑grundlagen für die bedarfsgerechte Dimensionierung der Versorgungskapazitäten bzw der Leistungsvolumina für ausgewählte Bereiche der ambulanten und der akutstationären Versorgung, für die ambulante und stationäre Rehabilitation und für medizinisch-technische Großgeräte. Bei der Erstellung des ÖSG 2017 wurden insbesondere bestehende Angebote sowie demographische und epidemiologische Entwicklungen berücksichtigt.
Das bedeutet, dass Bund, Länder und Sozialversicherung bereits im 'Vorfeld' bei der Erstellung des ÖSG 2017 die für eine harmonische und ausgewogene Verteilung der Ressourcen im Gesundheitssystem erforderlichen Überlegungen und Prüfungen angestellt haben, um österreichweit eine gleichmäßige Versorgung der gesamten Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen sicherzustellen.
1.3 Hinsichtlich der Planung im Gesundheitswesen betonte bereits der EuGH, dass die Planung medizinischer Leistungen die Beherrschung der Kosten sicherstellen und so weit wie möglich jede Verschwendung finanzieller, technischer und menschlicher Ressourcen verhindern soll. Das Gemeinschaftsrecht schließt nicht aus, dass die Infrastrukturen ambulanter Versorgung auch Gegenstand einer Planung sein können. Eine Planung, die eine vorherige Genehmigung für die Niederlassung neuer Anbieter medizinischer Leistungen verlangt, kann sich als unerlässlich erweisen, um eventuelle Lücken im Zugang zu ambulanter Versorgung zu schließen. Weiters ist das notwendig, um die Einrichtung von Strukturen einer Doppelversorgung zu vermeiden, sodass eine medizinische Versorgung gewährleistet ist, die den Bedürfnissen der Bevölkerung angepasst ist, das gesamte Staatsgebiet (daher nicht nur die Sozialversicherung) abdeckt und geografisch isolierte oder auf andere Weise benachteiligte Regionen berücksichtigt (vgl EuGH 10.03.2009; C‑169/07).
Aus Sicht der NÖ Landesregierung liegt aus den genannten Gründen durch die getroffene Regelung kein überschießender Eingriff in den Schutzbereich des Grundrechtes auf Erwerbsfreiheit (Art6 StGG) vor.
2. Zu den Bedenken des Verfassungsgerichtshofes zur Verfassungsmäßigkeit des §10c Abs3 NÖ KAG wird ausgeführt, dass diese Bestimmung in Ausführung des §3a Abs3a KAKuG (Grundsatzbestimmung) ergangen ist.
Der Bundesgesetzgeber hat mit dem Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017 – VUG 2017, BGBl I Nr 26/2017, ua folgende Grundsatzbestimmung in §3a KAKuG aufgenommen:
'(3a) Wenn das verfahrensgegenständliche Leistungsspektrum in den Verordnungen gemäß §23 oder §24 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I Nr XX/2016, geregelt ist, ist hinsichtlich des Bedarfs nur die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen. Ist das Vorhaben nicht in den genannten Verordnungen geregelt, ist Abs3 sinngemäß anzuwenden.'
In den Erläuterungen des Motivenberichts dazu wird ausgeführt:
'Im Bereich des Bedarfsprüfungsverfahrens sowohl für bettenführende Krankenanstalten als auch für selbstständige Ambulatorien erfolgen Änderungen, die der zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung vereinbarten Verbindlichkeitserklärung von Teilen des Österreichischen Strukturplanes Gesundheit (ÖSG) und der Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG) durch Verordnungen Rechnung tragen. Für den Fall, dass das verfahrensgegenständliche Leistungsspektrum in diesen Verordnungen geregelt ist, wird vorgesehen, dass im Zuge der Bedarfsprüfung ausschließlich die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen ist. Die Entscheidung über die Plankonformität des Vorhabens hat mittels Feststellungsbescheid zu erfolgen.'
2.1 Der Landtag von Niederösterreich hat am 19. Oktober 2017 in Ausführung des §3a Abs3a des KAKuG, den §10c Abs3 NÖ KAG, NÖ LGBl Nr 93/2017, beschlossen:
§10c Abs3 (neu) lautet:
'(3) Wenn der verfahrensgegenständliche Leistungsumfang in den Verordnungen gemäß §23 oder §24 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I Nr 26/2017, geregelt ist, ist hinsichtlich des Bedarfs die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen. Ist das Vorhaben nicht in den genannten Verordnungen geregelt, ist Abs1 lita in Verbindung mit Abs2 sinngemäß anzuwenden.'
Die dazu ergangenen Erläuterungen des Motivenberichts zur Novelle des NÖ KAG, LGBl Nr 93/2017 lauten:
'Im Bereich des Bedarfsprüfungsverfahrens für selbstständige Ambulatorien erfolgen Änderungen, die der zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung vereinbarten Verbindlichkeitserklärung von Teilen des Österreichischen Strukturplanes Gesundheit und der Regionalen Strukturpläne Gesundheit durch Verordnungen Rechnung tragen. Für den Fall, dass das verfahrensgegenständliche Leistungsspektrum in diesen Verordnungen geregelt ist, wird vorgesehen, dass im Zuge der Bedarfsprüfung ausschließlich die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen ist. Durch diese neue Bestimmung erfolgt eine Transformation des §3a Abs3a KAKuG ins Landesrecht.'
2.2 Wie der Verfassungsgerichtshof bereits im Erkenntnis Slg 5921/1969 ausgeführt hat, ist der Kompetenztypus der Grundsatzgesetzgebung dadurch gekennzeichnet, dass die Wirksamkeit gesetzgeberischer Maßnahmen für den Bereich der Vollziehung zweier gesetzgeberischer Akte bedarf: Der erste Akt (das Grundsatzgesetz) enthält Normen, die an den Ausführungsgesetzgeber, nicht aber an die Vollziehung gerichtet sind, erst der zweite Akt (das Ausführungsgesetz) ist die für die Vollziehung bestimmte Rechtsgrundlage (VfSlg 6885/1972). Dabei ist zu beachten (VfSlg 16058/2000), dass das Ausführungsgesetz dem Grundsatzgesetz nicht widersprechen (vgl zB VfSlg 2087/1951, 2820/1955, 4919/1965), es also auch nicht in seiner rechtlichen Wirkung verändern (VfSlg 3744/1960, 12280/1990) oder einschränken darf (vgl VfSlg 4919/1965).
2.3. Wie der Verfassungsgerichtshof bereits wiederholt ausgesprochen hat, hat sich die Grundsatzgesetzgebung auf die Aufstellung von Grundsätzen zu beschränken; dem Bundesgesetzgeber ist es verwehrt, über diese in Art12 B‑VG gezogene Grenze hinaus Detailregelungen zu erlassen, die der Landesgesetzgebung vorbehalten sind. Einzelregelungen dieser Art, die ihrem Inhalt nach unmittelbar anwendbar sind, wenn sie in das Ausführungsgesetz übernommen werden (dazu VfSlg 3340/1958), sind nur zulässig, wenn die Regelung Fragen von grundsätzlicher Bedeutung betrifft, die daher einer für das ganze Bundesgebiet wirksamen einheitlichen Regelung bedürfen (G164/2019‑25, G171/2019‑24). Bei §3a Abs3a KAKuG handelt es sich um eine solche Regelung von grundsätzlicher Bedeutung. Der Grundsatzgesetzgeber hat daher seine durch Art12 B‑VG eingeräumte Gesetzgebungskompetenz nicht überschritten.
2.4 Bereits bei grundsätzlicher Betrachtung zeigt sich, dass §3a Abs3a KAKuG erster Satz eine 'Wenn…dann'-Verknüpfung vornimmt, die dem Landesgesetzgeber hinsichtlich des zu erlassenden Ausführungsgesetzes keinen Spielraum gelassen hat. Der zweite Satz dieser Grundsatzbestimmung engt die Möglichkeiten insofern weiter ein, als gerade eben nur dann abweichend eine Verbesserung des Versorgungsangebotes zu prüfen ist, wenn das Vorhaben nicht in den Verordnungen gemäß §23 oder §24 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I Nr 26/2017, geregelt ist.
Den engen Vorgaben der Grundsatzbestimmung folgend, konnte der NÖ Landesgesetzgeber im Hinblick auf die Judikatur des Verfassungsgerichthofes, wonach das Ausführungsgesetz dem Grundsatzgesetz nicht widersprechen, es nicht in seiner rechtlichen Wirkung verändern oder einschränken darf, nur mehr eine gleichlautende Bestimmung in das NÖ KAG einfügen.
Aus Sicht der NÖ Landesregierung entspricht §10c Abs3 NÖ KAG der Grundsatz-bestimmung des §3a Abs3a KAKuG und enthält keinen überschießenden Eingriff in den Schutzbereich des Grundrechtes auf Erwerbsfreiheit (Art6 StGG). Insgesamt ist die Regelung daher als verfassungskonform zu werten."
7. Die Wiener Landesregierung hat eine Äußerung erstattet, in der sie beantragt, §10 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 nicht als verfassungswidrig aufzuheben, im Fall der Aufhebung für das Außerkrafttreten aber eine Frist von 18 Monaten zu setzen, und im Übrigen den im Prüfungsbeschluss dargelegten Bedenken wie folgt entgegentritt (ohne Hervorhebungen im Original):
"[…]
Allgemeines:
Einleitend wird angemerkt, dass die gegenständliche Äußerung im Folgenden nur auf jene Bedenken eingeht, die entweder unmittelbar oder über Grundsatzbestimmungen zumindest mittelbar einen Bezug zu der in Prüfung gezogenen landesrechtlichen Bestimmung des §10 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 aufweisen.
Aufgrund der geteilten Kompetenzrechtslage in Bezug auf das Gesundheitswesen (Art10 B‑VG, Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache) einerseits und das Krankenanstaltenrecht (Art12 B‑VG, Grundsatzgesetzgebung Bund, Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung Land) anderseits, haben der Bund und die Länder unter anderem die Vereinbarung gem. Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBI I Nr 98/2017, abgeschlossen. Der Geltungsbereich dieser Vereinbarung betrifft das gesamte österreichische Gesundheitswesen (intra- und extramuraler Bereich), also insbesondere den niedergelassenen Bereich, die selbständigen Ambulatorien und die bettenführenden Krankenanstalten.
Mit dieser Vereinbarung sind Bund und Länder unter anderem übereingekommen, den Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) und die Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG) als zentrale Planungsinstrumente für die integrative Versorgungsplanung einzusetzen und sicherzustellen, dass die Bundesgesundheitsagentur bzw die Landesgesundheitsfonds bundes- und landesgesetzlich zu ermächtigen sowie organisatorisch in die Lage zu versetzen sind, die einvernehmlich zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung als normativ gekennzeichneten Teile des ÖSG bzw RSG als verbindlich festzulegen und durch Verordnung kundzumachen.
Zur Umsetzung dieser Vereinbarung wurden auf Bundesebene das Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (G‑ZG), BGBl I Nr 26/2017, und auf Landesebene das Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017, LGBl Nr 10/2018, erlassen.
In §10 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 ist Folgendes normiert:
Verbindlichkeitserklärung von Inhalten des Österreichischen Strukturplans Gesundheit und des Regionalen Strukturplans Gesundheit Wien
(1) Die Gesundheitsplanungs GmbH gemäß §23 Abs3 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz-G‑ZG) BGBI I Nr 26/2017 in der Fassung BGBI I Nr 131/2017 wird ermächtigt, die von der Bundes‑Zielsteuerungskommission nach §23 Abs1 G‑ZG ausgewiesenen Teile des ÖSG, soweit diese das Land Wien betreffen, und die nach §9 Abs6 ausgewiesenen Teile des RSG – jeweils insoweit dies Angelegenheiten gemäß Art12 B‑VG betrifft – durch Verordnung als verbindlich zu erklären.
(2) Jene Teile des RSG, die nach §9 Abs6 rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen, sind von der Gesundheitsplanungs GmbH vorab einem allgemeinen, als solches ausgewiesenen, Begutachtungsverfahren zu unterziehen. Ergeben sich nach der Begutachtung Änderungen, ist über die geänderten Teile des RSG eine nochmalige Beschlussfassung in der Wiener Zielsteuerungskommission herbeizuführen.
(3) Die Tätigkeit der Gesundheitsplanungs GmbH unterliegt – insoweit Angelegenheiten des Art12 B‑VG berührt sind – der Aufsicht und den Weisungen der Landesregierung. Die Gesundheitsplanungs GmbH ist auf Verlangen der Landesregierung zur jederzeitigen Information verpflichtet.
(4) In Fällen, in denen kein Einvernehmen über die verbindlich zu erklärenden Teile des RSG gemäß §9 Abs6 bzw deren Änderung gemäß Abs2 in der Wiener Zielsteuerungskommission zustande kommt, ist hinsichtlich der Erlassung eines Wiener Krankenanstaltenplans §5a Abs1 Wiener Krankenanstaltengesetz 1987, LGBl für Wien Nr 23/1987 in der Fassung LGBl für Wien Nr 10/2018, anzuwenden.
Zu den Bedenken hinsichtlich der grundsatzgesetzlichen Grundlagen der ÖSG‑Verordnungen bzw der RSG Wien – Verordnung 2019 im G‑ZG (Punkt 1.1.)
Gemäß Art12 Abs1 B‑VG fällt der Kompetenztatbestand der Heil- und Pflegeanstalten (in weiterer Folge Krankenanstaltenrecht) in die Zuständigkeit des Bundes zur Grundsatzgesetzgebung und des Landes zur Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung. Grundsatzgesetze und Grundsatzbestimmungen sind gem. Art12 Abs2 B‑VG ausdrücklich als solche zu bezeichnen. Ein Grundsatzgesetz liegt nur dann vor, wenn einerseits die darin enthaltene Regelung nicht so bestimmt ist, dass sie im Hinblick auf Art18 B‑VG einwandfrei vollziehbar ist, andererseits die betreffenden Regelungen doch soweit bestimmt sind, dass sie aufgrund ihres Inhaltes den Kompetenztatbeständen des Art12 Abs1 B‑VG zugeordnet werden können. Ein Grundsatzgesetz kann daher sowohl wegen Überbestimmtheit als auch wegen mangelnder Bestimmtheit verfassungswidrig sein. Ein Ausführungsgesetz ist dann verfassungswidrig, wenn es einem Grundsatzgesetz widerspricht. Sind keine Grundsätze aufgestellt, so kann gem. Art15 Abs6 B‑VG das Land solche Angelegenheiten frei regeln.
Im gegenständlichen Fall hat der Bundesgesetzgeber folgende Bestimmungen des G‑ZG ausdrücklich als Grundsatzbestimmung bezeichnet:
(2) (Grundsatzbestimmung) Die Landesgesetzgebung hat in Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG sicherzustellen, dass die RSG in der Landes‑Zielsteuerungskommission entsprechend den Vorgaben des ÖSG bezüglich Inhalten, Planungshorizonten und Planungsrichtwerten kontinuierlich weiterentwickelt und regelmäßig revidiert werden.
[(]4) (Grundsatzbestimmung) Die Landesgesetzgebung hat in Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG sicherzustellen, dass der RSG jedenfalls die in Abs3 genannten Inhalte umfasst.
(6) (Grundsatzbestimmung) Die Landesgesetzgebung hat in Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG sicherzustellen, dass bei der Kapazitätsplanung für den gesamten ambulanten Bereich die Vorgaben des Abs5 eingehalten werden.
(5) (Grundsatzbestimmung) Insoweit die ausgewiesenen Teile des ÖSG und der jeweiligen RSG Angelegenheiten des Art12 B‑VG betreffen, ist durch die Landesgesetzgebung vorzusehen, dass die Gesundheitsplanungs GmbH diese Teile ebenfalls durch Verordnung für verbindlich erklärt.
(8) (Grundsatzbestimmung) Durch die Landesgesetzgebung ist vorzusehen, dass die Tätigkeit der Gesellschaft – insoweit Angelegenheiten des Art12 B‑VG berührt sind – der Aufsicht und den Weisungen der jeweiligen Landesregierung unterliegt und auf deren Verlangen zur jederzeitigen Information verpflichtet ist.
(Grundsatzbestimmung) Die Landesgesetzgebung hat vorzusehen, dass in Fällen, in denen kein Einvernehmen über die verbindlich zu erklärenden Teile des RSG bzw deren Änderungen entsprechend den Bestimmungen im §23 Abs2 in der Landes‑Zielsteuerungskommission zustande kommt, hinsichtlich der Erlassung eines Landeskrankenanstaltenplanes §10a KAKuG anzuwenden ist.
Der Bundesgesetzgeber bestimmt somit ausdrücklich in §23 Abs5 G‑ZG in den Grundsätzen, dass in Bezug auf jene von den Zielsteuerungskommissionen ausgewiesenen Teile des ÖSG und der jeweiligen RSG, die Krankenanstaltenrecht zum Gegenstand haben, durch die Landesgesetzgebung vorzusehen ist, dass die Gesundheitsplanungs GmbH diese Teile ebenfalls durch Verordnung für verbindlich zu erklären hat. Andere als die ausgewiesenen Teile der Strukturpläne sind nicht als Verordnung zu erlassen.
Weiters stellt er in §21 Abs4 und 6 G‑ZG auch grundsatzgesetzliche Vorgaben einerseits in Bezug auf den Mindestinhalt des RSG sowie andererseits in Bezug auf die Kapazitätsplanung für den gesamten ambulanten Bereich auf, indem auf die Vorgaben des §21 Abs3 und Abs5 G‑ZG verwiesen wird, wodurch diese Vorschriften ebenso als Inhalt der grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des §21 Abs4 und 6 G‑ZG anzusehen sind.
Die nicht als Grundsatzgesetz bezeichneten §§18, 19 und 20 Abs1 und 2 G‑ZG enthalten generelle Grundsätze über die Planung der österreichischen Gesundheitsversorgungsstruktur, allgemeine Aussagen über die Planungsinstrumente des ÖSG und der RSG sowie eine demonstrative Aufzählung von inhaltlichen Vorgaben für den ÖSG in seiner Eigenschaft als objektiviertes Sachverständigengutachten.
Die Annahme des Verfassungsgerichtshofes, dass diese Bestimmungen Rechtsgrundlage für die zu erlassenden Verordnungen sind, trifft aufgrund des Inhaltes dieser Bestimmungen nicht zu.
Im Ergebnis können die krankenanstaltenrechtlichen Verordnungen durch die zuvor erwähnten grundsatzgesetzlichen Regelungen als ausreichend determiniert angesehen werden.
Da der Bundesgesetzgeber über das vor Erlassung der Verordnungen zur Verbindlicherklärung von Inhalten des ÖSG und der RSG durchzuführende Begutachtungsverfahren keine Grundsätze aufgestellt hat, sind die Länder gem. Art15 Abs6 B‑VG befugt, diese Angelegenheit frei zu regeln. Die zu §23 Abs1 und 2 G‑ZG korrespondierenden Verfahrensbestimmungen finden sich in §§9 und 10 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017.
Zu den Bedenken dass die maßgebliche Festlegung des Verordnungsinhaltes der Gesundheitsplanungs GmbH entzogen sei (Punkt 1.2.)
Die Gesundheitsplanungs GmbH ist verpflichtet, die von den Zielsteuerungskommissionen ausgewiesenen Teile der Strukturpläne für verbindlich zu erklären. Diese Verpflichtung ist tatsächlich mit keiner Gestaltungsmöglichkeit verbunden.
Dass ein Bundes- oder Landesorgan von einer anderen Stelle festgelegte Inhalte für verbindlich erklärt, ist verfassungsrechtlich nicht bedenklich, sondern findet sich vielmehr auch in anderen Zusammenhängen in der Rechtsordnung wieder, siehe z. B. die Intimation von Bescheiden des Bundespräsidenten sowie die Verbindlicherklärung von ÖNORMEN nach §9 NormenGesetz 2016. Im zuletzt genannten Fall wird der Inhalt der für verbindlich erklärten Norm von einer anderen Stelle als dem Gesetz- oder Verordnungsgeber, nämlich der mit keinen hoheitlichen Befugnissen ausgestatteten Normungsorganisation festgelegt.
Zur Beleihung einer Stelle mit Aufgaben der Bundes- und Landesverwaltung und den Bedenken im Hinblick auf die Erlassung von 'gemischten' Verordnungen (Punkt 1.3. und 2.)
Nach der bisherigen Staatenpraxis wurden keine verfassungsrechtlichen Bedenken gesehen, einen außerhalb der Verwaltungspraxis stehenden privaten Rechtsträger sowohl mit Aufgaben der Bundesverwaltung als auch mit solchen der Landesverwaltung zu betrauen. Als Beispiel zu nennen ist die Bestellung von ein- und derselben Person zum Forstschutzorgan und zum Jagdschutzorgan [Pürgy, die Mitwirkung von Beliehenen an der Landesvollziehung, ZfV 2011, 745 ff., (754)]. Auch der Verfassungsgerichtshof hat sich bereits mit einer derartigen Konstruktion befasst, Das Erkenntnis VfSlg 17.421/2004 betrifft die GIS Gebühren Info Service GmbH (kurz: GIS GmbH), die [b]undesgesetzlich als Kapitalgesellschaft eingerichtet und sowohl mit Aufgaben der Bundes- als auch der Landesverwaltung beliehen ist. So obliegt der GIS GmbH in Wien etwa die hoheitliche Einhebung des Kulturförderungsbeitrages (§6 Abs1 Wiener Kulturförderungsbeitragsgesetz 2000). Der Verfassungsgerichtshof hat diese Konstruktion nun im genannten Erkenntnis nicht etwa deshalb aufgehoben, weil die Doppelfunktion als für den Bund und für die Länder tätige Gesellschaft als verfassungswidrig angesehen wurde, sondern aus hier nicht näher relevanten anderen Gründen. Mit dieser Entscheidung hat der Verfassungsgerichthof die Zulässigkeit einer solchen Konstruktion implizit anerkannt [Mayr, Jahrbuch öffentliches Recht 2010, 102; Pürgy, aaO, ZfV 2011, 746f und 754 sowie Baumgartner, Die Verbindlicherklärung von Strukturplänen durch die Gesundheitsplanungs GmbH ZfV, 3/2018, 255 ff. (264)]. Ausgehend davon ist die hier in Rede stehende Konstruktion einer GmbH, die Pläne im Bereich des Art10 B‑VG einerseits und im Bereich des Art12 Abs1 Z1 B‑VG andererseits jeweils durch Verordnung für verbindlich erklären soll, verfassungsrechtlich zulässig.
Klarzustellen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Gesundheitsplanungs GmbH nach dem Wortlaut der Absätze 4 und 5 des §23 G‑ZG dazu befugt ist, in beiden Wirkungsbereichen Verordnungen zu erlassen. Dementsprechend agiert die Gesundheitsplanungs GmbH bei der Erlassung von Bundesverordnungen funktionell als Bundesorgan und bei der Erlassung von Landesverordnungen funktionell als Landesorgan (Baumgartner, aaO, ZfV, 263). Dies ist ebenso verfassungsrechtlich zulässig.
Im Ergebnis ist die gesonderte Erlassung von Verordnungen einerseits für die Angelegenheiten des Art10 B‑VG und andererseits für die Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG nicht erforderlich, da eine eindeutige Zuordnung des Inhaltes der Verordnung zu den jeweiligen Kompetenztatbeständen möglich ist. Die gesetzlichen Grundlagen in §23 G‑ZG unterscheiden zwischen jenen Inhalten der Strukturpläne, die Angelegenheiten des Art10 BVG betreffen und jenen, die dem Art12 B‑VG unterliegen. Die Trennung lässt sich auch legistisch einwandfrei nachvollziehen: §23 Abs4 G‑ZG bezieht sich auf die Angelegenheiten der niedergelassenen Ärzte, das sind Angelegenheiten des Bundes nach Art10 Abs1 Z12 B‑VG und enthält aus diesem Grund unmittelbar anwendbares Bundesrecht. §23 Abs5 G‑ZG hingegen ist eine Anordnung an den Landesgesetzgeber betreffend den stationären Bereich der Krankenanstalten und erfasst somit Inhalte, die dem Art12 B‑VG unterliegen.
Zu den Bedenken betreffend die fehlende Einholung der Zustimmung der Länder (Punkt 1.3.)
Die dem Konzept des §23 G‑ZG zugrundeliegende Idee der integrativen Gesundheitsplanung ist dem Bund und allen Ländern bereits seit 2013 ein dringendes Anliegen. In diesem Jahr wurde die erste Vereinbarung gem. Art15a B‑VG mit dem Titel 'Zielsteuerung – Gesundheit' abgeschlossen (BGBl I Nr 200/2013). Gegenstand der Vereinbarung BGBl I Nr 97/2017 ist die Fortführung und Weiterentwicklung der bereits eingerichteten integrativen partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (siehe Art1 dieser Vereinbarung). Auch an dieser Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG haben alle Länder teilgenommen. Es ist daher davon auszugehen, dass der Bundesgesetzgeber für die Umsetzung der integrativen Gesundheitsplanung im §23 G‑ZG von der Zustimmung aller Länder ausgehen konnte.
Zu den Bedenken dass keine exakte Regelung der Behördenzuständigkeit der beliehenen Gesundheitsplanungs GmbH vorliege (Punkt 1.4.)
Die Gesundheitsplanungs GmbH ist ein sowohl vom Bund als auch von den Ländern mit Aufgaben der Vollziehung des Bundes als auch der Länder beliehener privater Rechtsträger. Organisatorisch handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, die nach den gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen gegründet und in das Firmenbuch eingetragen wurde. Einziger Unternehmensgegenstand der Gesundheitsplanungs GmbH ist die Erlassung von Verordnungen gem. §23 G‑ZG bzw §10 Abs1 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 samt Kundmachung einschließlich der Durchführung des dafür vorgesehenen Begutachtungsverfahrens.
Eine gesetzliche Regelung, welches interne Organ der Gesundheitsplanungs GmbH zur Erlassung der Verordnungen zuständig ist, wurde im G‑ZG bzw im Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 nicht getroffen, weshalb diesbezüglich auf die allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen im GmbH‑Gesetz zurückzugreifen ist.
Nach den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften verfügt eine GmbH zwingend über folgende Organe: die Geschäftsführung und die Generalversammlung. Die Geschäftsführung ist das zentrale Geschäftsführungs- und Vertretungsorgan und ist diese an die Weisungen der Gesellschafter gebunden. Bei der Generalversammlung handelt es sich um das allgemeine Willensbildungsorgan der GmbH und besteht diese aus der Gesamtheit der Gesellschafter, das heißt Bund, Ländern sowie Dachverband der Sozialversicherungsträger. Die Generalversammlung hat ausdrückliche gesetzlich zugewiesene Aufgaben (siehe §35 GmbH‑Gesetz) und können ihr darüber hinaus im Gesellschaftsvertrag weitere Aufgaben zugewiesen werden. Nachdem der einzige Unternehmensgegenstand der Gesundheitsplanungs GmbH die Erlassung von Verordnungen gem. §23 G‑ZG bzw §10 Abs1 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 samt Kundmachung einschließlich der Durchführung des dafür vorgesehenen Begutachtungsverfahren ist, kann dafür als zuständiges Organ nur die Geschäftsführung verantwortlich sein, da bei der Annahme einer Zuständigkeit der Generalversammlung anstelle der Geschäftsführung dieser kein Aufgabenbereich in Bezug auf den einzigen Unternehmensgegenstand der Gesellschaft zukommen würde.
Im Ergebnis ist somit die Behördenzuständigkeit der Gesundheitsplanungs GmbH durch die Bestimmung des §10 Abs1 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 in Zusammenschau mit den gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen als hinreichend exakt im Sinne des Art18 iVm Art83 B‑VG festgelegt anzusehen.
Zu den Bedenken der fehlenden umfassenden und effektiven Steuermöglichkeit der beliehenen Gesundheitsplanungs GmbH durch die obersten Organe der Vollziehung (Punkt 1.5.)
Nach der Judikatur des Verfassungsgerichthofes wirkt das Weisungsprinzip des Art20 Abs1 B‑VG nur innerhalb der Verwaltung. In Fällen der Ausübung von Hoheitsgewalt durch außerhalb der Verwaltung stehende Rechtsträger wirkt Art20 Abs1 B‑VG als Gebot an den einfachen Gesetzgeber, die Rechtslage so zu gestalten, dass dem jeweils obersten Organ eine effektive Leitungs- und Steuerungsmöglichkeit zukommt (VfSlg 15.946/2000, 16.400/2001). Aufgrund dieser Rechtsprechung hat der Wiener Landesgesetzgeber in §10 Abs3 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 vorgesehen, dass die Tätigkeit der Gesundheitsplanungs GmbH, insoweit Angelegenheiten des Art12 B‑VG berührt sind, der Aufsicht und den Weisungen der Landesregierung unterliegt. Die Gesundheitsplanungs GmbH ist auf Verlangen der Landesregierung zur jederzeitigen Information verpflichtet. Der Wiener Landesgesetzgeber ist damit seiner verfassungsrechtlichen Pflicht zur expliziten Anordnung von Weisungsrechten voll und ganz nachgekommen.
§23 Abs3 dritter Satz G‑ZG sieht nun vor, dass die Gesellschafter der Gesundheitsplanungs GmbH der Bund, die Länder und der Dachverband der Sozialversicherungsträger sind, die jeweils einen Vertreter in die Generalversammlung entsenden. Die Beschlussfassung in der Generalversammlung erfolgt einstimmig. §10 Abs3 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 ist aufgrund seines öffentlich-rechtlichen Charakters so zu verstehen, dass die darin enthaltene Anordnung unabhängig vom Willen der Gesellschafter einer GmbH gilt. Dies bedeutet, dass alle Organe der Gesellschaft, soweit sie Adressat einer Weisung der Wiener Landesregierung sind, bereits ex lege zur Umsetzung der Weisung gesetzlich verpflichtet sind.
In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass ausschließlich ausverhandelte Inhalte in die Verordnung einfließen. Wenn daher die Gesellschaft gesetzwidrig andere Inhalte als diese für verbindlich erklärt oder im Einzelfall Weisungen nicht befolgt, hätten die Gesellschafter natürlich sofort geeignete Maßnahmen zu treffen, die letztlich bis zur Abberufung der betreffenden Organe reichen können.
Es bestehen daher aufgrund der gesetzlich normierten Aufsichts‑, Weisungs- und Informationsrechte in §10 Abs3 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017, der gesellschaftsrechtlichen Durchgriffsrechte und insbesondere auch im Hinblick auf die rein formalen Aufgaben der Gesundheitsplanungs GmbH eine ausreichende Steuerungsmöglichkeit der obersten Organe der Verwaltung.
Zu den Bedenken, dass die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung überschritten würden (Punkt 1.6.)
Es wird auf die Ausführungen zu den Punkten 1.3. und 2. verwiesen. Ergänzend wid Folgendes ausgeführt:
Im Bereich der Gesundheit ist eine Kernaufgabe der staatlichen Verwaltung die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung auf hohem Qualitätsniveau und ist, um dieses Ziel zu erreichen, eine auf alle Elemente des Versorgungssystems abgestimmte Planung erforderlich. Diese erfolgt gemeinsam durch Bund, Länder und Sozialversicherung insbesondere mittels ÖSG und RSG.
Gemäß §23 Abs1 und 4 G‑ZG sowie §10 Abs1 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 erstreckt sich die einzige Aufgabe der Gesundheitsplanungs GmbH – abgesehen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Begutachtungsverfahrens – auf den Bereich der Verbindlicherklärung von (Teilen) des ÖSG sowie der RSG durch Erlassung von Verordnungen samt Kundmachung. Es handelt sich um einen reinen Formalakt, der Gesundheitsplanungs GmbH obliegt lediglich die technische Durchführung der Verbindlicherklärung von Plänen, deren Inhalt von den Zielsteuerungskommissionen, denen Vertreter von Bund, den Ländern sowie den Sozialversicherungsträgern angehören, festgelegt werden.
Davon unberührt bleibt die Verpflichtung der Länder zur Sicherstellung der Krankenanstaltenpflege nach den krankenanstaltenrechtlichen Bestimmungen sowie auch die Verpflichtung der Sozialversicherungsträger gegenüber den Anspruchsberechtigten auf Gewährung von Leistungen, insbesondere aus dem Versicherungsfall der Krankheit, nach den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen.
Im Ergebnis wird somit lediglich eine einzelne Aufgabe, nämlich die Verordnungserlassung, an einen beliehenen Rechtsträger übertragen. Es werden jedoch nicht die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung überschritten.
Zu den Bedenken des Eingriffes in die Landes-Organisationskompetenz (Punkt 1.7.)
Zur Frage, ob der Bundesgesetzgeber dem Landesgesetzgeber die Betrauung eines ausgegliederten Rechtsträgers mit Aufgaben der Landesvollziehung nach Art12 B‑VG vorschreiben darf, ist zu bemerken, dass materienspezifische Organisationsvorgaben in den Angelegenheiten der Heil- und Pflegeanstalten von der Materienkompetenz (Grundsatzgesetzgebung) als mitumfasst angesehen werden können (siehe Baumgartner, Die Verbindlicherklärung von Strukturplänen durch die Gesundheitsplanungs GmbH, ZfV 2018/22)."
8. Die Oberösterreichische Landesregierung und die Salzburger Landesregierung haben jeweils auf eine Äußerung verzichtet. Die Landesregierungen von Burgenland, Kärnten, Steiermark, Tirol und Vorarlberg, die im Verfahren ebenfalls zur Stellungnahme eingeladen wurden, haben keine Äußerungen erstattet.
9. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger, die Österreichische Zahnärztekammer und zwei weitere, in bestimmten Anlassverfahren beteiligte Parteien haben jeweils eine Äußerung erstattet.
II. Rechtslage
Die maßgebliche Rechtslage stellt sich wie folgt dar:
1. Art4 und 5 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl I 98/2017, lauten wie folgt:
"2. Abschnitt
Planung und Gesundheitstelematik
Art4
Grundsätze der Planung
(1) Die integrative Planung der österreichischen Gesundheitsversorgungsstruktur hat den von der Zielsteuerung-Gesundheit vorgegebenen Anforderungen zu entsprechen und erfolgt auf Basis vorhandener Evidenzen und sektorenübergreifend. Sie umfasst alle Ebenen und Teilbereiche der Gesundheitsversorgung und Nahtstellen zu angrenzenden Bereichen. Bestandteil dieser Vereinbarung ist es, die Realisierung einer integrativen Planung insbesondere für die folgenden Versorgungsbereiche sicherzustellen:
1. Ambulanter Bereich der Sachleistung, d.h. niedergelassene ÄrztInnen und ZahnärztInnen mit Kassenverträgen, Gruppenpraxen mit Kassenverträgen und sonstige in der Gesundheitsversorgung frei praktizierende Berufsgruppen mit Kassenverträgen, selbstständige Ambulatorien mit Kassenverträgen einschließlich der eigenen Einrichtungen der Versicherungsträger, Spitalsambulanzen;
2. Akutstationärer Bereich und tagesklinischer Bereich (d.h. landesgesundheitsfondsfinanzierte Krankenanstalten und Unfallkrankenhäuser), sofern dieser aus Mitteln der Gebietskörperschaften und/oder der Sozialversicherung zur Gänze oder teilweise finanziert wird;
3. Ambulanter und stationärer Rehabilitationsbereich mit besonderer Berücksichtigung des bedarfsgerechten Auf- und Ausbaus von Rehabilitationsangeboten für Kinder und Jugendliche;
(2) Als Rahmenbedingungen bei der integrativen Versorgungsplanung sind mit zu berücksichtigen:
1. Versorgungswirksamkeit von WahlärztInnen, WahltherapeutInnen, Sanatorien und sonstigen Wahleinrichtungen, sofern von diesen sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbracht werden
2. Sozialbereich, soweit dieser im Rahmen des Nahtstellenmanagements und hinsichtlich komplementärer Versorgungsstrukturen (im Sinne 'kommunizierender Gefäße') für die Gesundheitsversorgung von Bedeutung ist (z. B. psychosozialer Bereich, Pflegebereich);
3. Rettungs- und Krankentransportwesen (inkl. präklinischer Notfallversorgung) im Sinne bodengebundener Rettungsmittel und Luftrettungsmittel (inkl. und exkl. der notärztlichen Komponente) sowie Krankentransportdienst.
(3) Die integrative Versorgungsplanung hat die Beziehungen zwischen allen in Abs1 und 2 genannten Versorgungsbereichen zu berücksichtigen. Im Sinne von gesamtwirtschaftlicher Effektivität und Effizienz der Gesundheitsversorgung berücksichtigen Teilbereichsplanungen die Wechselwirkung zwischen den Teilbereichen dahingehend, dass die gesamtökonomischen Aspekte vor den ökonomischen Aspekten des Teilbereiches ausschlaggebend sind.
(4) Die integrative Versorgungsplanung hat patientenorientiert zu erfolgen. Die Versorgungsqualität ist durch das Verschränken der Gesundheitsstrukturplanung mit einzuhaltenden Qualitätskriterien im Sinne der Bestimmungen gemäß Art8 sicherzustellen.
(5) Die integrative Versorgungsplanung verfolgt insbesondere das Ziel einer schrittweisen Verlagerung der Versorgungsleistungen von der akutstationären hin zu tagesklinischer und ambulanter Leistungserbringung im Sinne der Leistungserbringung am jeweiligen 'Best Point of Service' unter Sicherstellung hochwertiger Qualität.
(6) Eine möglichst rasche und lückenlose Behandlungskette ist durch verbessertes Nahtstellenmanagement und den nahtlosen Übergang zwischen den Einrichtungen bzw den Bereichen, ua durch gesicherten Informationstransfer mittels effektiven und effizienten Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien, sicherzustellen.
(7) Die integrative Versorgungsplanung setzt entsprechend den Prinzipien der Zielsteuerung-Gesundheit insbesondere folgende Prioritäten:
1. Reorganisation aller in Abs1 angeführten Bereiche in Richtung eines effektiveren und effizienteren Ressourceneinsatzes.
2. Stärkung des ambulanten Bereichs insbesondere durch rasche flächendeckende Entwicklung von Primärversorgungsstrukturen und ambulanten Fachversorgungsstrukturen.
3. Weiterentwicklung des akutstationären und tagesklinischen Bereichs, insbesondere durch Bündelung komplexer Leistungen an geeigneten Standorten, die Überwindung von kleinteiligen Organisationsformen sowie die Weiterentwicklung einzelner Krankenanstalten zu Einrichtungen für eine Grund- und Fachversorgung.
4. Ausbau einer österreichweit gleichwertigen, flächendeckenden abgestuften Versorgung im Palliativ- und Hospizbereich für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche; im Rahmen der Umsetzung integrierter Palliativ- und Hospizversorgung erfolgt eine Abstimmung zwischen Gesundheits- und Sozialbereich sowie der Sozialversicherung.
5. Gemeinsame überregionale und sektorenübergreifende Planung der für die vorgesehenen Versorgungsstrukturen und ‑prozesse erforderlichen Personalressourcen unter optimaler Nutzung der Kompetenzen der jeweiligen Berufsgruppen.
6. Sicherstellung einer nachhaltigen Sachleistungsversorgung.
(8) Die Vertragsparteien kommen überein, die für die integrative Versorgungsplanung notwendigen Datengrundlagen (inkl. bundesweit einheitlicher Datengrundlagen für alle Gesundheitsberufe) in ausreichender Qualität entsprechend Art10 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG Zielsteuerung-Gesundheit zur Verfügung zu stellen. Gemäß Art15 Abs4 ist die Implementierung einer flächendeckenden verpflichtenden Dokumentation von Diagnosen in codierter Form im ambulanten Bereich auf Basis von ICD‑10 bzw im Bereich der Primärversorgung alternativ auch auf Basis von ICPC‑2 vorgesehen.
Art5
Österreichischer Strukturplan Gesundheit und Regionale Strukturpläne
Gesundheit
(1) Die zentralen Planungsinstrumente für die integrative Versorgungsplanung sind der Österreichische Strukturplan Gesundheit (ÖSG) und die Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG). Der ÖSG ist der österreichweit verbindliche Rahmenplan für die in den RSG vorzunehmende konkrete Gesundheitsstrukturplanung und Leistungsangebotsplanung. ÖSG und RSG sind integrale Bestandteile der Zielsteuerung-Gesundheit und mit den Zielen und Maßnahmen der Gesundheitsreform abgestimmt.
(2) Der ÖSG umfasst verbindliche Vorgaben für RSG im Hinblick auf die in Art4 Abs1 angeführten Bereiche, verfolgt die Zielsetzungen gemäß Art4 Abs3 bis 7, legt die Kriterien für die Gewährleistung der bundesweit einheitlichen Versorgungsqualität fest und stellt damit eine Grundlage für die Abrechenbarkeit von Leistungen der Gesundheitsversorgung dar.
(3) Die Inhalte des ÖSG umfassen insbesondere:
1. Informationen zur aktuellen regionalen Versorgungssituation;
2. Grundsätze und Ziele der integrativen Versorgungsplanung;
3. Quantitative und qualitative Planungsvorgaben und ‑grundlagen für die bedarfsgerechte Dimensionierung der Versorgungskapazitäten bzw der Leistungsvolumina;
4. Versorgungsmodelle für die abgestufte bzw modulare Versorgung in ausgewählten Versorgungsbereichen sowie inhaltliche Vorgaben für Organisationsformen und Betriebsformen;
5. Vorgaben von verbindlichen Mindestfallzahlen für ausgewählte medizinische Leistungen zur Sicherung der Behandlungsqualität sowie Mindestfallzahlen als Orientierungswerte für die Leistungsangebotsplanung;
6. Kriterien zur Strukturqualität und Prozessqualität sowie zum sektorenübergreifenden Prozessmanagement als integrale Bestandteile der Planungsaussagen;
7. Grundlagen für die Festlegung von Versorgungsaufträgen für die ambulante und stationäre Akutversorgung unabhängig von einer Zuordnung auf konkrete Anbieterstrukturen: Leistungsmatrizen, Aufgabenprofile und Qualitätskriterien;
8. Kriterien für die Bedarfsfeststellung und die Planung von Angeboten für multiprofessionelle und interdisziplinäre Primärversorgung sowie für die multiprofessionelle und/oder interdisziplinäre ambulante Fachversorgung gemäß Art6.
9. Verbindliche überregionale Versorgungsplanung für hochspezialisierte komplexe Leistungen von überregionaler Bedeutung in Form von Bedarfszahlen zu Kapazitäten sowie der Festlegung von Leistungsstandorten und deren jeweiliger Zuständigkeit für zugeordnete Versorgungsregionen.
10. Festlegung der von der Planung zu erfassenden, der öffentlichen Versorgung dienenden medizinisch-technischen Großgeräte inkl. österreichweiter Planungsgrundlagen, Planungsrichtwerte (insbesondere auch hinsichtlich der von diesen Großgeräten zu erbringenden Leistungen bzw deren Leistungsspektrum sowie deren Verfügbarkeit) und Qualitätskriterien; Festlegung der bundesweit sowie je Bundesland jeweils erforderlichen Anzahl der Großgeräte (Bandbreiten).
11. Standort- und Kapazitätsplanung von Großgeräten mit überregionaler Bedeutung (insbesondere Strahlentherapiegeräte, Coronarangiographie-Anlagen und Positronen‑Emissions-Tomographiegeräte) ist auf Bundesebene zu vereinbaren; weiters die standortbezogene und mit den Versorgungsaufträgen auf regionaler Ebene abgestimmte Planung der übrigen medizinisch-technischen Großgeräte;
12. Vorgaben für Aufbau, Inhalte, Struktur, Planungsmethoden, Darstellungsform und Planungshorizont der RSG in bundesweit einheitlicher Form.
(4) Der ÖSG ist während der Laufzeit dieser Vereinbarung von der Bundesgesundheitsagentur nach den Vorgaben der Zielsteuerung-Gesundheit kontinuierlich gesamthaft weiterzuentwickeln. Ergänzungen und Weiterentwicklungen des ÖSG erfolgen gemeinsam zwischen Bund, Bundesländern und Sozialversicherung nach partnerschaftlich festgelegten Prioritäten gemäß Art4 Abs7. Der Schwerpunkt der Ergänzungen liegt entsprechend der Zielsteuerung-Gesundheit im ambulanten Bereich. Es werden jedenfalls folgende Entwicklungsschritte vereinbart:
1. Aktualisierung von Ist‑Stand und Bedarfsprognosen
2. jährliche Wartung und Weiterentwicklung der Leistungsmatrizen für den ambulanten und den akutstationären Bereich und sukzessive Festlegung weiterer verbindlicher Mindestfallzahlen für medizinische Leistungen bzw Leistungsbündel entsprechend international vorhandener Evidenz;
3. Weiterentwicklung der Planungsgrundlagen und Qualitätskriterien für alle Bereiche, insbesondere für interdisziplinäre und multiprofessionelle Versorgungsformen;
4. Weiterentwicklung der überregionalen Versorgungsplanung auf Basis einer entsprechenden Beobachtung und bei Bedarf Ergänzung weiterer Versorgungsbereiche;
5. Planung der ambulanten Rehabilitation der Phase III, die zur Stabilisierung der Erfolge aus der ambulanten Rehabilitation der Phase II oder auch der stationären Rehabilitation der Phase II dienen soll, muss bestehende integrierte Versorgungsstrukturen (insbesondere Primärversorgung), fachärztliche Versorgung und die vorhandenen Evidenzen berücksichtigen;
6. Präzisierung der notwendigen Schritte zur Berücksichtigung der präklinischen Versorgung inkl. Rettungs- und Krankentransportdienst in der Planung;
7. Weiterentwicklung von morbiditätsbasierten Methoden der Bedarfsschätzung in der Gesundheitsversorgung und pilothafte Anwendung (Versorgungsforschung);
(5) Revisionen der ÖSG‑Inhalte werden auf der jeweils aktuellen Datenbasis grundsätzlich im Abstand von maximal fünf Jahren vorgenommen. Die notwendige Wartung einzelner Teile des ÖSG sowie Ergänzungen haben bei Bedarf während der Laufzeit dieser Vereinbarung zeitnah zu erfolgen.
(6) Der ÖSG sowie Revisionen, Wartungen und Ergänzungen des ÖSG sind gemäß Abs9 Z1 zu veröffentlichen.
(7) Die Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG) sind je Bundesland entsprechend den Vorgaben des ÖSG gemäß Abs3 Z12 bezüglich Inhalten, Planungshorizonten und Planungsrichtwerten kontinuierlich weiter zu entwickeln und regelmäßig zu revidieren. Die Qualitätskriterien des ÖSG gelten bundesweit einheitlich. Die Schwerpunkte der RSG sind jedenfalls:
1. Festlegung der Kapazitätsplanungen standortbezogen für den akutstationären Bereich mit Angabe der Kapazitäten, Organisationsformen, Versorgungsstufen, Referenz‑, Spezial- und Expertisezentren je Fachbereich;
2. Festlegung der Kapazitätsplanungen für die ambulante Fachversorgung – soweit noch nicht vorliegend – gesamthaft bis Ende 2018 unter der Voraussetzung, dass die Grundlagen auf Bundesebene vorliegen mit Angabe der Kapazitäten und Betriebsformen von Spitalsambulanzen sowie Versorgungstypen im ambulanten Bereich sowie Versorgungsaufträgen nach Fachbereichen auf Ebene der Versorgungsregionen (im Sinne des ÖSG) bzw bei Bedarf auch auf tieferen regionalen Ebenen;
3. Stärkung der Primärversorgung durch Ausbau von wohnortnahen multiprofessionellen und/oder interdisziplinären Versorgungsangeboten entsprechend Art6 und Bereinigung von Parallelstrukturen im Sinne des Art4 Abs5 und Art4 Abs7 Z3; Ergänzung einer konkretisierten Planung zur Einrichtung von Primärversorgungseinheiten bis spätestens Ende 2018 unter der Voraussetzung, dass die Grundlagen auf Bundesebene vorliegen;
4. Abbildung der überregionalen Versorgungsplanung gemäß Abs3 Z9 inkl. Definition von Versorgungsgebieten je Standort;
5. Transparente Berücksichtigung der Versorgung inländischer und ausländischer GastpatientInnen;
(8) Die RSG sind auf Landesebene zwischen dem jeweiligen Land und der Sozialversicherung festzulegen. Der Bund ist bereits im Entwurfsstadium eines RSG entsprechend zu informieren und es ist mit dem Bund vor Einbringung zur Beschlussfassung insbesondere das Vorliegen der Rechts- und ÖSG‑Konformität abzustimmen. Die jeweils aktuelle Fassung des RSG ist in geeigneter Weise kundzumachen und auf der Website des jeweiligen Landes zu veröffentlichen.
(9) Bund und Länder kommen überein, zur Verbindlichkeit der Planung im ÖSG Folgendes sicherzustellen:
1. Der ÖSG und seine Änderungen sind von der/dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerin/Bundesminister nach einvernehmlicher Beschlussfassung in der Bundes‑Zielsteuerungskommission jedenfalls im Bundesgesetzblatt II gemäß §4 Abs2 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 2004, BGBl I Nr 100/2003, in der jeweils geltenden Fassung, sowie auf der Website des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministeriums unbeschadet Z2 als Sachverständigengutachten zu veröffentlichen.
2. Die Bundesgesundheitsagentur ist bundes- und landesgesetzlich zu ermächtigen sowie organisatorisch in die Lage zu versetzen, die einvernehmlich zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung als normativ gekennzeichneten Teile des ÖSG als verbindlich festzulegen und durch Verordnung kundzumachen. Der Beginn der verbindlichen Wirkung ist durch die Bundes‑Zielsteuerungskommission festzulegen, wobei entsprechende Umsetzungsfristen zu berücksichtigen sind.
(10) Bund und Länder kommen überein, zur Verbindlichkeit der Planung im RSG Folgendes sicherzustellen:
1. Der RSG und seine Änderungen sind vom jeweiligen Landeshauptmann nach einvernehmlicher Beschlussfassung in der Landes‑Zielsteuerungskommission jedenfalls im Landesgesetzblatt sowie auf der Website der jeweiligen Landesregierung zu veröffentlichen.
2. Der Landesgesundheitsfonds ist bundes- und landesgesetzlich zu ermächtigen sowie organisatorisch in die Lage zu versetzen, die einvernehmlich zwischen Ländern und Sozialversicherung als normativ gekennzeichneten Teile des RSG als verbindlich festzulegen und durch Verordnung kundzumachen. Der Beginn der verbindlichen Wirkung ist durch die Landes‑Zielsteuerungskommission festzulegen, wobei entsprechende Umsetzungsfristen zu berücksichtigen sind. Diese Verordnung hat hinsichtlich der Vorgaben jenes Maß an Konkretheit aufzuweisen, das erforderlich ist, um den Bedarf an einer konkreten Versorgungseinrichtung ausschließlich und abschließend anhand dieser Verordnung beurteilen zu können.
3. Der jeweiligen Landesärztekammer und den betroffenen gesetzlichen Interessensvertretungen ist mindestens vier Wochen vor Beschlussfassung des RSG in der jeweiligen Landes‑Zielsteuerungskommission die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen; der Ärztekammer insbesondere hinsichtlich der Umsetzbarkeit im Stellenplan (§342 Abs1 Z1 ASVG). Dazu sind die für die Beschlussfassung vorgesehenen Planungsunterlagen zu übermitteln.
(11) Soweit krankenanstaltenrechtliche oder ärzterechtliche Bedarfsprüfungen durchzuführen sind, sind die durch Verordnungen gemäß Abs9 und 10 verbindlichen Inhalte des RSG als verbindliche Grundlage anzuwenden. Im Fall von erforderlichen Bedarfsprüfungen in Bezug auf Versorgungsstrukturen, die nicht im RSG enthalten sind, sind die im ÖSG und RSG festgelegten Planungskriterien anzuwenden. Die Bundesgesetzgebung bzw die Landesgesetzgebung hat vorzusehen, dass die verbindlichen Inhalte des ÖSG und des jeweiligen RSG in ihren Bereichen als verbindlicher rechtlicher Rahmen für die bundes- und landesgesetzlich eingerichteten Körperschaften umzusetzen sind.
(12) Kommt in der Landes‑Zielsteuerungskommission kein Einvernehmen über den verbindlichen Teil des RSG bzw dessen Änderung zustande, bleiben die Planungskompetenzen des jeweiligen Landes bzw der Sozialversicherung unberührt.
(13) Im Einklang mit dem ÖSG und den RSG sind die den GesundheitsdiensteanbieterInnen erteilten bzw bestehenden Bewilligungen unter größtmöglicher Schonung wohlerworbener Rechte zu ändern oder allenfalls zurückzunehmen. Die entsprechenden bundes- und landesgesetzlichen Regelungen haben dies zu ermöglichen.
(14) Die Abrechenbarkeit von Leistungen über die Landesgesundheitsfonds bzw über die Krankenversicherungsträger ist an die Einhaltung der verpflichtenden qualitativen Inhalte in ÖSG und RSG durch die GesundheitsdiensteanbieterInnen zu binden und entsprechend gesetzlich festzulegen. Eine allfällige Bereitstellung von Investitionszuschüssen an die GesundheitsdiensteanbieterInnen hat im Einklang mit dem ÖSG und den RSG zu erfolgen.
(15) Die Festlegungen im ÖSG und in den RSG sind hinsichtlich ihrer Umsetzung laufend zu überprüfen (ÖSG‑Monitoring und österreichweit vergleichendes RSG‑Monitoring). Dieses Monitoring ist inhaltlich so zu gestalten, dass es eine entsprechende Grundlage für das Monitoring im Rahmen der Zielsteuerung-Gesundheit bereitstellen kann."
2. Die §§1, 18 bis 30 und §41 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz – G‑ZG), BGBl I 26/2017, idF BGBl I 100/2018 (§§21, 23 Abs3 sowie 29) und BGBl I 9/2022 (§41) lauten (die in Prüfung gezogenen Bestimmungen sind hervorgehoben):
"1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen
Gegenstand
§1. (1) Der Bund und die gesetzliche Krankenversicherung haben nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen gemeinsam mit den Ländern, im Rahmen derer kompetenzrechtlichen Zuständigkeiten, die integrative partnerschaftliche Zielsteuerung-Gesundheit für die Struktur und Organisation der österreichischen Gesundheitsversorgung fortzuführen und weiterzuentwickeln. Dieses Bundesgesetz berührt nicht die Zuständigkeiten der Länder zur Gesetzgebung und Vollziehung.
(2) Die Konkretisierung dieser Zielsteuerung-Gesundheit hat auf Grundlage vergleichbarer wirkungsorientierter qualitativ und quantitativ festzulegender
1. Versorgungsziele,
2. Planungswerte,
3. Versorgungsprozesse und -strukturen und
4. Ergebnis- und Qualitätsparameter
zu erfolgen. Darauf aufbauend ist als integraler Bestandteil die bereits etablierte
5. Finanzzielsteuerung
fortzuführen und weiterzuentwickeln.
(3) Die Durchführung der partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit hat durch die Weiterentwicklung von Organisation und Steuerungsmechanismen auf Bundes- und Landesebene das Prinzip der Wirkungsorientierung in der Gesundheitsversorgung zu gewährleisten."
"6. Abschnitt
Planung der österreichischen Gesundheitsversorgungsstruktur
Grundsätze der Planung
§18. (1) Die integrative Planung der österreichischen Gesundheitsversorgungsstruktur hat den von der Zielsteuerung-Gesundheit vorgegebenen Anforderungen zu entsprechen sowie auf Basis vorhandener Evidenzen und sektorenübergreifend zu erfolgen. Sie umfasst alle Ebenen und Teilbereiche der Gesundheitsversorgung und Nahtstellen zu angrenzenden Bereichen. Die integrative Planung hat insbesondere die folgenden Versorgungsbereiche zu umfassen:
1. Ambulanter Bereich der Sachleistung, d.h. niedergelassene Ärztinnen/Ärzte und Zahnärztinnen/‑ärzte mit Kassenverträgen, Gruppenpraxen mit Kassenverträgen und sonstige in der Gesundheitsversorgung frei praktizierende Berufsgruppen mit Kassenverträgen, selbstständige Ambulatorien mit Kassenverträgen einschließlich der eigenen Einrichtungen der Versicherungsträger, Spitalsambulanzen;
2. akutstationärer Bereich und tagesklinischer Bereich (d.h. landesgesundheitsfondsfinanzierte Krankenanstalten und Unfallkrankenhäuser), sofern dieser aus Mitteln der Gebietskörperschaften und/oder der Sozialversicherung zur Gänze oder teilweise finanziert wird;
3. ambulanter und stationärer Rehabilitationsbereich mit besonderer Berücksichtigung des bedarfsgerechten Auf- und Ausbaus von Rehabilitationsangeboten für Kinder und Jugendliche.
(2) Als Rahmenbedingungen bei der integrativen Versorgungsplanung sind mit zu berücksichtigen:
1. Die Versorgungswirksamkeit von WahlärztInnen, WahltherapeutInnen, Sanatorien und sonstigen Wahleinrichtungen, sofern von diesen sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbracht werden;
2. der Sozialbereich, soweit dieser im Rahmen des Nahtstellenmanagements und hinsichtlich komplementärer Versorgungsstrukturen (im Sinne 'kommunizierender Gefäße') für die Gesundheitsversorgung von Bedeutung ist (z. B. psychosozialer Bereich, Pflegebereich);
3. das Rettungs- und Krankentransportwesen (inklusive präklinischer Notfallversorgung) im Sinne bodengebundener Rettungsmittel und Luftrettungsmittel (sowohl inklusive als auch exklusive der notärztlichen Komponente) sowie der Krankentransportdienst.
(3) Die integrative Versorgungsplanung hat die Beziehungen zwischen allen in Abs1 und 2 genannten Versorgungsbereichen zu berücksichtigen. Im Sinne von gesamtwirtschaftlicher Effektivität und Effizienz der Gesundheitsversorgung haben Teilbereichsplanungen die Wechselwirkung zwischen den Teilbereichen dahingehend zu berücksichtigen, dass die gesamtökonomischen Aspekte vor den ökonomischen Aspekten des Teilbereiches ausschlaggebend sind.
(4) Die integrative Versorgungsplanung hat patientenorientiert zu erfolgen. Die Versorgungsqualität ist durch das Verschränken der Gesundheitsstrukturplanung mit einzuhaltenden Qualitätskriterien sicherzustellen.
(5) Die integrative Versorgungsplanung hat insbesondere das Ziel einer schrittweisen Verlagerung der Versorgungsleistungen von der akutstationären hin zu tagesklinischer und ambulanter Leistungserbringung im Sinne der Leistungserbringung am jeweiligen 'Best Point of Service' unter Sicherstellung hochwertiger Qualität zu verfolgen.
(6) Eine möglichst rasche und lückenlose Behandlungskette ist durch verbessertes Nahtstellenmanagement und den nahtlosen Übergang zwischen den Einrichtungen bzw den Bereichen, ua durch gesicherten Informationstransfer mittels effektiven und effizienten Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien, sicherzustellen.
(7) Die integrative Versorgungsplanung hat entsprechend den Prinzipien der Zielsteuerung-Gesundheit insbesondere folgende Prioritäten zu setzen:
1. Reorganisation aller in Abs1 angeführten Bereiche in Richtung eines effektiveren und effizienteren Ressourceneinsatzes.
2. Stärkung des ambulanten Bereichs insbesondere durch rasche flächendeckende Entwicklung von Primärversorgungsstrukturen und ambulanten Fachversorgungsstrukturen, wobei in der Umsetzung vor allem bestehende Vertragspartner berücksichtigt werden.
3. Weiterentwicklung des akutstationären und tagesklinischen Bereichs: insbesondere durch Bündelung komplexer Leistungen an geeigneten Standorten, die Überwindung von kleinteiligen Organisationsformen.
4. Ausbau einer österreichweit gleichwertigen, flächendeckenden abgestuften Versorgung im Palliativ- und Hospizbereich für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche; im Rahmen der Umsetzung integrierter Palliativ- und Hospizversorgung hat eine Abstimmung zwischen Gesundheits- und Sozialbereich sowie der Sozialversicherung zu erfolgen.
5. Gemeinsame überregionale und sektorenübergreifende Planung der für die vorgesehenen Versorgungsstrukturen und ‑prozesse erforderlichen Personalressourcen unter optimaler Nutzung der Kompetenzen der jeweiligen Berufsgruppen.
6. Sicherstellung einer nachhaltigen Sachleistungsversorgung.
Österreichischer Strukturplan Gesundheit und Regionale Strukturpläne
Gesundheit
§19. (1) Die zentralen Planungsinstrumente für die integrative Versorgungsplanung sind der Österreichische Strukturplan Gesundheit (ÖSG) und die Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG). Der ÖSG ist gemäß der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens der österreichweit verbindliche Rahmenplan für die in den RSG vorzunehmende konkrete Gesundheitsstrukturplanung und Leistungsangebotsplanung.
(2) Der ÖSG hat verbindliche Vorgaben für RSG im Hinblick auf die in §18 Abs1 angeführten Bereiche zu umfassen, die Zielsetzungen gemäß §18 Abs3 bis 7 zu verfolgen, die Kriterien für die Gewährleistung der bundesweit einheitlichen Versorgungsqualität festzulegen.
Inhalte des ÖSG
§20. (1) Der ÖSG hat insbesondere folgende Inhalte zu umfassen:
1. Informationen zur aktuellen regionalen Versorgungssituation;
2. Grundsätze und Ziele der integrativen Versorgungsplanung;
3. Quantitative und qualitative Planungsvorgaben und ‑grundlagen für die bedarfsgerechte Dimensionierung der Versorgungskapazitäten bzw der Leistungsvolumina;
4. Versorgungsmodelle für die abgestufte bzw modulare Versorgung in ausgewählten Versorgungsbereichen sowie inhaltliche Vorgaben für Organisationsformen und Betriebsformen;
5. Vorgaben von verbindlichen Mindestfallzahlen für ausgewählte medizinische Leistungen zur Sicherung der Behandlungsqualität sowie Mindestfallzahlen als Orientierungswerte für die Leistungsangebotsplanung;
6. Kriterien zur Strukturqualität und Prozessqualität sowie zum sektorenübergreifenden Prozessmanagement als integrale Bestandteile der Planungsaussagen;
7. Grundlagen für die Festlegung von Versorgungsaufträgen für die ambulante und stationäre Akutversorgung unabhängig von einer Zuordnung auf konkrete Anbieterstrukturen: Leistungsmatrizen, Aufgabenprofile und Qualitätskriterien;
8. Kriterien für die Bedarfsfeststellung und die Planung von Angeboten für multiprofessionelle und interdisziplinäre Primärversorgung sowie für die multiprofessionelle und/oder interdisziplinäre ambulante Fachversorgung gemäß Art6 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens;
9. Verbindliche überregionale Versorgungsplanung für hochspezialisierte komplexe Leistungen von überregionaler Bedeutung in Form von Bedarfszahlen zu Kapazitäten sowie der Festlegung von Leistungsstandorten und deren jeweiliger Zuständigkeit für zugeordnete Versorgungsregionen;
10. Festlegung der von der Planung zu erfassenden, der öffentlichen Versorgung dienenden medizinisch-technischen Großgeräte inklusive österreichweiter Planungsgrundlagen, Planungsrichtwerte (insbesondere auch hinsichtlich der von diesen Großgeräten zu erbringenden Leistungen bzw deren Leistungsspektrum sowie deren Verfügbarkeit) und Qualitätskriterien; Festlegung der bundesweit sowie je Bundesland jeweils erforderlichen Anzahl der Großgeräte (Bandbreiten);
11. Standort- und Kapazitätsplanung von Großgeräten mit überregionaler Bedeutung (insbesondere Strahlentherapiegeräte, Coronarangiographie-Anlagen und Positronen‑Emissions-Tomographiegeräte) ist auf Bundesebene zu vereinbaren; weiters die standortbezogene und mit den Versorgungsaufträgen auf regionaler Ebene abgestimmte Planung der übrigen medizinisch-technischen Großgeräte;
12. Vorgaben für Aufbau, Inhalte, Struktur, Planungsmethoden, Darstellungsform und Planungshorizont der RSG in bundesweit einheitlicher Form.
(2) Die Qualitätskriterien des ÖSG gelten gemäß der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens bundesweit einheitlich.
(3) Der ÖSG ist auf Bundesebene zwischen dem Bund, den Ländern und der Sozialversicherung einvernehmlich abzustimmen.
(4) In der Bundes‑Zielsteuerungskommission ist sicherzustellen, dass der Österreichischen Ärztekammer und den betroffenen gesetzlichen Interessensvertretungen frühzeitig und strukturiert, mindestens aber vier Wochen vor Beschlussfassung des ÖSG in der Bundes‑Zielsteuerungskommission die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt wird. Dazu sind die für die Beschlussfassung vorgesehenen Planungsunterlagen zu übermitteln.
Inhalte des RSG
§21. (1) Die Sozialversicherungsträger haben sicherzustellen, dass die RSG gemeinsam mit den Ländern entsprechend den Vorgaben des ÖSG bezüglich Inhalten, Planungshorizonten und Planungsrichtwerten kontinuierlich weiterentwickelt und regelmäßig revidiert werden.
(2) (Grundsatzbestimmung) Die Landesgesetzgebung hat in Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG sicherzustellen, dass die RSG in der Landes‑Zielsteuerungskommission entsprechend den Vorgaben des ÖSG bezüglich Inhalten, Planungshorizonten und Planungsrichtwerten kontinuierlich weiterentwickelt und regelmäßig revidiert werden.
(3) Die Sozialversicherungsträger haben sicherzustellen, dass der RSG jedenfalls Folgendes beinhaltet:
1. Festlegung der Kapazitätsplanungen standortbezogen für den akutstationären Bereich mit Angabe der Kapazitäten, Organisationsformen, Versorgungsstufen, Referenz‑, Spezial- und Expertisezentren je Fachbereich (im Sinne des ÖSG);
2. Festlegung der Kapazitätsplanungen für die ambulante Versorgung für die Leistungserbringer im Sinne des §18 Abs1 Z1 – soweit noch nicht vorliegend – gesamthaft mit Angabe der Kapazitäten und Betriebsformen von Spitalsambulanzen sowie Versorgungstypen im ambulanten Bereich sowie Versorgungsaufträgen nach Fachbereichen auf Ebene der Versorgungsregionen (im Sinne des ÖSG);
3. Stärkung der Primärversorgung durch Ausbau von wohnortnahen, multiprofessionellen und/oder interdisziplinären Versorgungsangeboten entsprechend Art6 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens sowie §18 Abs7 Z2 und Bereinigung von Parallelstrukturen; beim Ausbau der Primärversorgung nach dem Primärversorgungsgesetz, BGBl I Nr 131/2017 (PrimVG) ist, um den unterschiedlichen Versorgungsbedürfnissen der Bevölkerung nachkommen zu können, im Hinblick auf das im Art31 Abs1 letzter Satz der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens genannte Planungsziel im jeweiligen Bundesland ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Versorgungsangeboten als Netzwerk oder Zentrum sicherzustellen;
4. Abbildung der überregionalen Versorgungsplanung gemäß §20 Abs1 Z9 inklusive Definition von Versorgungsgebieten je Standort;
5. Transparente Berücksichtigung der Versorgung inländischer und ausländischer Gastpatientinnen und ‑patienten.
Dabei ist auf die Bestimmungen in Abs3 und 5 des Art6 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens sowie in §3 Abs2, 2b und 2c und §3a Abs2 und 3 KAKuG Bedacht zu nehmen.
(4) (Grundsatzbestimmung) Die Landesgesetzgebung hat in Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG sicherzustellen, dass der RSG jedenfalls die in Abs3 genannten Inhalte umfasst.
(5) Die Sozialversicherungsträger haben darauf zu achten, dass im Umsetzung des Art6 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens die Kapazitätsplanung für den gesamten ambulanten Bereich in den RSG insbesondere auf die Stärkung der ambulanten Versorgung durch Ausbau von wohnortnahen multiprofessionellen und/oder interdisziplinären Versorgungsangeboten und die Bereinigung von Parallelstrukturen abzielt.
(6) (Grundsatzbestimmung) Die Landesgesetzgebung hat in Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG sicherzustellen, dass bei der Kapazitätsplanung für den gesamten ambulanten Bereich die Vorgaben des Abs5 eingehalten werden.
(7) Die RSG sind gemäß der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens auf Landesebene zwischen dem jeweiligen Land und der Sozialversicherung festzulegen. Der Bund ist bereits im Entwurfsstadium eines RSG entsprechend zu informieren und es ist mit dem Bund vor Einbringung zur Beschlussfassung insbesondere das Vorliegen der Rechts- und ÖSG‑Konformität abzustimmen.
(8) Eine Primärversorgungseinheit im Sinne des §2 Abs4 des Primärversorgungsgesetzes gilt auch dann als im RSG abgebildet, wenn der Bedarf nach §20 Abs1 Z8 für die Errichtung einer solchen durch Beschluss der Landes‑Zielsteuerungskommission festgestellt wurde.
(9) Ergänzend zu Abs3 und 4 obliegt es bei Bedarf auch den gesetzlichen Berufsvertretungen der Gesundheitsdiensteanbieterinnen und ‑anbieter einen Vorschlag an das Land oder die Sozialversicherung auf Planung der Primärversorgung in einem bestimmten Einzugsgebiet und auf Beschlussfassung in der Landes‑Zielsteuerungskommission zu richten. Sofern nicht das jeweilige Land die jeweilige Landes‑Zielsteuerungskommission zeitnah mit einem solchen Vorschlag befasst, hat dies durch die jeweilige Landesstelle der Österreichischen Gesundheitskasse zu erfolgen.
(10) Die Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und der Sozialversicherung haben in der jeweiligen Landes‑Zielsteuerungskommission sicherzustellen, dass der jeweiligen Landesärztekammer und den betroffenen gesetzlichen Interessenvertretungen frühzeitig und strukturiert – mindestens aber vier Wochen vor Beschlussfassung einer den RSG betreffenden Angelegenheit in der jeweiligen Landes‑Zielsteuerungskommission – die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt wird, der Ärztekammer insbesondere hinsichtlich der Umsetzbarkeit im Stellenplan (§342 Abs1 Z1 ASVG). Dazu sind die für die Beschlussfassung vorgesehenen Planungsunterlagen zu übermitteln.
Kundmachung des ÖSG und der RSG
§22. (1) Die/Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin/Bundesminister hat die jeweils aktuelle Fassung des ÖSG jedenfalls im RIS (www.ris.bka.gv.at ) zu veröffentlichen.
(2) Der Landeshauptmann hat die jeweils aktuelle Fassung des RSG im RIS (www.ris.bka.gv.at ) zu veröffentlichen.
Verbindlichkeitserklärung von Inhalten des ÖSG und der RSG
§23. (1) Die Bundes‑Zielsteuerungskommission hat im Sinne des öffentlichen Interesses jene für die nachhaltige Versorgung der Bevölkerung unerlässlichen Teile des ÖSG, dazu zählen insbesondere definierte Planungsrichtwerte und ‑kriterien sowie die überregionale Versorgungsplanung, die eine rechtlich verbindliche Grundlage für Planungsentscheidungen des RSG bilden sollen, als solche auszuweisen. Die Verbindlichkeit wird durch eine Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH gemäß Abs3 hergestellt. Jene Teile, die Verbindlichkeit erlangen sollen, sind vorab von der Gesundheitsplanungs GmbH einem allgemeinen, als solches ausgewiesenen, Begutachtungsverfahren zu unterziehen. Ergeben sich nach der Begutachtung Änderungen ist eine nochmalige Beschlussfassung in der Bundes‑Zielsteuerungskommission herbeizuführen.
(2) Die Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und der Sozialversicherung haben in der jeweiligen Landes‑Zielsteuerungskommission sicherzustellen, dass jene Planungsvorgaben des RSG, die rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen, dazu zählen insbesondere Festlegungen zur Kapazitätsplanung im Sinne des §21 Abs3 sowie die überregionale Versorgungsplanung, als solche ausgewiesen werden. Die rechtliche Verbindlichkeit wird durch eine Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH gemäß Abs3 hergestellt. Die Planungsvorgaben sind jedenfalls so konkret festzulegen, dass sie für die Bedarfsprüfung herangezogen werden können. Jene Teile, die rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen, sind von der Gesundheitsplanungs GmbH vorab einem allgemeinen, als solches ausgewiesenen, Begutachtungsverfahren zu unterziehen. Ergeben sich nach der Begutachtung Änderungen ist eine nochmalige Beschlussfassung in der Landes‑Zielsteuerungskommission herbeizuführen.
(3) Die/Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin/Bundesminister hat eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Verbindlicherklärung von in der Bundes‑Zielsteuerungskommission oder den Landes‑Zielsteuerungskommissionen beschlossenen Planungen im Gesundheitsbereich zu gründen. Die Gesellschaft führt die Firma 'Gesundheitsplanungs GmbH'. Gesellschafter/innen der Gesundheitsplanungs GmbH sind der Bund, die Länder und der Dachverband der Sozialversicherungsträger, die jeweils einen Vertreter/eine Vertreterin in die Generalversammlung entsenden. Die Beschlussfassung in der Generalversammlung erfolgt einstimmig. Der Sitz der Gesellschaft ist Wien. Die Gesellschaft ist nicht gewinnorientiert. Die Geschäftsführung wird durch die Gesellschafter bestellt, wobei die Geschäftsführung aus einer Geschäftsführerin/einem Geschäftsführer und zwei Stellvertreterinnen/Stellvertretern besteht. Die Tätigkeit des/der Geschäftsführers/Geschäftsführerin und dessen/deren Stellvertreter/innen ist unentgeltlich. Die Stammeinlage wird vom Bund für die Gesellschafter entrichtet. Die Gesundheitsplanungs GmbH ist von allen Gebühren und Abgaben befreit. Voraussetzung für die Gründung der Gesellschaft ist, dass sich die künftigen Gesellschafter vertraglich dazu verpflichten, als Gesellschafter der Gesundheitsplanungs GmbH für die Dauer der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens anzugehören. Ein vorzeitiger Austritt oder eine Auflösung der GmbH ist ausgeschlossen.
(4) Die Gesundheitsplanungs GmbH erklärt die von der Bundes‑Zielsteuerungskommission nach Abs1 und den jeweiligen Landes‑Zielsteuerungskommissionen nach Abs2 ausgewiesenen Teile des ÖSG und der jeweiligen RSG – insoweit dies Angelegenheiten des Art10 B‑VG betrifft – durch Verordnung für verbindlich.
(5) (Grundsatzbestimmung) Insoweit die ausgewiesenen Teile des ÖSG und der jeweiligen RSG Angelegenheiten des Art12 B‑VG betreffen, ist durch die Landesgesetzgebung vorzusehen, dass die Gesundheitsplanungs GmbH diese Teile ebenfalls durch Verordnung für verbindlich erklärt.
(6) Die Gesundheitsplanungs GmbH hat die für verbindlich zu erklärenden Teile im Wege einer Verordnung zu erlassen und im RIS (www.ris.bka.gv.at ) kundzumachen.
(7) Die Tätigkeit der Gesellschaft unterliegt – insoweit Angelegenheiten des Art10 B‑VG berührt sind – der Aufsicht der/des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerin/Bundesministers. Die Gesellschaft ist bei der Besorgung der ihr diesbezüglich zukommenden Aufgaben an die Weisungen der/des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerin/Bundesministers gebunden und auf dessen/deren Verlangen zur jederzeitigen Information verpflichtet.
(8) (Grundsatzbestimmung) Durch die Landesgesetzgebung ist vorzusehen, dass die Tätigkeit der Gesellschaft – insoweit Angelegenheiten des Art12 B‑VG berührt sind – der Aufsicht und den Weisungen der jeweiligen Landesregierung unterliegt und auf deren Verlangen zur jederzeitigen Information verpflichtet ist.
Landeskrankenanstaltenpläne
§24. (Grundsatzbestimmung) Die Landesgesetzgebung hat vorzusehen, dass in Fällen, in denen kein Einvernehmen über die verbindlich zu erklärenden Teile des RSG bzw deren Änderungen entsprechend den Bestimmungen im §23 Abs2 in der Landes‑Zielsteuerungskommission zustande kommt, hinsichtlich der Erlassung eines Landeskrankenanstaltenplanes §10a KAKuG anzuwenden ist.
7. Abschnitt
Entscheidungsstrukturen und ‑organisation
Organisation der Bundesgesundheitsagentur (gemäß §56a des
Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten)
§25. (1) Organe in der Bundesgesundheitsagentur sind:
1. Bundes‑Zielsteuerungskommission
2. Ständiger Koordinierungsausschuss.
(2) Die Führung der Geschäfte der Bundesgesundheitsagentur obliegt dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerium.
(3) Bei der Erfüllung der Aufgaben hat die Bundesgesundheitsagentur darauf zu achten, dass eine qualitativ hochwertige, effektive und effiziente, allen frei zugängliche und gleichwertige Gesundheitsversorgung in Österreich insbesondere durch die Zielsteuerung-Gesundheit sichergestellt und die Finanzierbarkeit des österreichischen Gesundheitswesens unter Einhaltung der Vorgaben der Finanzzielsteuerung abgesichert wird.
Bundes‑Zielsteuerungskommission
§26. (1) Der Bundes‑Zielsteuerungskommission gehören vier Vertreterinnen/Vertreter des Bundes, vier Vertreterinnen/Vertreter der Sozialversicherung sowie neun Vertreterinnen/Vertreter der Länder an.
(2) Den Vorsitz in der Bundes‑Zielsteuerungskommission führt die/der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin/Bundesminister, die erste Vorsitzenden-Stellvertreterin/der erste Vorsitzenden-Stellvertreter wird von der Sozialversicherung und die zweite Vorsitzenden-Stellvertreterin/der zweite Vorsitzenden-Stellvertreter wird von den Ländern bestellt.
(3) Hinsichtlich der Beschlussfassung in der Bundes‑Zielsteuerungskommission gilt Folgendes:
1. Für die Beschlussfassungen in allen Angelegenheiten ausgenommen Z2 ist ein Einvernehmen zwischen der Kurie des Bundes, der Kurie der Länder und der Kurie der Sozialversicherung erforderlich, wobei die Kurien jeweils eine Stimme haben.
2. Beschlussfassungen in den Angelegenheiten gemäß Abs4 Z2 lita sowie Abs4 Z2 litb, sofern es sich um Mittel gemäß §§59d und 59f KAKuG handelt, erfolgen mit Bundesmehrheit; in diesen Fällen verfügt die Kurie des Bundes über vier Stimmen.
(4) In der Bundes‑Zielsteuerungskommission erfolgen zu nachstehenden Punkten Festlegungen (Beschlüsse):
1. In den Angelegenheiten der Zielsteuerung-Gesundheit
a) Beratung über den Entwurf für den Zielsteuerungsvertrag gemäß §10,
b) Koordination, Abstimmungen und Festlegungen aller aus dem Zielsteuerungsvertrag inklusive Finanzzielsteuerung resultierenden Aufgaben,
c) Jahresarbeitsprogramme für Maßnahmen auf Bundesebene zur konkreten Umsetzung des Zielsteuerungsvertrags,
d) Monitoring und Berichtswesen gemäß dem achten Abschnitt einschließlich des Finanzzielsteuerungsmonitorings,
e) Wahrnehmung von Agenden zum Sanktionsmechanismus gemäß dem neunten Abschnitt,
f) Rahmenregelungen für vertragliche und gemeinsam von Sozialversicherung und Ländern zu verantwortende sektorenübergreifende Finanzierungs- und Verrechnungsmechanismen auf Landesebene; Erarbeitung, Erprobung von Abrechnungsmodellen für eine sektorenübergreifende Finanzierung des ambulanten Bereichs,
g) (Weiter‑)Entwicklung von Vergütungssystemen,
h) Qualität,
i) Grundsätze, Ziele und Methoden für die Planungen einschließlich Planung Großgeräte intra- und extramural im Österreichischen Strukturplan Gesundheit und in den Regionalen Strukturplänen Gesundheit,
j) Angelegenheiten des Österreichischen Strukturplans Gesundheit einschließlich Planung Großgeräte (intra- und extramural) sowie einschließlich der abschließenden Festlegung der verbindlich zu machenden Teile gemäß §23 Abs1,
k) Angelegenheiten der transparenten Darstellung, der vollständigen Budgetierung und der Rechnungsabschlüsse der Krankenanstalten bzw Krankenanstaltenverbände sowie der transparenten Darstellung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Sozialversicherung für den extramuralen Bereich,
l) Grundsätze und Ziele für die Verwendung der Mittel zur Stärkung der Gesundheitsförderung
m) Richtlinien über die wesentlichen Eckpunkte für die Verwendung der Mittel gemäß Art31 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens,
n) Entwicklung von Projekten zur Gesundheitsförderung und
o) Evaluierung der von der Bundes‑Zielsteuerungskommission wahrgenommenen Aufgaben.
2. Zu Angelegenheiten der Bundesgesundheitsagentur als Fonds:
a) Voranschlag und Rechnungsabschluss der Bundesgesundheitsagentur,
b) Vorgaben für die Verwendung von zweckgewidmeten Mitteln der Bundesgesundheitsagentur nach Maßgabe der Bestimmungen in §§59d bis 59f KAKuG,
c) Vorgaben für die Verwendung von zweckgewidmeten Mitteln zur Reallokation nach Maßgabe der Bestimmungen im §59g KAKuG und
d) laufende Wartung und Aktualisierung sowie Weiterentwicklung des leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierungsmodells (LKF) für den stationären und spitalsambulanten Bereich inklusive seiner Grundlagen.
3. Zu allgemeinen gesundheitspolitischen Belangen:
a) Stärkung der nachhaltigen Umsetzung der (Rahmen‑)Gesundheitsziele samt Festlegung der Indikatoren und Monitoring gemäß Art4 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG Zielsteuerung-Gesundheit (inklusive Strategien zur Umsetzung),
b) Rahmenvorgaben für das Nahtstellenmanagement zwischen den verschiedenen Sektoren des Gesundheitswesens,
c) Auf- und Ausbau der für das Gesundheitswesen maßgeblichen Informations- und Kommunikationstechnologien gemäß Art7 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens und
d) Richtlinien für eine bundesweite, alle Sektoren des Gesundheitswesens umfassende Dokumentation, sowie Weiterentwicklung des Dokumentations- und Informationssystems für Analysen im Gesundheitswesen (DIAG).
(5) Die Bundes‑Zielsteuerungskommission kann die Besorgung der Aufgaben gemäß Abs4 Z1 litb, d, h und k, Z2 lita und d sowie Z3 lita und c an den Ständigen Koordinierungsausschuss übertragen.
Ständiger Koordinierungsausschuss
§27. (1) Zur Vorbereitung und Koordination der Agenden der Bundes‑Zielsteuerungskommission sowie zur Unterstützung der Umsetzung von Beschlüssen der Bundes‑Zielsteuerungskommission ist ein Ständiger Koordinierungsausschuss einzurichten. Im Ständigen Koordinierungsausschuss hat eine laufende wechselseitige Information und Konsultation der Mitglieder zu erfolgen.
(2) Dem Ständigen Koordinierungsausschuss gehören je neun Vertreterinnen/Vertreter des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung an. Den Vorsitz führt eine Vertreterin/ein Vertreter des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministeriums. Der Ständige Koordinierungsausschuss tritt regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Monate zusammen.
(3) Für Beschlussfassungen im Ständigen Koordinierungsausschuss sind die Be-stimmungen des §26 Abs3 analog anzuwenden.
(4) Der Ständige Koordinierungsausschuss hat folgende Aufgaben:
1. Beschlussfassung in den von der Bundes‑Zielsteuerungskommission übertragenen Aufgaben,
2. Entscheidung über die geplante Einführung und inhaltliche Umsetzung von neuen oder inhaltlich erweiterten Monitoring-Systemen im Gesundheitswesen, sofern diese nicht aufgrund rechtlicher Vorgaben oder aufgrund international bestehender Verpflichtungen durchzuführen sind,
3. Akkordierung gemeinsamer Standpunkte von Bund, Ländern und der Sozialversicherung,
4. Abstimmung konkreter Arbeitsaufträge einschließlich Verantwortlichkeit und Zeitplan,
5. Klärung von Fragen, die von anderen Gremien der Zielsteuerung-Gesundheit an ihn herangetragen werden,
6. Abstimmung der eHealth‑Entwicklung im Bereich der öffentlichen Gesundheitsversorgung insbesondere zur Umsetzung des Art7 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens; gemeinsame Festlegung von eHealth Anwendungen der Zielsteuerungspartner, um Parallelstrukturen und ‑entwicklungen zu vermeiden und
7. Abstimmung der strategischen Ausrichtung der gemeinsamen Gesundheitsdatenbewirtschaftung insbesondere hinsichtlich Aufbau und Weiterentwicklung der Datenhaltung, ‑auswertung und ‑interpretation gemäß Art15 Abs9 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens.
Mitwirkung des Bundes in den Organen und Gremien der
Landesgesundheitsfonds
§28. (1) Die/Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin/Bundesminister hat eine Vertreterin/einen Vertreter in die jeweilige Gesundheitsplattform und eine Vertreterin/einen Vertreter in die jeweilige Landes‑Zielsteuerungskommission im Rahmen der Landesgesundheitsfonds zu entsenden.
(2) Die Vertreterin/Der Vertreter des Bundes kann gegen Beschlüsse, die gegen geltendes Recht, die geltenden Vereinbarungen gemäß Art15a B‑VG, den Zielsteuerungsvertrag auf Bundesebene oder gegen Beschlüsse der Organe der Bundesgesundheitsagentur verstoßen, ein Veto einlegen.
Mitwirkung der gesetzlichen Krankenversicherung in den Organen und
Gremien der Landesgesundheitsfonds
§29. (1) Der Dachverband hat eine Vertreterin/einen Vertreter ohne Stimmrecht in die jeweilige Gesundheitsplattform im Rahmen der Landesgesundheitsfonds zu entsenden.
(2) Die gesetzlichen Krankenversicherungsträger haben insgesamt fünf Vertreterinnen/Vertreter in die Gesundheitsplattformen und die Landes‑Zielsteuerungskommissionen der Landesgesundheitsfonds zu entsenden und zwar vier Vertreterinnen/Vertreter der Österreichischen Gesundheitskasse, wovon drei Vertreterinnen/Vertreter auf Vorschlag des jeweiligen Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse zu entsenden sind, darunter jedenfalls die Vorsitzende/der Vorsitzende des Landesstellenausschusses sowie dessen/deren Stellvertreter/in, und eine Vertreterin/ein Vertreter der bundesweiten Träger je Bundesland. Bei der Entsendung von Vertreterinnen/Vertretern und der Wahrnehmung der Aufgaben ist auf die Wahrung der aus der Selbstverwaltung erfließenden Rechte zu achten und auf die Interessen der Betriebskrankenkassen Bedacht zu nehmen.
(3) In der Landes‑Zielsteuerungskommission bilden die von der gesetzlichen Krankenversicherung nominierten Vertreterinnen/Vertreter eine Kurie mit einer Stimme. Die gemeinsamen Positionen zu den Themen der Landes‑Zielsteuerungskommission sind innerhalb der Kurie der gesetzlichen Krankenversicherung zu akkordieren.
(4) Die Vorsitzende/Der Vorsitzende des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse hat
1. die Funktion der ersten Stellvertreterin/des ersten Stellvertreters der/des Vorsitzenden der Gesundheitsplattform wahrzunehmen und
2. gleichberechtigt mit dem vom Land bestellten Mitglied der Landesregierung den Vorsitz in der Landes‑Zielsteuerungskommission (Co‑Vorsitz) zu führen sowie
3. die Stimmabgabe für die Kurie der gesetzlichen Krankenversicherung gemäß Abs3 wahrzunehmen.
(5) Ist zur Vorbereitung der Sitzungen der Gesundheitsplattform und der Landes‑Zielsteuerungskommission ein Präsidium vorgesehen, hat die gesetzliche Krankenversicherung in dieses Vertreterinnen/Vertreter zu entsenden. Dabei ist auf die Wahrung der aus der Selbstverwaltung erfließenden Rechte zu achten und auf die Interessen der Betriebskrankenkassen Bedacht zu nehmen.
(6) Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Landes‑Zielsteuerungskommission ist von der gesetzlichen Krankenversicherung eine Koordinatorin/ein Koordinator namhaft zu machen. Diese/dieser ist gleichberechtigt mit der/dem vom Land bestellten Koordinatorin/Koordinator für alle Angelegenheiten der Landes‑Zielsteuerungskommission zuständig. Die/Der von der gesetzlichen Krankenversicherung bestellte Koordinatorin/Koordinator ist als solcher ausschließlich der Vorsitzende/dem Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der örtlich zuständigen Landesstelle der Österreichischen Gesundheitskasse in ihrer/seiner Funktion als Co‑Vorsitzende/Co‑Vorsitzender verantwortlich.
(7) Die Vertreterinnen/Vertreter des Bundes, der Länder und der gesetzlichen Krankenversicherung informieren einander in den Organen der Landesgesundheitsfonds wechselseitig über alle relevanten Maßnahmen im intra- und extramuralen Bereich. Darüber hinaus erfolgt in der Landes‑Zielsteuerungskommission rechtzeitig eine Information und Konsultation über Festlegungen zu wesentlichen operativen und finanziellen Angelegenheiten der Leistungserbringung im Gesundheitswesen.
(8) Im Fall eines vertragslosen Zustandes in Folge Kündigung eines Gesamtvertrages tragen die landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten unter Berücksichtigung von §26 Abs1 Z3 KAKuG dazu bei, schwerwiegende Folgen in der medizinischen Versorgung für die Bevölkerung zu vermeiden. Zur Abgeltung bei Mehrleistungen ist eine Vereinbarung zwischen dem Landesgesundheitsfonds und der gesetzlichen Krankenversicherung zu schließen, wobei die gesetzliche Krankenversicherung Zahlungen maximal im Ausmaß der vergleichbaren ersparten Aufwendungen für ärztliche Hilfe zu leisten hat.
(9) Bei der Erfüllung der Aufgaben des Landesgesundheitsfonds hat die gesetzliche Krankenversicherung im Rahmen ihrer Tätigkeit im Landesgesundheitsfonds insbesondere darauf zu achten, dass dieser eine qualitativ hochwertige, effektive und effiziente, allen frei zugängliche und gleichwertige Gesundheitsversorgung in Österreich insbesondere auch durch die Zielsteuerung-Gesundheit sicherstellt und die Finanzierbarkeit des österreichischen Gesundheitswesens unter Einhaltung der Finanzrahmenverträge absichert.
Bundesgesundheitskommission
§30. (1) Zur Beratung der Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Städte und Gemeinden) sowie der Sozialversicherung in gesundheitspolitischen Themen ist eine Bundesgesundheitskommission einzurichten.
(2) Der Bundesgesundheitskommission gehören an:
1. vier Vertreterinnen/Vertreter des Bundes,
2. neun Vertreterinnen/Vertreter der Länder,
3. je eine Vertreterin/ein Vertreter der Interessenvertretung der Städte und Gemeinden,
4. neun Vertreterinnen/Vertreter der Sozialversicherung,
5. eine Vertreterin/ein Vertreter der Träger der öffentlichen und eine Vertreterin/ein Vertreter der konfessionellen Krankenanstalten,
6. drei Vertreterinnen/Vertreter der Österreichischen Ärztekammer, je zwei Vertreterinnen/Vertreter der Österreichischen Zahnärztekammer, der Österreichischen Apothekerkammer und jeweils eine Vertreterin/ein Vertreter der bundesweiten Berufsvertretungen der nichtärztlichen Gesundheitsberufe,
7. eine Vertreterin/ein Vertreter der Österreichischen Patientenanwaltschaft,
8. je eine Vertreterin/ein Vertreter der Dachverbände der österreichischen Selbsthilfeorganisationen,
9. je eine Vertreterin/ein Vertreter der Bundesarbeitskammer und der Wirtschaftskammer Österreich (Fachverband der Gesundheitsbetriebe),
10. eine Vertreterin/ein Vertreter des Österreichischen Gewerkschaftsbundes,
11. eine Vertreterin/ein Vertreter der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt,
12. zwei Vertreterinnen/Vertreter des Österreichischen Seniorenrates,
13. eine Vertreterin/ein Vertreter einschlägiger außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf Vorschlag der/des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerin/Bundesministers,
14. eine Vertreterin/ein Vertreter der Medizinischen Universitäten/Fakultäten,
15. eine Vertreterin/ein Vertreter der pharmazeutischen Industrie und
16. je eine Vertreterin/ein Vertreter der Parlamentsklubs.
(3) Den Vorsitz in der Bundesgesundheitskommission führt die/der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin/Bundesminister.
(4) Das für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerium hat
1. die Sitzungen der Bundesgesundheitskommission vorzubereiten,
2. die Ergebnisse der Sitzungen der Bundesgesundheitskommission festzuhalten und
3. der Bundesgesundheitskommission über die Aktivitäten der Bundesgesundheitsagentur zu berichten."
"Inkrafttreten und Außerkrafttreten
§41. (1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft.
(2) Das Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I Nr 81/2013, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer Kraft.
(3) §21 Abs3 Z3 sowie Abs8 bis 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 131/2017 treten mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
(4) Werden bis zum 31. Dezember 2021 mehr als 75 Primärversorgungseinheiten errichtet, so bedarf dies eines Einvernehmens zwischen der Landeszielsteuerungs-Kommission und der jeweiligen Landesärztekammer. Für den Zeitraum von 1. Jänner 2022 bis 31. Dezember 2025 ist nach Maßgabe einer abzuschließenden Vereinbarung nach Art15a B‑VG und den darin enthaltenen Planungsvorgaben ein neuer Zielwert sowie die Möglichkeit bei Einvernehmen zwischen der Landeszielsteuerungs-Kommission und der jeweiligen Landesärztekammer diesen Zielwert zu überschreiten, gesetzlich vorzusehen.
(5) Die §§10 Abs3 Z1, 17 Abs3, §21 Abs9, 23 Abs3, 29 Abs1, 2, 4, und 6 sowie §38 Abs2 Z4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 100/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft.
(6) Die §§9 Abs1, §10 Abs1, 2 und 4 Z1 und 2, §11, §13 Abs2, §14 Abs2, §15 Abs2, §16 Abs1, 6 und 7, §34, §35, die Paragrafenüberschriften zu §§36, 37 und 38, §36 Abs2 und 4, §37 Abs1 und 2 sowie §38 Abs1, 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 9/2022 treten mit 1. Jänner 2022 in Kraft."
3. Die §§3a, 10a, 56a, 59a, 59h und 59k des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), BGBl 1/1957, idF BGBl I 26/2017 (§§10a, 56a, 59a, 59h und 59k) und BGBl I 13/2019 (§3a [§3a Abs3a idF BGBl I 26/2017]) lauten (die in Prüfung gezogene Bestimmung ist hervorgehoben):
"Zulassungsverfahren für selbstständige Ambulatorien
§3a. (1) Selbständige Ambulatorien bedürfen, sofern §42d nicht anderes bestimmt, sowohl zu ihrer Errichtung als auch zu ihrem Betrieb einer Bewilligung der Landesregierung. Anträge auf Erteilung der Bewilligung zur Errichtung haben den Anstaltszweck und das in Aussicht genommene Leistungsangebot (Leistungsspektrum, Öffnungszeiten unter Berücksichtigung von Tagesrand- und Nachtzeiten, Sams‑, Sonn- und Feiertagen sowie Leistungsvolumen einschließlich vorgesehener Personalausstattung, insbesondere vorgesehene Anzahl von Ärzten bzw Zahnärzten) genau zu bezeichnen. Eine Vorabfeststellung zu den Voraussetzungen des Abs3 ist zulässig.
(2) Die Bewilligung zur Errichtung darf nur erteilt werden, wenn insbesondere
1. nach dem angegebenen Anstaltszweck und dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot im Hinblick auf das bereits bestehende Versorgungsangebot öffentlicher, privater gemeinnütziger und sonstiger Krankenanstalten mit Kassenverträgen sowie auch im Hinblick auf das Versorgungsangebot durch Ambulanzen der genannten Krankenanstalten und kasseneigene Einrichtungen, niedergelassene Ärzte, Gruppenpraxen und selbstständige Ambulatorien, soweit sie sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen, bei selbstständigen Zahnambulatorien auch im Hinblick auf niedergelassene Zahnärzte, Dentisten und zahnärztliche Gruppenpraxen, soweit sie sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen,
a) zur Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und allgemein zugänglichen Gesundheitsversorgung und
b) zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit
eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann,
2. das Eigentumsrecht oder sonstige Rechte zur Benützung der für die Anstalt in Aussicht genommenen Betriebsanlage nachgewiesen sind,
3. das für die Unterbringung der Anstalt geplante oder bereits vorhandene Gebäude den hinsichtlich der Aufführung oder Verwendung solcher Gebäude vorgesehenen bau‑, feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften entspricht und
4. gegen den Bewerber keine Bedenken bestehen.
Sofern ein Vertragsvergabeverfahren der Sozialversicherung über den verfahrensgegenständlichen Leistungsumfang anhängig ist oder innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Entscheidung der Landesregierung über den Bedarf eingeleitet wird, ist Voraussetzung für die Erteilung der Errichtungsbewilligung darüber hinaus auch eine Vertragszusage der Sozialversicherung auf Grund dieses Vertragsvergabeverfahrens.
(3) Bei der Beurteilung, ob eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann, sind ausgehend von den Ergebnissen der Planungen des jeweiligen RSG folgende Kriterien zu berücksichtigen:
1. örtliche Verhältnisse (regionale rurale oder urbane Bevölkerungsstruktur und Besiedlungsdichte),
2. die für die Versorgung bedeutsamen Verkehrsverbindungen,
3. das Inanspruchnahmeverhalten und die Auslastung von bestehenden Leistungsanbietern, die sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen, durch Pfleglinge,
4. die durchschnittliche Belastung bestehender Leistungsanbieter gemäß Z3 und
5. der Entwicklungstendenzen in der Medizin bzw Zahnmedizin.
(3a) Wenn der verfahrensgegenständliche Leistungsumfang in den Verordnungen gemäß §23 oder §24 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I Nr 26/2017, geregelt ist, ist hinsichtlich des Bedarfs die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen. Ist das Vorhaben nicht in den genannten Verordnungen geregelt, ist Abs3 sinngemäß anzuwenden.
(4) Die Landesregierung hat von einer Prüfung nach Abs2 Z1 in Verbindung mit Abs3 abzusehen, wenn nach dem vorgesehenen Leistungsangebot im selbstständigen Ambulatorium ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen erbracht werden sollen. Die örtlich zuständige Landesstelle der Österreichischen Gesundheitskasse ist zur Frage, ob es sich beim Leistungsangebot um ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen handelt, zu hören. Darüber hinaus ist von der Prüfung des Bedarfes abzusehen, wenn bereits eine Errichtungsbewilligung erteilt wurde und die Verlegung des Standortes innerhalb desselben Einzugsgebietes erfolgt.
(5) Im Bewilligungsverfahren bzw Verfahren zur Vorabfeststellung ist ein Gutachten der Gesundheit Österreich GesmbH oder eines vergleichbaren Gesundheitsplanungsinstitut sowie eine begründete Stellungnahme des jeweiligen Landesgesundheitsfonds zum Vorliegen der Kriterien gemäß Abs3 einzuholen.
(6) Die Vorlage von Unterlagen zum Nachweis der Voraussetzungen nach Abs2 Z2 bis 4 ist nicht erforderlich, wenn eine gesonderte Vorabfeststellung zu den Voraussetzungen nach Abs3 beantragt wird.
(7) Die Errichtungsbewilligung hat – ausgenommen im Fall des Abs4 – im Rahmen des Antrags jedenfalls das Leistungsvolumen, das Leistungsspektrum und bedarfsgerechte Öffnungszeiten (Berücksichtigung von Tagesrand- und Nachtzeiten und von Sams‑, Sonn- und Feiertagen) sowie erforderlichenfalls Bereitschaftszeiten und – soweit sinnvoll – die Verpflichtung zur Durchführung von Hausbesuchen durch Auflagen festzulegen.
(8) Weiters hat die Landesgesetzgebung vorzusehen, dass in Verfahren zur Erteilung der Bewilligung zur Errichtung eines selbständigen Ambulatoriums – ausgenommen im Fall des Abs4 – betroffene Sozialversicherungsträger, die gesetzliche Interessenvertretung privater Krankenanstalten und die zuständige Landesärztekammer bzw bei selbstständigen Zahnambulatorien die Österreichische Zahnärztekammer hinsichtlich des Bedarfs Parteistellung im Sinne des §8 AVG und das Recht der Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht gemäß Art132 Abs5 B‑VG und gegen Erkenntnisse und Beschlüsse des Landesverwaltungsgerichts das Recht der Revision an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art133 Abs1 B‑VG haben. Dies gilt auch für Verfahren zur Vorabfeststellung zu den Voraussetzungen des Abs3.
(9) Die Errichtungsbewilligung für ein selbstständiges Ambulatorium, dessen Rechtsträger ein Krankenversicherungsträger ist, ist zu erteilen, wenn ein Einvernehmen zwischen dem Krankenversicherungsträger und mit der in Betracht kommenden örtlich zuständigen Landesärztekammer bzw der Österreichischen Zahnärztekammer oder zwischen dem Dachverband der Sozialversicherungsträger und der Österreichischen Ärztekammer bzw der Österreichischen Zahnärztekammer vorliegt (§339 ASVG). Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn ein Auswahlverfahren für Primärversorgungseinheiten nach §14 des Primärversorgungsgesetzes, BGBl I Nr 131/2017, zu keinem positiven Abschluss geführt hat. Liegt kein Einvernehmen vor, ist die Bewilligung zur Errichtung zu erteilen, wenn durch die Landesregierung festgestellt wurde, dass eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann. Der erste und zweite Satz gelten auch dann, wenn der Krankenversicherungsträger Dritte mit dem Betrieb eines selbstständigen Ambulatoriums betraut.
(10) Die Landesgesetzgebung hat vorzusehen, dass einer Beschwerde einer Landesärztekammer an das Landesverwaltungsgericht und einer Revision einer Landesärztekammer an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Abs8 in Verfahren zur Erteilung der Errichtungsbewilligung für eine eigene Einrichtung für Zwecke der Primärversorgung eines gesetzlichen Krankenversicherungsträgers gemäß §339 ASVG keine aufschiebende Wirkung zukommt."
"§10a. (1) Die Landesgesetzgebung hat die Landesregierung zu verpflichten, dass in Fällen, in denen kein Einvernehmen über die verbindlich zu erklärenden Teile des RSG bzw deren Änderungen entsprechend den Bestimmungen im §23 Abs2 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I Nr 26/2017 in der Landes‑Zielsteuerungskommission zustande kommt, auf Basis der gemeinsamen Festlegungen in der partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit im Rahmen eines Regionalen Strukturplanes Gesundheit für Fondskrankenanstalten einen Landeskrankenanstaltenplan durch Verordnung zu erlassen. Dieser Landeskrankenanstaltenplan hat sich im Rahmen des Zielsteuerungsvertrages gemäß §10 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit und des Österreichischen Strukturplanes Gesundheit (ÖSG) zu befinden. Dabei sind, um eine verbindliche österreichweit auf einheitlichen Grundsätzen basierende Krankenanstaltenplanung mit integrierter Leistungsangebotsplanung zu gewährleisten, die im ÖSG vereinbarten Zielvorstellungen, Planungsgrundsätze und ‑methoden zu berücksichtigen.
(2) Im Landeskrankenanstaltenplan ist jedenfalls festzulegen:
1. die Standorte der Fondskrankenanstalten,
2. die maximale Gesamtbettenzahlen (für Normalpflege und Intensivbereich) je Standort,
3. die medizinischen Fachbereiche je Standort,
4. die für die Fachbereiche jeweils vorgesehenen fachrichtungsbezogenen Organisationsformen je Standort,
5. Art und Anzahl der medizinisch technischen Großgeräte je Standort,
6. die maximale Bettenzahl je Fachbereich bezogen auf das Land und die Versorgungsregionen oder bezogen auf die Standorte,
7. Festlegung von Referenzzentren und speziellen Versorgungsbereichen je Standort.
(3) Erfolgen die Festlegungen gemäß Abs2 Z6 nicht bezogen auf die Standorte, sind in Zusammenhang mit §3 Abs2b und 2c die zur Realisierung beabsichtigten Bettenkapazitäten je Fachbereich und Standort im Regionalen Strukturplan Gesundheit zumindest unverbindlich mit Informationscharakter auszuweisen.
(4) Die Landesgesetzgebung hat die Landesregierung zu verpflichten, den auf Landesebene zwischen dem Land und der Sozialversicherung im jeweiligen Landesgesundheitsfonds abgestimmten Regionalen Strukturplan Gesundheit auf der Homepage des jeweiligen Landes in der jeweils aktuellen Fassung zu veröffentlichen."
"Bundesgesundheitsagentur
§56a. Zur Wahrnehmung der Aufgaben gemäß §26 des Gesundheits-Zielsteuerungsgesetzes sowie der Aufgaben im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen dieses Gesetzes ist beim für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerium die Bundesgesundheitsagentur als Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit einzurichten."
"§59a. Aufgaben der Bundesgesundheitsagentur sind:
(1) Die Bundesgesundheitsagentur hat im Rahmen der partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit zur Planung, Steuerung und Finanzierung des Gesundheitswesens in Österreich die Aufgaben gemäß §27 Abs4 des Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetzes unter Berücksichtigung gesamtökonomischer Auswirkungen sowie regionaler und länderspezifischer Erfordernisse wahrzunehmen.
(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben hat die Bundesgesundheitsagentur insbesondere darauf zu achten, dass eine qualitativ hochwertige, effektive und effiziente, allen frei zugängliche und gleichwertige Gesundheitsversorgung in Österreich sichergestellt und die Finanzierbarkeit des österreichischen Gesundheitswesens unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen und möglicher Kosteneinsparungen abgesichert wird."
"§59h. Für die Organisation der Bundesgesundheitsagentur gelten die §§25 bis 27 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit."
"§59k. Die/Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin/Bundesminister hat auf der Homepage des Bundesministeriums jedenfalls
1. den als objektiviertes Sachverständigengutachten anzusehenden aktuellen Österreichischen Strukturplan Gesundheit,
2. das aktuelle Modell der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung,
3. die aktuellen Grundlagen für die Dokumentation auf Grund des Bundesgesetzes über die Dokumentation im Gesundheitswesen und
4. den aktuellen Zielsteuerungsvertrag auf Bundesebene gemäß §10 Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz
zu veröffentlichen."
4. Die §§10a, 10b und 10c NÖ Krankenanstaltengesetz (NÖ KAG), LGBl 170/1974 (LGSlg 9440), idF LGBl 90/2014 (§10a), LGBl 12/2018 (§10b) und LGBl 90/2020 (§10c) laute(te)n (die in Prüfung gezogene Bestimmung ist hervorgehoben):
"Zulassungsverfahren für selbstständige Ambulatorien
§10a
Selbstständige Ambulatorien bedürfen sowohl zu ihrer Errichtung wie auch zu ihrem Betrieb einer Bewilligung der Landesregierung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.
§10b
(1) Der Bewerber hat in seinem Antrag auf Bewilligung der Errichtung eines selbstständigen Ambulatoriums bei Beschreibung des Anstaltszweckes, des in Aussicht genommenen Leistungsangebotes und allfälliger Schwerpunkte anzugeben:
a) für welches Gebiet und allenfalls für welchen Personenkreis das selbstständige Ambulatorium zunächst bestimmt ist,
b) welche Krankheiten zu behandeln beabsichtigt sind,
c) das genaue Leistungsspektrum, insbesondere welche Untersuchungen und beabsichtigte Behandlungen über den Umfang von Ordinationen von Fachärzten oder Ärzte von Allgemeinmedizin hinausgehen. Darüber hinaus ist anzugeben, wieviele Patienten an einem Tag im Rahmen des selbstständigen Ambulatoriums voraussichtlich behandelt werden können,
d) Öffnungszeiten unter Berücksichtigung von Tagesrand- und Nachtzeiten, Sams‑, Sonn- und Feiertagen,
e) Anzahl der Ärzte bzw Zahnärzte und Personal, das für die Behandlung der Patienten herangezogen werden soll, und
f) welche wesentlichen medizinischen Apparate und Einrichtungen im selbstständigen Ambulatorium Verwendung finden sollen.
(2) Dem Antrag sind folgende Nachweise anzuschließen:
a) ein Grundbuchsauszug zum Nachweis des Eigentums des Antragstellers oder des Vermieters an der Liegenschaft, auf welcher das selbstständige Ambulatorium errichtet oder eingerichtet werden soll, oder Nachweise seiner sonstigen Rechte zur Benützung der in Aussicht genommenen Betriebsanlage;
b) ein Finanzierungsplan mit geeigneten Nachweisen über die Bereitstellung der nötigen Mittel für die Errichtung und den Betrieb. Bei Zuhilfenahme fremden Kapitals sind die entsprechenden Verträge im Original oder in beglaubigter Abschrift zum Nachweis dafür vorzulegen, dass der Kreditgeber keinen Einfluss auf den Betrieb des zu errichtenden selbstständigen Ambulatoriums nimmt;
c) sofern ein Bauvorhaben zur Ausführung gelangen soll, die entsprechenden Baupläne und sonstigen Unterlagen sowie eine Baubeschreibung.
(3) Bei Fehlen einer der in Abs1 aufgezählten Angaben oder eines der im Abs2 aufgezählten Nachweise ist dem Bewerber eine Frist, welche nicht kürzer als zwei Monate zu bemessen ist, zu setzen, um ihm Gelegenheit zu geben, die fehlenden Angaben oder Nachweise zu erbringen. Nach fruchtlosem Verstreichen der Frist ist der Antrag zurückzuweisen, wenn dies bei Setzung der Frist dem Bewerber angedroht wurde.
(4) Wenn der Bewerber eine juristische Person öffentlichen Rechtes ist, kann von der Beilage der Nachweise abgesehen werden, wenn die entsprechenden Tatsachen amtsbekannt sind. Die Vorlage von Urkunden gemäß Abs2 entfällt, wenn die zu beweisenden Tatsachen und Rechtsverhältnisse durch Einsicht in die der Behörde zur Verfügung stehenden Register, insbesondere durch Abfrage des Grundbuchs (§6 des Grundbuchsumstellungsgesetzes – GUG, BGBl Nr 550/1980), festgestellt werden können.
(5) Der Antragsteller ist berechtigt, vorab eine gesonderte Entscheidung über die Bedarfsfrage zu beantragen. Angaben im Sinne des Abs1 lit.e und f sowie die Vorlage der im Abs2 aufgezählten Unterlagen sind für die Antragstellung nicht erforderlich. Ein Bescheid, mit dem der Bedarf festgestellt wurde, erlischt, wenn nicht innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft ein entsprechender Antrag auf Bewilligung der Errichtung der Krankenanstalt gestellt wird. Die Behörde hat die Frist für die Antragstellung auf höchstens drei Jahre zu verlängern, wenn dies vor ihrem Ablauf beantragt wird, sich die Planungsgrundlagen nicht geändert haben und berücksichtigungswürdige Gründe bescheinigt werden können.
§10c
(1) Die Bewilligung zur Errichtung eines selbstständigen Ambulatoriums ist zu erteilen, wenn:
a) nach dem angegeben Anstaltszweck und dem in Aussicht genommen Leistungsangebot im Hinblick auf das bereits bestehende Versorgungsangebot öffentlicher, privater gemeinnütziger und sonstiger Krankenanstalten mit Kassenverträgen sowie auch im Hinblick auf das Versorgungsangebot durch Ambulanzen der genannten Krankenanstalten und kasseneigene Einrichtungen, niedergelassene Ärzte, Gruppenpraxen und selbstständige Ambulatorien, soweit sie sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen, bei selbstständigen Zahnambulatorien auch im Hinblick auf niedergelassene Zahnärzte, Dentisten und zahnärztliche Gruppenpraxen, soweit sie sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen, zur Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und allgemein zugänglichen Gesundheitsversorgung und zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann,
b) gegen den Bewerber keine Bedenken (§5 Abs6) bestehen,
c) das geplante oder bereits vorhandene Gebäude als Anstaltsgebäude geeignet und die nach dem Anstaltszweck, dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot und allfälligen Schwerpunkte erforderliche apparative und personelle Ausstattung dauerhaft sichergestellt sind sowie
d) die zivilrechtlichen und finanziellen Grundlagen die einwandfreie Führung des selbstständigen Ambulatoriums ermöglichen.
Sofern ein Vertragsvergabeverfahren der Sozialversicherung über den verfahrensgegenständlichen Leistungsumfang anhängig ist oder innerhalb von 3 Monaten nach Zustellung der Entscheidung über den Bedarf eingeleitet wird, ist Voraussetzung für die Erteilung der Errichtungsbewilligung darüber hinaus auch eine Vertragszusage der Sozialversicherung aufgrund dieses Vertragsvergabeverfahrens. Sofern ein Vertragsvergabeverfahren der Sozialversicherung anhängig ist, können Verfahren nach §10b Abs5 und §10d Abs1 bis zur endgültigen Entscheidung über die Vertragsvergabe ausgesetzt werden.
(2) Bei der Beurteilung, ob eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebotes im Einzugsgebiet erreicht werden kann, sind ausgehend von den Ergebnissen der Planungen des jeweiligen Regionalen Strukturplanes Gesundheit folgende Kriterien zu berücksichtigen:
1. örtliche Verhältnisse (regionale rurale oder urbane Bevölkerungsstruktur und Besiedlungsdichte),
2. die für die Versorgung bedeutsamen Verkehrsverbindungen,
3. das Inanspruchnahmeverhalten und die Auslastung von bestehenden Leistungsanbietern, die sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen,
4. die durchschnittliche Belastung bestehender Leistungsanbieter und
5. die Entwicklungstendenzen in der Medizin bzw Zahnmedizin.
(3) Wenn der verfahrensgegenständliche Leistungsumfang in den Verordnungen gemäß §23 oder §24 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I Nr 26/2017, geregelt ist, ist hinsichtlich des Bedarfs die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen. Ist das Vorhaben nicht in den genannten Verordnungen geregelt, ist Abs1 lita in Verbindung mit Abs2 sinngemäß anzuwenden.
(4) Die Errichtungsbewilligung für eine Primärversorgungseinheit in Form eines selbstständigen Ambulatoriums ist abweichend von Abs1 lita in Verbindung mit Abs2 nur dann zu erteilen, wenn eine Primärversorgungseinheit im RSG abgebildet ist und – als Ergebnis eines Verfahrens nach §14 des Primärversorgungsgesetzes, BGBl I Nr 131/2017 in der Fassung BGBl I Nr 100/2018 – eine vorvertragliche Zusage der Österreichischen Gesundheitskasse zum Abschluss eines Primärversorgungsvertrages nach §8 des Primärversorgungsgesetzes, BGBl I Nr 131/2017 in der Fassung BGBl I Nr 100/2018, vorliegt.
(5) Die Landesregierung hat von einer Prüfung nach Abs1 lita in Verbindung mit Abs2 abzusehen, wenn nach dem vorgesehenen Leistungsangebot im selbstständigen Ambulatorium ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen erbracht werden sollen. Die Landesstelle der Österreichischen Gesundheitskasse ist zur Frage, ob es sich beim Leistungsangebot um ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen handelt, zu hören. Darüber hinaus ist von der Prüfung des Bedarfes abzusehen, wenn bereits eine Errichtungsbewilligung erteilt wurde und die Verlegung des Standortes innerhalb desselben Einzugsgebietes erfolgt oder es sich um eine bloße Flächenerweiterung am bisherigen Standort handelt.
(6) Die Errichtungsbewilligung für ein selbstständiges Ambulatorium, dessen Rechtsträger ein Krankenversicherungsträger ist, ist zu erteilen, wenn neben dem Vorliegen der Erfordernisse des Abs1 lit.b bis d ein Einvernehmen zwischen dem Krankenversicherungsträger und der Ärztekammer für NÖ bzw der Österreichischen Zahnärztekammer oder zwischen dem Dachverband der Sozialversicherungsträger und der Österreichischen Ärztekammer bzw der Österreichischen Zahnärztekammer vorliegt. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn ein Auswahlverfahren für Primärversorgungseinheiten nach §14 des Primärversorgungsgesetzes, BGBl I Nr 131/2017, zu keinem positiven Abschluss geführt hat. Liegt kein Einvernehmen vor, ist die Bewilligung zur Errichtung nur zu erteilen, wenn durch die Landesregierung zusätzlich festgestellt wurde, dass eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebotes im Einzugsgebiet erreicht werden kann. Dies gilt auch dann, wenn der Krankenversicherungsträger Dritte mit dem Betrieb eines selbstständigen Ambulatoriums betraut.
(7) Die Bewilligung für die Errichtung eines selbstständigen Ambulatoriums hat eine genaue Beschreibung des Anstaltszweckes und ‑umfanges zu enthalten. Sie hat den Plan des zu errichtenden oder bestehenden Gebäudes und eine Baubeschreibung als Bestandteil des Bescheides zu erklären. In dem Bescheid können Änderungen des Projektes angeordnet werden, wenn die ursprünglich beabsichtigte Ausführung oder das vorhandene Gebäude eine einwandfreie Behandlung nach den Grundsätzen der medizinischen Wissenschaft nicht gewährleistet. Weiters sind bedarfsgerechte Öffnungszeiten unter Berücksichtigung von Tagesrand- und Nachtzeiten und von Sams‑, Sonn- und Feiertagen sowie erforderlichenfalls Bereitschaftszeiten und die Verpflichtung zur Durchführung von Hausbesuchen durch Auflagen festzulegen. Für Primärversorgungseinheiten sind bedarfsgerechte Öffnungszeiten mit ärztlicher Anwesenheit jedenfalls von Montag bis Freitag, einschließlich der Tagesrandzeiten, festzulegen.
(8) Die Bewilligung ist an die Bedingung zu knüpfen, dass mit der Errichtung des selbstständigen Ambulatoriums binnen Jahresfrist begonnen und in einem angemessenen Zeitraum nach Beendigung der Errichtung die Bewilligung zum Betrieb beantragt wird."
5. Die §§2, 8, 9, 16 und 17 NÖ Gesundheits- und Sozialfonds‑Gesetz 2006 (NÖGUS‑G 2006), LGBl 134/2005 (LGSlg 9450), idF LGBl 92/2017 (§§2, 9, 16 und 17) und LGBl 90/2020 (§8) laute(te)n (die in Prüfung gezogene Bestimmung ist hervorgehoben):
"§2
Aufgaben des Fonds
(1) Der Landesgesundheitsfonds hat Aufgaben in folgenden Bereichen:
1. Angelegenheiten als Fonds;
2. Allgemeine gesundheitspolitische Angelegenheiten;
3. Angelegenheiten der Zielsteuerung;
4. Bereich Soziales.
(2) Der Aufgabenbereich des Fonds erstreckt sich im Bereich der Angelegenheiten als Fonds insbesondere auf folgende Aufgaben:
1. Landesspezifische Ausformung des in Niederösterreich geltenden leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierungssystems; Anpassung des leistungsorientierten Krankenanstalten-Finanzierungssystems; Anpassung und Weiterentwicklung des leistungsorientierten Finanzierungssystems (LKF‑Modell) an die Besonderheiten in Niederösterreich;
2. Abgeltung von Betriebsleistungen der Fondskrankenanstalten;
3. Umsetzung von leistungsorientierten Vergütungssystemen;
4. Genehmigung von Investitionsvorhaben und die Gewährung allfälliger Investitionszuschüsse und/oder ‑darlehen für die Errichtung, Umgestaltung oder Erweiterung von Krankenanstalten; die Mittelaufbringung des Fonds kann auch durch Darlehensaufnahme erfolgen;
5. Gewährung von Zuschüssen für Projekte, Planungen und krankenhausentlastende Maßnahmen;
6. Voranschlag und Rechnungsabschluss des Landesgesundheitsfonds;
6a. Transparente Darstellung der Voranschläge und der Rechnungsabschlüsse der Fondskrankenanstalten sowie der Voranschläge und der Rechnungsabschlüsse der Sozialversicherung für den extramuralen Bereich unter Entsprechung der Art15 bis 17 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG Zielsteuerung-Gesundheit, LGBl 60/2017;
7. Abrechnung der Kosten für die Erbringung von Leistungen der Krankenanstalten für ausländische Gastpatientinnen und Gastpatienten auf Grund von zwischenstaatlichen Übereinkommen oder überstaatlichem Recht über soziale Sicherheit;
8. Mitwirkung in behördlichen Verfahren zur Erteilung und zum Entzug von Errichtungs- und Betriebsbewilligungen für Krankenanstalten, zur Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes und in Fragen des Bedarfs gemäß NÖ KAG, LGBl 9440;
9. Zuwendung von allfälligen Mitteln zur Strukturverbesserung;
10. Erstellung von Richtlinien insbesondere für die wirtschaftliche Gebarung von NÖ Fonds- Krankenanstalten gemäß §23 Abs3 NÖ KAG, LGBl 9440;
11. Unterstützung von Vorhaben wissenschaftlicher Lehre und Forschung sowie Koordination von Vorhaben der wissenschaftlichen Lehre und Forschung im Bereich des Gesundheitswesens und des damit unmittelbar im Zusammenhang stehenden Sozialwesens;
12. Aufgaben, die dem Fonds durch die Landesgesetzgebung übertragen werden;
13. Umsetzung von Projekten der Prävention und Gesundheitsförderung mit Ausnahme von Projekten gemäß Abs4 Z10;
14. Optimierung des Nahtstellenmanagements im ambulanten, teilstationären und stationären Pflegebereich.
(3) Der Aufgabenbereich des Fonds erstreckt sich im Bereich Allgemeine gesundheitspolitische Angelegenheiten insbesondere auf folgende Aufgaben:
1. (Weiter‑)Entwicklung der Gesundheitsziele (inkl. Strategien zur Umsetzung) auf Landesebene;
2. Grundsätze der Umsetzung von Qualitätsvorgaben für die Erbringung von intra- und extramuralen Gesundheitsleistungen;
3. Grundsätze der Umsetzung von Vorgaben zum Nahtstellenmanagement, mit Ausnahme der in Abs4 genannten Angelegenheiten;
4. Mitwirkung am Auf- und Ausbau der für das Gesundheitswesen maßgeblichen Informations- und Kommunikationstechnologien (wie ELGA, eCard, Telehealth, Telecare) auf Landesebene;
5. Durchführung von Analysen zur Beobachtung von Entwicklungen im österreichischen Gesundheitswesen, wobei insbesondere auch auf die geschlechtsspezifische Differenzierung zu achten ist;
6. Evaluierung der von der Gesundheitsplattform auf Landesebene wahrgenommenen Aufgaben.
(4) Der Aufgabenbereich des Fonds erstreckt sich im Bereich Angelegenheiten der Zielsteuerung insbesondere auf folgende Aufgaben:
1. Beschluss des Landes-Zielsteuerungsübereinkommens für eine Dauer von vier Jahren;
2. Koordination, Abstimmung und Festlegung aller aus dem Zielsteuerungsvertrag und dem vierjährigen Landes‑Zielsteuerungsübereinkommen resultierenden Aufgaben zur Umsetzung;
3. Mitwirkung am bundesweiten Monitoring und Behandlung des Monitoringberichts;
4. Wahrnehmung von Agenden zum Sanktionsmechanismus;
5. Umsetzung der Regelungen für vertragliche und gemeinsam von Sozialversicherung und Ländern zu verantwortende sektorenübergreifende Finanzierungs- und Verrechnungsmechanismen auf Landesebene (z. B. Spitalsambulanzen, Gruppenpraxen und niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte, tagesklinische Versorgung, innovative Versorgungsformen etc.); Sicherstellung der Umsetzung von vereinbarten innovativen Modellen zur sektorenübergreifenden Finanzierung des ambulanten Bereichs;
6. Festlegung von konkreten sektorenübergreifenden Vorhaben (gemäß Regionalem Strukturplan Gesundheit – RSG) samt individuell projektbezogener und einvernehmlicher Entscheidung über die Finanzierungsaufteilung gemäß Art31 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, LGBl 58/2017, unter Berücksichtigung der Verbesserung der Versorgung und der Spitalsentlastung;
7. Angelegenheiten des Regionalen Strukturplanes Gesundheit (RSG); diese umfassen insbesondere:
a) Den Beschluss des RSG, wobei jene Teile, die rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen (insbesondere Festlegungen zur Kapazitätsplanung gemäß §16 Abs3 Z1 und 2, sowie zur überregionalen Versorgungsplanung gemäß §16 Abs3 Z4) als solche zu kennzeichnen sind; die im RSG enthaltenen Planungsvorgaben sind so konkret auszuweisen, dass sie für die Bedarfsprüfung herangezogen werden können;
b) Den Beschluss von Änderungen des RSG, die sich aufgrund eines gemäß §23 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz – G‑ZG, BGBl I Nr 26/2017) durchgeführten Begutachtungsverfahrens ergeben;
c) Die Festlegung des Beginns der verbindlichen Wirkung der als normativ gekennzeichneten Teile des RSG unter Berücksichtigung entsprechender Umsetzungsfristen;
d) Die Information der Landesregierung über Beschlussfassungen betreffend den RSG;
8. Angelegenheiten der Großgeräte intra- und extramural;
9. Strategie zur Gesundheitsförderung;
10. Angelegenheiten des Gesundheitsförderungsfonds;
11. Mitwirkung bei der Umsetzung von Qualitätsvorgaben für die Erbringung von intra- und extramuralen Gesundheitsleistungen;
12. Umsetzung von Vorgaben zum Nahtstellenmanagement;
13. Evaluierung der von der Landes‑Zielsteuerungskommission wahrgenommenen Aufgaben.
(5) Der Aufgabenbereich des Fonds erstreckt sich im Bereich Soziales auf die Planung der Versorgungsstrukturen für psychisch beeinträchtigte Menschen sowie pflegebedürftige Menschen und hat folgende Aufgaben:
1. regelmäßige Evaluierung des NÖ Psychiatrieplanes;
2. Abstimmung der Ressourcenplanung zwischen dem Gesundheitswesen und dem Pflegebereich;
3. Koordination und Abstimmung aller Leistungserbringer sowie Koordination, Planung und Steuerung aller Leistungen der psychosozialen, sozialpsychiatrischen und sozialpädiatrischen Versorgung in jedem Lebensalter.
(6) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist insbesondere darauf zu achten, dass eine qualitativ hochwertige, effektive und effiziente, allen frei zugängliche und gleichwertige Gesundheitsversorgung insbesondere auch durch die Zielsteuerung Gesundheit sichergestellt und die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens unter Einhaltung der Finanzzielsteuerung gemäß Abschnitt 5 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG Zielsteuerung-Gesundheit, LGBl 60/2017, abgesichert wird.
(7) Die Grundlage für die Erfüllung der Aufgaben des Fonds bilden die bestehenden Zuständigkeiten und Aufgaben der Partner im Zielsteuerungssystem Gesundheit.
(8) Im Falle eines vertragslosen Zustandes mit den Vertragspartnern hat der Fonds mitzuhelfen, schwerwiegende Folgen für die Bevölkerung zu vermeiden. Dabei ist auch eine Regelung für die Entgelte bei Mehrleistungen zu treffen. Die Sozialversicherung hat Zahlungen maximal im Ausmaß der vergleichbaren ersparten Arztkosten an den Landesgesundheitsfonds zu leisten.
(9) Der Fonds hat darauf hinzuwirken, dass gemeinsam mit Bund und Sozialversicherung digitale Informationssysteme aus dem e‑health‑Bereich zur Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung eingesetzt werden."
"§8
Landes‑Zielsteuerungskommission
(1) Der Landes‑Zielsteuerungskommission gehören die Kurie des Landes mit fünf Vertreterinnen oder Vertretern, die Kurie der Träger der Sozialversicherung mit fünf Vertreterinnen oder Vertretern sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bundes an.
(2) Der Kurie des Landes gehören die Vertreterinnen oder Vertreter des Landes in der Gesundheitsplattform gemäß §6 Abs1 Z1 an.
(3) Der Kurie der Sozialversicherung gehören an:
1. vier von der Österreichischen Gesundheitskasse entsandte Mitglieder, wovon drei Vertreterinnen oder Vertreter auf Vorschlag des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse entsandt werden, darunter jedenfalls der oder die Vorsitzende des Landesstellenausschusses sowie dessen oder deren Stellvertreter oder Stellvertreterin sowie
2. ein Mitglied, das von der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen und der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau gemeinsam entsandt wird.
(4) Hinsichtlich der Beschlussfassung in der Landes‑Zielsteuerungskommission gilt Folgendes:
1. Für Beschlussfassungen ist Einvernehmen zwischen der Kurie des Landes und der Kurie der Träger der Sozialversicherung erforderlich.
2. Die Vertreterin oder der Vertreter des Bundes verfügt über ein Vetorecht gegen Beschlüsse, die gegen geltendes Recht, gegen die beiden geltenden Vereinbarungen gemäß Art15a B‑VG Zielsteuerung-Gesundheit, LGBl 60/2017, und über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, LGBl 58/2017, den Zielsteuerungsvertrag oder gegen Beschlüsse der Organe der Bundesgesundheitsagentur verstoßen. Im Falle der Verhinderung des Bundes an der Sitzungsteilnahme kann dieser binnen einer Woche schriftlich und begründet sein Vetorecht einbringen.
(5) Innerhalb der jeweiligen Kurie ist eine Entscheidung über ihr Stimmverhalten herbeizuführen. Beschlüsse innerhalb der Kurie des Landes werden mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; im Fall der Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag. Der/Die Vorsitzende für die Landeskurie und der/die Co‑Vorsitzende für die Kurie der Sozialversicherung geben die Stimme für die Kurie ab.
(6) Im Verhinderungsfall können durch folgende schriftlich bevollmächtigte Mitglieder der Landes‑Zielsteuerungskommission vertreten werden:
1. Der/die Vorsitzende der Landes‑Zielsteuerungskommission durch ein Mitglied der NÖ Landesregierung,
2. der oder die Co‑Vorsitzende durch seinen bzw ihren Stellvertreter oder seine bzw ihre Stellvertreterin im Landesstellenausschuss der Österreichischen Gesundheitskasse,
3. die anderen Mitglieder durch ein weiteres Mitglied der Landes‑Zielsteuerungskommission. Für diese können auch Ersatzmitglieder bestellt bzw entsandt werden.
(7) Die Landes‑Zielsteuerungskommission ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder (Ersatzmitglieder), darunter zumindest je drei Vertreter der Landeskurie und der Kurie der Träger der Sozialversicherung, anwesend ist oder gem. Abs6 vertreten ist. Wurde von einer Entsendung oder Bestellung kein Gebrauch gemacht, so bleiben die nicht entsendeten bzw bestellten Mitglieder bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit außer Betracht.
(8) Den Vorsitz in der Landes‑Zielsteuerungskommission führt der oder die Vorsitzende der Gesundheitsplattform gemäß §6 Abs5 gleichberechtigt mit dem oder der Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse (Co‑Vorsitz).
(9) Die Landes‑Zielsteuerungskommission hat sich eine Geschäftsordnung zu geben, in der insbesondere Vorgaben über die Einberufung der Sitzungen und die Festlegung der Tagesordnung zu normieren sind. Sie hat zu regeln, dass die Sitzungen gemeinsam vorzubereiten (Tagesordnung und Unterlagen) und einzuladen sind.
(10) Die Bestimmungen des §6 Abs2 und 4 sowie 9 bis 11 gelten sinngemäß.
§9
Aufgaben der Landes‑Zielsteuerungskommission
(1) Der Landes‑Zielsteuerungskommission obliegt die Erfüllung der Aufgaben gemäß §2 Abs4 und Abs5.
(2) In der Landes‑Zielsteuerungskommission erfolgt eine wechselseitige und rechtzeitige Information und Konsultation über Festlegungen zu wesentlichen operativen und finanziellen Angelegenheiten der Leistungserbringung im Gesundheitswesen von Land und Sozialversicherung.
(3) Die Prinzipien, Ziele und Handlungsfelder gemäß Art5 und Art6 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG Zielsteuerung-Gesundheit, LGBl 60/2017, die insbesondere in den Abschnitten 4 und 5 der genannten Vereinbarung festgelegt sind, sind bei der Erfüllung der Aufgaben einzuhalten.
(4) Bei Vereinbarung von Leistungsverschiebungen müssen Finanzierungs- und Verrechnungsmechanismen im Sinne des Art16 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG Zielsteuerung-Gesundheit, LGBl 60/2017, mit insbesondere folgenden Maßgaben enthalten sein:
1. Der Ausgangspunkt, von dem die Leistungsverschiebung aus gemessen wird, und das Leistungsvolumen (IST‑Stand) zu diesem Ausgangspunkt sind im Einzelfall festzulegen.
2. Auf Leistungen, die ein Vertragspartner vor dem Ausgangspunkt erbracht hat, obwohl ein anderer Vertragspartner zuständig gewesen wäre, ist bei der Verrechnung von Verschiebungen von Leistungen nach dem Ausgangspunkt Bedacht zu nehmen.
(5) Das vierjährige Landes-Zielsteuerungsübereinkommen ist von dem Vorsitzenden/von der Vorsitzenden und dem Co‑Vorsitzenden/der Co‑Vorsitzenden der Landes‑Zielsteuerungskommission für den jeweils eigenen Wirkungsbereich zu unterfertigen und ist binnen eines Monats ab Beschlussfassung der Bundesgesundheitsagentur zur Kenntnis zu bringen."
"§16
Regelungen zum Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG)
(1) Das zentrale Planungsinstrument für die integrative Versorgungsplanung in Niederösterreich ist der RSG, der auf dem Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) als österreichweit verbindlicher Rahmenplan aufbaut.
(2) Der RSG ist entsprechend den Vorgaben des ÖSG unter Berücksichtigung von dessen Inhalten, Planungshorizonten und Planungsrichtwerten kontinuierlich weiter zu entwickeln und regelmäßig zu revidieren.
(3) Schwerpunkte des RSG sind:
1. Festlegung der Kapazitätsplanungen standortbezogen für den akutstationären Bereich mit Angabe der Kapazitäten, Organisationsformen, Versorgungsstufen, Referenz‑, Spezial- und Expertisezentren je Fachbereich;
2. Festlegung der Kapazitätsplanungen für die ambulante Fachversorgung – soweit noch nicht vorliegend – gesamthaft bis Ende 2018 unter der Voraussetzung, dass die Grundlagen auf Bundesebene vorliegen, mit Angabe der Kapazitäten und Betriebsformen von Spitalsambulanzen sowie Versorgungstypen im ambulanten Bereich sowie Versorgungsaufträgen nach Fachbereichen auf Ebene der Versorgungsregionen (im Sinne des ÖSG) bzw bei Bedarf auch auf tieferen regionalen Ebenen;
3. Stärkung der Primärversorgung durch Ausbau von wohnortnahen multiprofessionellen und/oder interdisziplinären Versorgungsangeboten entsprechend Art6 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, LGBl 58/2017, und Bereinigung von Parallelstrukturen im Sinne der Art4 Abs5 und Art4 Abs7 Z3 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, LGBl 58/2017; Ergänzung des RSG durch Aufnahme der vorgesehenen Einrichtungen zu Primärversorgungseinheiten bis spätestens Ende 2018 unter der Voraussetzung, dass die Grundlagen auf Bundesebene vorliegen;
4. Abbildung der überregionalen Versorgungsplanung gemäß Art5 Abs3 Z9 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, LGBl 58/2017, inklusive Definition von Versorgungsgebieten je Standort;
5. Transparente Berücksichtigung der Versorgung inländischer und ausländischer Gastpatienten/Gastpatientinnen.
(4) Der RSG ist zwischen dem Land und der Sozialversicherung festzulegen, wobei der Bund bereits im Entwurfsstadium entsprechend zu informieren ist. Eine Abstimmung mit dem Bund vor Einbringung zur Beschlussfassung über das Vorliegen der Rechts- und ÖSG‑Konformität ist herbeizuführen.
(5) Bei Beschlussfassungen gemäß §2 Abs4 Z7 lita und b ist der Landesärztekammer und den betroffenen gesetzlichen Interessensvertretungen mindestens vier Wochen zuvor die Möglichkeit einer Stellungnahme einzuräumen, der Ärztekammer insbesondere hinsichtlich der Umsetzbarkeit im Stellenplan. Dazu sind die für die Beschlussfassung vorgesehen Planungsunterlagen zu übermitteln.
(6) Die Festlegungen im RSG sind hinsichtlich ihrer Umsetzung laufend zu überprüfen (RSG‑Monitoring). Dieses Monitoring ist inhaltlich so zu gestalten, dass es eine entsprechende Grundlage für das Monitoring im Rahmen der Zielsteuerung-Gesundheit bereitstellen kann.
§17
Verbindlicherklärung von Teilen des Österreichischen Strukturplanes
Gesundheit und des Regionalen Strukturplanes Gesundheit
(1) Die im Rahmen der Vollziehung des Landes für verbindlich zu erklärenden Teile des Österreichischen Strukturplanes Gesundheit oder des Regionalen Strukturplanes Gesundheit bzw deren Änderungen, soweit sie Angelegenheiten der Art12 und 15 B‑VG betreffen, sind von der Gesundheitsplanungs GmbH durch Verordnung für verbindlich zu erklären und im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS – www.ris.bka.gv.at ) kundzumachen. §23 Abs2 vierter und fünfter Satz des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I Nr 26/2017, ist sinngemäß anzuwenden.
(2) Die Tätigkeit der Gesundheitsplanungs GmbH unterliegt im Umfange des Abs1 der Aufsicht und den Weisungen der Landesregierung. Die Gesundheitsplanungs GmbH ist auf Verlangen der Landesregierung zur jederzeitigen Information verpflichtet."
6. §6a Oö. Krankenanstaltengesetz 1997 (Oö. KAG 1997), LGBl 132/1997, idF LGBl 125/2019 lautet (die in Prüfung gezogene Bestimmung ist hervorgehoben):
"2. UNTERABSCHNITT
Errichtungs- und Betriebsbewilligung für selbständige Ambulatorien
§6a
Errichtungsbewilligung
(1) Die Errichtung eines selbständigen Ambulatoriums bedarf, sofern §91 nicht anderes bestimmt, einer Bewilligung der Landesregierung.
(2) Der Antrag auf Erteilung der Errichtungsbewilligung hat den Anstaltszweck, die Bezeichnung der Anstalt und das in Aussicht genommene Leistungsangebot (Leistungsspektrum, Öffnungszeiten unter Berücksichtigung von Tagesrand- und Nachtzeiten, Sams‑, Sonn- und Feiertagen sowie Leistungsvolumen einschließlich vorgesehener Personalausstattung, insbesondere vorgesehene Anzahl von Ärzten bzw Zahnärzten) genau anzugeben. Dem Antrag sind folgende Unterlagen je in dreifacher Ausfertigung anzuschließen:
1. die zur Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Planunterlagen, wie Lagepläne, Baupläne, Baubeschreibungen und dgl.; für Inhalt und Planunterlagen gilt die Oö. Bautechnikverordnung sinngemäß;
2. ein Verzeichnis, aus dem die Anzahl der Anstaltsräume, getrennt nach ihrem Verwendungszweck, sowie die Größe der Bodenfläche und des Luftraums dieser Räume ersichtlich ist;
3. Pläne und Beschreibungen für die medizinisch-technischen Apparate und technischen Einrichtungen.
(3) Eine Vorabfeststellung zu den Voraussetzungen des Abs5 Z1 ist zulässig. In diesem Verfahren ist die Vorlage von Unterlagen zum Nachweis der Voraussetzungen nach Abs5 Z2, 3, 4 und 6 nicht erforderlich.
(4) In Verfahren zur Erteilung der Bewilligung zur Errichtung eines selbständigen Ambulatoriums und zur Vorabfeststellung des Bedarfs haben hinsichtlich des nach Abs5 in Verbindung mit Abs6 zu prüfenden Bedarfs – ausgenommen im Fall des Abs7 – Parteistellung im Sinn des §8 AVG und das Recht der Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht gemäß Art132 Abs5 B‑VG und gegen Erkenntnisse und Beschlüsse des Landesverwaltungsgerichts das Recht auf Revision an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art133 Abs1 B‑VG:
1. die Wirtschaftskammer Oberösterreich als gesetzliche Interessenvertretung der privaten Krankenanstalten;
2. die betroffenen Sozialversicherungsträger;
3. die Ärztekammer für Oberösterreich und
4. bei Zahnambulatorien auch die Österreichische Zahnärztekammer.
(5) Die Errichtungsbewilligung darf nur erteilt werden, wenn
1. nach dem angegebenen Anstaltszweck und dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot im Hinblick auf das in angemessener Entfernung bereits bestehende Versorgungsangebot öffentlicher, privater gemeinnütziger und sonstiger Krankenanstalten mit Kassenverträgen sowie auch im Hinblick auf das Versorgungsangebot durch Ambulanzen der genannten Krankenanstalten und kasseneigene Einrichtungen, niedergelassene Ärzte, Gruppenpraxen und selbständige Ambulatorien, soweit sie sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen, bei selbständigen Zahnambulatorien auch im Hinblick auf niedergelassene Zahnärzte, Dentisten und zahnärztliche Gruppenpraxen, soweit sie sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen,
a) zur Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und allgemein zugänglichen Gesundheitsversorgung und
b) zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit
eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann,
2. das Eigentum an der für das selbständige Ambulatorium vorgesehenen Betriebsanlage oder das sonstige Recht zu deren Benützung nachgewiesen wird,
3. das Gebäude, das als Betriebsanlage dienen soll, den für solche Gebäude geltenden bau‑, feuer‑, sicherheits- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften entspricht,
4. die vorgesehene Ausstattung mit medizinisch-technischen Apparaten den nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft an ein selbständiges Ambulatorium der vorgesehenen Art zu stellenden Anforderungen entspricht,
5. eine den Grundsätzen und anerkannten Methoden der medizinischen Wissenschaft entsprechende ärztliche bzw zahnärztliche Behandlung gewährleistet ist, und
6. gegen den Bewilligungswerber keine Bedenken bestehen; Bedenken sind dann gegeben, wenn er vorbestraft ist und nach der Art der Vorstrafe ein einwandfreier Betrieb nicht zu erwarten ist oder wenn sonstige Umstände, zB im Hinblick auf seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie sein Vorleben, vorliegen, die seine Eignung ausschließen.
(5a) Sofern ein Vertragsvergabeverfahren der Sozialversicherung über den verfahrensgegenständlichen Leistungsumfang anhängig ist oder innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Entscheidung der Landesregierung über den Bedarf eingeleitet wird, ist Voraussetzung für die Erteilung der Errichtungsbewilligung darüber hinaus auch eine Vertragszusage der Sozialversicherung auf Grund dieses Vertragsvergabeverfahrens. Bis zum Feststehen des Ergebnisses eines allfälligen Vertragsvergabeverfahrens der Sozialversicherung über das verfahrensgegenständliche Leistungsspektrum ist das Verfahren zur Erteilung der Errichtungsbewilligung zu unterbrechen.
(6) Bei der Beurteilung, ob eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann, sind ausgehend von den Ergebnissen der Planungen des Österreichischen Strukturplanes Gesundheit (ÖSG) folgende Kriterien zu berücksichtigen:
1. örtliche Verhältnisse (Bevölkerungsstruktur und Besiedelungsdichte);
2. die für die Versorgung bedeutsamen Verkehrsverbindungen;
3. das Inanspruchnahmeverhalten und die Auslastung von bestehenden Leistungsanbietern, die sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen, durch Patienten;
4. die durchschnittliche Belastung bestehender Leistungsanbieter gemäß Z3 und
5. die Entwicklungstendenzen in der Medizin bzw Zahnmedizin.
(6a) Wenn der verfahrensgegenständliche Leistungsumfang in den Verordnungen gemäß §23 des Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetzes geregelt ist, ist hinsichtlich des Bedarfs die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen. Ist das Vorhaben nicht in den genannten Verordnungen geregelt, ist Abs6 anzuwenden.
(7) Die Landesregierung hat von einer Prüfung nach Abs5 Z1 in Verbindung mit Abs6 abzusehen, wenn nach dem vorgesehenen Leistungsangebot im selbständigen Ambulatorium ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen erbracht werden sollen. Die Österreichische Gesundheitskasse ist zur Frage, ob es sich beim Leistungsangebot um ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen handelt, zu hören. Darüber hinaus ist von einer Prüfung nach Abs5 Z1 in Verbindung mit Abs6 abzusehen, wenn bereits eine Errichtungsbewilligung erteilt wurde und die Verlegung des Standorts innerhalb desselben Einzugsgebiets erfolgt.
(8) Im Bewilligungsverfahren bzw Verfahren zur Vorabfeststellung kann eine Stellungnahme des Landessanitätsrats eingeholt werden. Weiters ist ein Gutachten der Gesundheit Österreich GesmbH oder eines vergleichbaren Gesundheitsplanungsinstituts sowie eine begründete Stellungnahme des Oö. Gesundheitsfonds zum Vorliegen der Kriterien gemäß Abs6 einzuholen.
(9) Die Errichtungsbewilligung ist mit Auflagen oder unter Bedingungen zu erteilen, soweit dies zur Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs5 und zur Gewährleistung einer den Grundsätzen und anerkannten Methoden der medizinischen Wissenschaft entsprechenden ärztlichen bzw zahnärztlichen Behandlung oder aus anderen öffentlichen Interessen, insbesondere im Interesse der bestmöglichen gesundheitlichen Betreuung der Bevölkerung, erforderlich ist.
(10) Die Errichtungsbewilligung hat – ausgenommen im Fall des Abs7 – im Rahmen des Antrags jedenfalls das Leistungsvolumen, das Leistungsspektrum und bedarfsgerechte Öffnungszeiten (Berücksichtigung von Tagesrand- und Nachtzeiten und von Sams‑, Sonn- und Feiertagen) sowie erforderlichenfalls Bereitschaftszeiten und – soweit sinnvoll – die Verpflichtung zur Durchführung von Hausbesuchen durch Auflagen festzulegen.
(11) Die Bewilligung zur Errichtung eines selbständigen Ambulatoriums durch einen Krankenversicherungsträger ist zu erteilen, wenn ein Einvernehmen zwischen dem Krankenversicherungsträger und der Ärztekammer für Oberösterreich bzw der Österreichischen Zahnärztekammer oder zwischen dem Dachverband der Sozialversicherungsträger und der Österreichischen Ärztekammer bzw der Österreichischen Zahnärztekammer im Sinn des §339 ASVG vorliegt. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn ein Auswahlverfahren für Primärversorgungseinheiten nach §14 des Primärversorgungsgesetzes zu keinem positiven Abschluss geführt hat. Liegt ein Einvernehmen nicht vor, so ist die Errichtungsbewilligung zu erteilen, wenn die Landesregierung festgestellt hat, dass eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann. Die obigen Bestimmungen gelten auch dann, wenn der Krankenversicherungsträger Dritte mit dem Betrieb eines selbständigen Ambulatoriums betraut.
(11a) Einer Beschwerde der Ärztekammer für Oberösterreich an das Landesverwaltungsgericht und einer Revision der Ärztekammer für Oberösterreich an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Abs4 kommt in Verfahren zur Erteilung der Errichtungsbewilligung für eine eigene Einrichtung für Zwecke der Primärversorgung eines gesetzlichen Krankenversicherungsträgers gemäß §339 ASVG keine aufschiebende Wirkung zu.
(12) Wenn nicht binnen drei Jahren ab Erteilung der Errichtungsbewilligung mit der Errichtung des selbständigen Ambulatoriums begonnen wird, kann die Landesregierung die Errichtungsbewilligung zurücknehmen, sofern die Zurücknahme im Interesse der Sicherstellung einer dem Bedarf entsprechenden Krankenanstaltspflege geboten ist."
7. Die §§17a und 17b Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, LGBl 83/2013, idF LGBl 96/2017 lauten (die in Prüfung gezogenen Bestimmungen sind hervorgehoben):
"2. UNTERABSCHNITT
REGIONALER STRUKTURPLAN GESUNDHEIT
§17a
Erstellung des Regionalen Strukturplans Gesundheit
(1) Das Land hat gemeinsam mit der Sozialversicherung einen Regionalen Strukturplan Gesundheit entsprechend den Vorgaben des Österreichischen Strukturplans Gesundheit (ÖSG) bezüglich Inhalten, Planungshorizonten und Planungsrichtwerten festzulegen und der Landes‑Zielsteuerungskommission zur Beschlussfassung vorzulegen. Vor Einbringung zur Beschlussfassung ist mit dem Bund insbesondere das Vorliegen der Rechts- und ÖSG‑Konformität abzustimmen. Dazu ist der Bund bereits im Entwurfsstadium des Regionalen Strukturplans Gesundheit entsprechend zu informieren.
(2) Der Ärztekammer für Oberösterreich und den betroffenen gesetzlichen Interessenvertretungen ist frühzeitig und strukturiert – mindestens vier Wochen vor Beschlussfassung einer den Regionalen Strukturplan Gesundheit betreffenden Angelegenheit in der Landes‑Zielsteuerungskommission – die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen, der Ärztekammer insbesondere hinsichtlich der Umsetzbarkeit im Stellenplan (§342 Abs1 Z1 ASVG). Dazu sind die für die Beschlussfassung vorgesehenen Planungsunterlagen zu übermitteln.
(3) Die Landes‑Zielsteuerungskommission hat jene Planungsvorgaben des Regionalen Strukturplans Gesundheit, die rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen, dazu zählen insbesondere Festlegungen zur Kapazitätsplanung sowie die überregionale Versorgungsplanung, als solche auszuweisen. Die Planungsvorgaben sind jedenfalls so konkret festzulegen, dass sie für die Bedarfsprüfung im Errichtungsbewilligungsverfahren bzw Verfahren zur Vorabfeststellung des Bedarfs nach dem Oö. KAG 1997 herangezogen werden können. Dabei ist auch der Beginn der verbindlichen Wirkung festzulegen, wobei entsprechende Umsetzungsfristen zu berücksichtigen sind.
(4) Die auf der Grundlage des §23 Abs3 des Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetzes, BGBl I Nr 26/2017, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 131/2017, eingerichtete Gesundheitsplanungs GmbH wird ermächtigt, jene von der Bundes‑Zielsteuerungskommission als normativ gekennzeichneten Teile des ÖSG und jene von der Landes‑Zielsteuerungskommission als normativ gekennzeichneten Teile des Regionalen Strukturplans Gesundheit, insoweit die jeweils ausgewiesenen Teile Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG betreffen, durch Verordnung zu erlassen und im RIS kundzumachen. Jene Teile, die rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen, sind von der Gesundheitsplanungs GmbH vorab einem allgemeinen, als solches ausgewiesenen Begutachtungsverfahren zu unterziehen. Ergeben sich nach der Begutachtung Änderungen ist eine nochmalige Beschlussfassung in der Bundes‑Zielsteuerungskommission (ÖSG) bzw in der Landes‑Zielsteuerungskommission (Regionaler Strukturplan Gesundheit) herbeizuführen.
(5) Die Tätigkeit der Gesundheitsplanungs GmbH unterliegt im Umfang des Abs4 der Aufsicht und den Weisungen der Landesregierung. Sie ist auf Verlangen der Landesregierung zur jederzeitigen Information verpflichtet.
§17b
Inhalte des Regionalen Strukturplans Gesundheit
(1) Das Land hat in Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG sicherzustellen, dass der Regionale Strukturplan Gesundheit jedenfalls folgende Inhalte umfasst:
1. Festlegung der Kapazitätsplanungen standortbezogen für den akutstationären Bereich mit Angabe der Kapazitäten, Organisationsformen, Versorgungsstufen, Referenz‑, Spezial- und Expertisezentren je Fachbereich (im Sinn des ÖSG);
2. Festlegung der Kapazitätsplanungen für die ambulante Versorgung für die Leistungserbringer im Sinn des §18 Abs1 Z1 des Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetzes, BGBl I Nr 26/2017, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 131/2017, gesamthaft mit Angabe der Kapazitäten und Betriebsformen von Spitalsambulanzen sowie Versorgungstypen im ambulanten Bereich sowie Versorgungsaufträgen nach Fachbereichen auf Ebene der Versorgungsregionen (im Sinn des ÖSG);
3. Stärkung der Primärversorgung durch Ausbau von wohnortnahen multiprofessionellen bzw interdisziplinären Versorgungsangeboten entsprechend Art6 der Vereinbarung sowie §18 Abs7 Z2 des Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetzes, BGBl I Nr 26/2017, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 131/2017, und Bereinigung von Parallelstrukturen; beim Ausbau der Primärversorgung nach dem Primärversorgungsgesetz, BGBl I Nr 131/2017, ist, um den unterschiedlichen Versorgungsbedürfnissen der Bevölkerung nachkommen zu können, im Hinblick auf das im Art31 Abs1 letzter Satz der Vereinbarung genannte Planungsziel ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Versorgungsangeboten 'Netzwerk' und 'Zentrum' sicherzustellen;
4. Abbildung der überregionalen Versorgungsplanung gemäß Art5 Abs3 Z9 der Vereinbarung inklusive Definition von Versorgungsgebieten je Standort;
5. Transparente Berücksichtigung der Versorgung inländischer und ausländischer Gastpatientinnen und Gastpatienten.
(2) Das Land hat in Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG darauf zu achten, dass die Kapazitätsplanung für den gesamten ambulanten Bereich im Regionalen Strukturplan Gesundheit insbesondere auf die Stärkung der ambulanten Versorgung durch Ausbau von wohnortnahen, multiprofessionellen bzw interdisziplinären Versorgungsangeboten und die Bereinigung von Parallelstrukturen abzielt.
(3) Der Regionale Strukturplan Gesundheit ist entsprechend den Vorgaben des ÖSG bezüglich Inhalten, Planungshorizonten und Planungsrichtwerten kontinuierlich weiterzuentwickeln und regelmäßig zu revidieren.
(4) Der Landeshauptmann hat die jeweils aktuelle Fassung des Regionalen Strukturplans Gesundheit auf der Homepage des Landes Oberösterreich zu veröffentlichen."
8. Die §§5, 5a und 7 Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 (Wr. KAG), LGBl 23/1987, idF LGBl 10/2018 (§5a) und LGBl 49/2019 (§5 und §7) lauten:
"Errichtung von selbständigen Ambulatorien
§5.
(1) Selbständige Ambulatorien bedürfen, sofern §64i nicht anderes bestimmt, sowohl zu ihrer Errichtung als auch zu ihrem Betrieb einer Bewilligung der Landesregierung. Anträge auf Erteilung der Bewilligung zur Errichtung haben den Anstaltszweck und das in Aussicht genommene Leistungsangebot (Leistungsspektrum, Öffnungszeiten unter Berücksichtigung von Tagesrand- und Nachtzeiten, Sams‑, Sonn- und Feiertagen sowie Leistungsvolumen einschließlich vorgesehener Personalausstattung, insbesondere vorgesehener Anzahl und vorgesehenes Beschäftigungsausmaß von Ärztinnen und Ärzten bzw Zahnärztinnen und Zahnärzten unter Angabe der Berufsberechtigung und vorgesehener Anzahl von Angehörigen anderer Gesundheitsberufe) genau zu bezeichnen. Eine Vorabfeststellung zu den Voraussetzungen des Abs3 ist zulässig.
(2) Die Bewilligung zur Errichtung einer Krankenanstalt im Sinne des Abs1 darf unbeschadet der nach sonstigen Rechtsvorschriften geltenden Erfordernisse nur unter den nach den Erfahrungen der medizinischen Wissenschaft und nach den Erfordernissen für einen einwandfreien Krankenanstaltsbetrieb notwendigen Bedingungen und Auflagen und nur dann erteilt werden, wenn insbesondere
1. nach dem angegebenen Anstaltszweck und dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot im Hinblick auf das bereits bestehende Versorgungsangebot öffentlicher, privater gemeinnütziger und sonstiger Krankenanstalten mit Kassenverträgen sowie auch im Hinblick auf das Versorgungsangebot durch Ambulanzen der genannten Krankenanstalten und kasseneigene Einrichtungen, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Gruppenpraxen und selbständige Ambulatorien, soweit sie sozialversicherungsrechtlich erstattungs fähige Leistungen erbringen, bei selbständigen Zahnambulatorien auch im Hinblick auf niedergelassene Zahnärztinnen, Zahnärzte, Dentistinnen, Dentisten und zahnärztliche Gruppenpraxen, soweit sie sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen,
a) zur Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und allgemein zugänglichen Gesundheitsversorgung und
b) zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit
eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann,
2. das Eigentumsrecht oder sonstige Rechte zur Benützung der für die Anstalt in Aussicht genommenen Betriebsanlage nachgewiesen sind,
3. das für die Unterbringung der Anstalt geplante oder bereits vorhandene Gebäude den hinsichtlich der Aufführung oder Verwendung solcher Gebäude vorgesehenen bau‑, feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften entspricht und
4. gegen die Bewerberin oder den Bewerber keine Bedenken bestehen.
Sofern ein Vertragsvergabeverfahren der Sozialversicherung über den verfahrensgegenständlichen Leistungsumfang anhängig ist oder innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Entscheidung der Landesregierung über den Bedarf eingeleitet wird, ist Voraussetzung für die Erteilung der Errichtungsbewilligung darüber hinaus auch eine Vertragszusage der Sozialversicherung auf Grund dieses Vertragsvergabeverfahrens.
(3) Bei der Beurteilung, ob eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann, sind ausgehend von den Ergebnissen der Planungen des jeweiligen RSG folgende Kriterien zu berücksichtigen:
1. örtliche Verhältnisse (regionale, rurale oder urbane Bevölkerungsstruktur, Besiedlungsdichte),
2. die für die Versorgung bedeutsamen Verkehrsverbindungen,
3. das Inanspruchnahmeverhalten und die Auslastung von bestehenden Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern, die sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen, durch Patientinnen und Patienten,
4. die durchschnittliche Belastung bestehender Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter gemäß Z3 und
5. die Entwicklungstendenzen in der Medizin bzw Zahnmedizin.
(3a) Wenn der verfahrensgegenständliche Leistungsumfang in den Verordnungen gemäß §23 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz – G‑ZG), BGBl I Nr 26/2017 in der Fassung BGBl I Nr 131/2017, oder §5a Abs1 geregelt ist, ist hinsichtlich des Bedarfs die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen. Die Entscheidung über die Plankonformität des Vorhabens hat mittels Feststellungsbescheid zu erfolgen. Ist das Vorhaben nicht in den genannten Verordnungen geregelt, ist Abs3 sinngemäß anzuwenden.
(4) Die Landesregierung hat von einer Prüfung nach Abs2 Z1 in Verbindung mit Abs3 abzusehen, wenn nach dem vorgesehenen Leistungsangebot im selbständigen Ambulatorium ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen erbracht werden sollen. Die betroffenen Sozialversicherungsträger und die Ärztekammer für Wien sind zur Frage, ob es sich beim Leistungsangebot um ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen handelt, zu hören. Darüber hinaus ist von der Prüfung des Bedarfes abzusehen, wenn bereits eine Errichtungsbewilligung erteilt wurde und die Verlegung des Standortes innerhalb desselben Einzugsgebietes erfolgt.
(5) Im Bewilligungsverfahren bzw Verfahren zur Vorabfeststellung ist ein Gutachten der Gesundheit Österreich GesmbH oder eines vergleichbaren Gesundheitsplanungsinstituts sowie eine begründete Stellungnahme des Wiener Gesundheitsfonds zum Vorliegen der Kriterien gemäß Abs3 einzuholen.
(6) Die Vorlage von Unterlagen zum Nachweis der Voraussetzungen nach Abs2 Z2 bis 4 ist nicht erforderlich, wenn eine gesonderte Vorabfeststellung zu den Voraussetzungen nach Abs3 beantragt wird.
(7) In der Errichtungsbewilligung sind – ausgenommen im Fall des Abs4 – im Rahmen des Antrags jedenfalls das Leistungsvolumen, das Leistungsspektrum und bedarfsgerechte Öffnungszeiten (Berücksichtigung von Tagesrand- und Nachtzeiten und von Sams‑, Sonn- und Feiertagen) sowie erforderlichenfalls Bereitschaftszeiten und – soweit sinnvoll – die Verpflichtung zur Durchführung von Hausbesuchen durch Auflagen festzulegen.
(8) In Verfahren zur Erteilung der Bewilligung zur Errichtung eines selbständigen Ambulatoriums – ausgenommen im Fall des Abs4 – haben betroffene Sozialversicherungsträger, die gesetzliche Interessenvertretung privater Krankenanstalten und die Ärztekammer für Wien bzw bei selbständigen Zahnambulatorien die Österreichische Zahnärztekammer hinsichtlich des Bedarfs Parteistellung im Sinne des §8 AVG und das Recht der Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien gemäß Art132 Abs5 B‑VG und gegen Erkenntnisse und Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Wien das Recht der Revision an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art133 Abs1 B‑VG. Dies gilt auch für Verfahren zur Vorabfeststellung zu den Voraussetzungen des Abs3.
(9) Die Errichtungsbewilligung für ein selbständiges Ambulatorium, dessen Rechtsträger ein Krankenversicherungsträger oder eine Krankenfürsorgeeinrichtung ist, ist zu erteilen, wenn ein Einvernehmen zwischen dem Krankenversicherungsträger oder der Krankenfürsorgeeinrichtung und der Ärztekammer für Wien bzw der Österreichischen Zahnärztekammer oder zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und der Österreichischen Ärztekammer bzw der Österreichischen Zahnärztekammer vorliegt (§339 ASVG). Liegt kein Einvernehmen vor, ist die Bewilligung zur Errichtung zu erteilen, wenn durch die Landesregierung festgestellt wurde, dass eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn ein Auswahlverfahren für Primärversorgungseinheiten nach §14 des Primärversorgungsgesetzes – PrimVG, BGBl I Nr 131/2017, zu keinem positiven Abschluss geführt hat. Der erste und zweite Satz gelten auch dann, wenn der Krankenversicherungsträger oder die Krankenfürsorgeeinrichtung Dritte mit dem Betrieb eines selbständigen Ambulatoriums betraut.
(10) Einer Beschwerde der Ärztekammer für Wien an das Verwaltungsgericht Wien und einer Revision der Ärztekammer für Wien an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Abs8 in Verfahren zur Erteilung der Errichtungsbewilligung für eine eigene Einrichtung für Zwecke der Primärversorgung eines gesetzlichen Krankenversicherungsträgers gemäß §339 ASVG kommt keine aufschiebende Wirkung zu.
§5a.
(1) Die Landesregierung hat in Fällen, in denen kein Einvernehmen über die verbindlich zu erklärenden Teile des RSG bzw deren Änderungen entsprechend den Bestimmungen im §9 Abs6 und §10 Abs2 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017, LGBl für Wien Nr 10/2018, in der Wiener Zielsteuerungskommission zustande kommt, auf Basis der gemeinsamen Festlegungen in der partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit im Rahmen eines RSG für Fondskrankenanstalten einen Wiener Krankenanstaltenplan durch Verordnung zu erlassen. Der Wiener Krankenanstaltenplan hat sich im Rahmen des Zielsteuerungsvertrages gemäß §10 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz – G‑ZG), BGBl I Nr 26/2017 in der Fassung BGBl I Nr 131/2017, und des Österreichischen Strukturplanes Gesundheit (ÖSG) zu befinden. Dabei sind, um eine verbindliche österreichweit auf einheitlichen Grundsätzen basierende Krankenanstaltenplanung mit integrierter Leistungsangebotsplanung zu gewährleisten, die im ÖSG vereinbarten Zielvorstellungen, Planungsgrundsätze und ‑methoden zu berücksichtigen.
(2) Im Wiener Krankenanstaltenplan sind jedenfalls festzulegen:
1. die Standorte der Fondskrankenanstalten,
2. die maximalen Gesamtbettenzahlen (für Normalpflege und Intensivbereich) je Standort,
3. die medizinischen Fachbereiche je Standort,
4. die für die Fachbereiche jeweils vorgesehenen fachrichtungsbezogenen Organisationsformen je Standort,
5. Art und Anzahl der medizinischtechnischen Großgeräte je Standort,
6. die maximale Bettenzahl je Fachbereich bezogen auf das Land und die Versorgungsregionen oder bezogen auf die Standorte,
7. die Referenzzentren und speziellen Versorgungsbereiche je Standort.
(3) Erfolgen die Festlegungen gemäß Abs2 Z6 nicht bezogen auf die Standorte, sind in Zusammenhang mit §4 Abs2b und 2c die zur Realisierung beabsichtigten Bettenkapazitäten je Fachbereich und Standort im Regionalen Strukturplan Gesundheit Wien zumindest unverbindlich mit Informationscharakter auszuweisen.
(4) Das Amt der Wiener Landesregierung hat den zwischen dem Land Wien und der Sozialversicherung im Wiener Gesundheitsfonds abgestimmten Regionalen Strukturplan Gesundheit Wien auf der Homepage www.wien.gv.at in der jeweils aktuellen Fassung zu veröffentlichen."
"Änderung von Krankenanstalten
§7
(1) Jede geplante räumliche Veränderung einer Krankenanstalt ist der Landesregierung anzuzeigen.
(2) Wesentliche Veränderungen, auch der apparativen Ausstattung oder des Leistungsangebotes, bedürfen der Bewilligung der Landesregierung. Im Verfahren darüber sind die §§4 und 5 sinngemäß anzuwenden. Die dem Bewilligungsbescheid entsprechend geänderte Anlage der Krankenanstalt darf in Betrieb genommen werden, doch ist darüber spätestens gleichzeitig mit der Inbetriebnahme vom Rechtsträger der Krankenanstalt bei der Landesregierung unter Angabe des Zeitpunktes der Inbetriebnahme die Anzeige zu erstatten. Dies gilt auch für selbständige Ambulatorien (§1 Abs3 Z5) der Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgeeinrichtungen. Bei wesentlichen Veränderungen von Krankenanstalten der Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgeeinrichtungen ist §6 sinngemäß anzuwenden.
(3) Die Verlegung einer Krankenanstalt an einen anderen Betriebsort bedarf einer Bewilligung der Landesregierung. Im Verfahren darüber sind die §§4, 5, 6 und 6a sinngemäß anzuwenden.
(4) Für die Erweiterung von Ambulatorien eines Krankenversicherungsträgers oder einer Krankenfürsorgeeinrichtung sind die §§5 Abs9 und 6a Abs2 sinngemäß anzuwenden.
(5) Bei Fondskrankenanstalten (§64a Abs1) ist die Bewilligung nach Abs2 und 3 insbesondere nur dann zu erteilen, wenn die Vorgaben des Landeskrankenanstaltenplanes bzw einer Verordnung gemäß §23 oder §24 des Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetzes und die darin vorgesehenen Strukturqualitätskriterien erfüllt sind."
9. Die §§1, 2 Abs1, 4, 7, 8, 9, 10 und 20 des Gesetzes über die Errichtung (Fortführung) eines Wiener Gesundheitsfonds 2017 (Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017), LGBl 10/2018, lauten (die in Prüfung gezogene Bestimmung ist hervorgehoben):
"Fortführung des Wiener Gesundheitsfonds
§1. (1) Zur Wahrnehmung der in diesem Landesgesetz umschriebenen Aufgaben, insbesondere der Planung, Steuerung und Finanzierung des Gesundheitswesens in Wien, wird der mit Landesgesetz LGBl für Wien Nr 42/2013 errichtete Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit, der die Bezeichnung 'Wiener Gesundheitsfonds' (WGF) trägt, fortgeführt.
(2) Der Aufgabenbereich des Fonds erstreckt sich – soweit es sich um finanzielle Zuwendungen an Krankenanstaltenträger handelt – auf die Wiener öffentlichen allgemeinen Krankenanstalten und Sonderkrankenanstalten, mit Ausnahme der Pflegeabteilungen in Krankenanstalten für Psychiatrie, und auf private allgemeine Krankenanstalten, sofern sie nach den Bestimmungen des Wiener Krankenanstaltengesetzes 1987 – Wr. KAG gemeinnützig geführt werden.
(3) Soweit es sich nicht um finanzielle Zuwendungen an Krankenanstaltenträger handelt (Abs2), erstreckt sich der Aufgabenbereich des Fonds auf alle Sektoren des Gesundheitswesens in Wien.
(4) Der Fonds hat sich bei seinen Maßnahmen an Public Health Grundsätzen zu orientieren. Dazu zählen insbesondere:
a) Orientierung an einem umfassenden Gesundheitsbegriff;
b) systematische Gesundheitsberichterstattung;
c) Weiterentwicklung der Organisation und der Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD);
d) Versorgungsforschung, um bedarfsorientierte Planung, Entwicklung und Evaluation zu gewährleisten;
e) Stärkung der Interdisziplinarität in der Versorgung sowie in der Forschung und Entwicklung mit der Zielsetzung, die Gesundheit für alle zu verbessern und die gesundheitlichen Ungleichheiten zu verringern.
Aufgaben des Wiener Gesundheitsfonds
§2. (1) Dem Wiener Gesundheitsfonds obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
1. Die Abgeltung von Leistungen der Krankenanstalten für Personen, für die ein Träger der gesetzlichen Krankenversicherung leistungspflichtig ist,
2. die Gewährung allfälliger Investitionszuschüsse an die Träger der im §1 Abs2 genannten Krankenanstalten,
3. die Adaptierung des vom Bund entwickelten 'leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierungssystems (LKF‑Modell)',
4. die Fortführung und Weiterentwicklung einer integrativen partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, insbesondere für die Struktur und Organisation der Gesundheitsversorgung unter Einbeziehung der Sozialversicherung als gleichberechtigten Partner in Wien, ausgehend von den vertraglichen Festlegungen auf Bundesebene (Zielsteuerungsvertrag), durch Landes‑Zielsteuerungsübereinkommen,
5. die Mitwirkung bei der Umsetzung und Kontrolle der Einhaltung von Qualitätsvorgaben für die Erbringung von intra- und extramuralen Gesundheitsleistungen,
6. die Darstellung des Budgetrahmens für die öffentlichen Ausgaben im intra- und extramuralen Bereich,
7. die Abstimmung der Inhalte sowie allfälliger Anpassungen, Wartungen und Weiterentwicklungen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien (Detailplanung zur Zielsteuerung-Gesundheit, zur integrierten Gesundheitsstrukturplanung und zum Österreichischen Strukturplan Gesundheit) bzw von Kapazitätsfestlegungen für die Erbringung von Gesundheitsleistungen in allen Sektoren des Gesundheitswesens, wobei die Qualitätsvorgaben gemäß Z5 zu berücksichtigen sind,
8. die Umsetzung von Modellen und Regelungen zur sektorenübergreifenden Finanzierung des ambulanten Bereichs sowie Umsetzung von leistungsorientierten Vergütungssystemen,
9. das Nahtstellenmanagement zwischen den verschiedenen Sektoren des Gesundheitswesens,
10. die Mitwirkung am Auf- und Ausbau der für das Gesundheitswesen maßgeblichen Informations- und Kommunikationstechnologien (wie ELGA, eCard, Telehealth, Telecare) auf Landesebene,
11. die Stärkung der Gesundheitsförderung,
12. die Gewährung von Zuschüssen für krankenhausentlastende Maßnahmen,
13. die Information über die Ressourcenplanung im Pflegebereich,
14. die Erstellung von Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen des Wiener Gesundheitsfonds,
15. sonstige Aufgaben, die dem Wiener Gesundheitsfonds durch das Land Wien übertragen werden,
16. die Evaluierung der von der Wiener Gesundheitsplattform auf Landesebene wahrgenommenen Aufgaben,
17. die (Weiter‑)Entwicklung der Gesundheitsziele (inklusive Strategien zur Umsetzung),
18. die Handhabung des Sanktionsmechanismus auf Landesebene gemäß Abs2 bis 5.
(2)‑(5) […]"
"Organisation des Wiener Gesundheitsfonds
§4. (1) Organe des Wiener Gesundheitsfonds sind die Wiener Gesundheitsplattform und die Wiener Zielsteuerungskommission.
(2) Auf Vorschlag der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden der Wiener Gesundheitsplattform wird von der Landesregierung eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer bestellt. Nähere Regelungen über die Aufgaben der Geschäftsführung sind in der von der Wiener Gesundheitsplattform zu beschließenden Geschäftsordnung zu treffen.
(3) Zur Unterstützung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers ist beim Amt der Landesregierung eine Geschäftsstelle einzurichten. Die Beistellung der sachlichen und personellen Erfordernisse für die Geschäftsstelle obliegt dem Amt der Landesregierung. Der Fonds hat dem Land Wien die für die Beistellung der sachlichen und personellen Erfordernisse anfallenden Kosten zu ersetzen."
"Wiener Zielsteuerungskommission
§7. (1) Der Wiener Zielsteuerungskommission gehören die Kurie des Landes mit fünf Vertreterinnen und Vertretern, die Kurie der Träger der Sozialversicherung mit fünf Vertreterinnen und Vertretern sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bundes an. Bei der Vertretung der Sozialversicherung ist auf die Wahrung der aus der Selbstverwaltung erfließenden Rechte zu achten.
(2) Der Kurie des Landes gehören die für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständige amtsführende Stadträtin oder der für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständige amtsführende Stadtrat an. Daneben werden drei Vertreterinnen und Vertreter des Landes von der für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständigen amtsführenden Stadträtin oder dem für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständigen amtsführenden Stadtrat entsandt. Eine Vertreterin oder ein Vertreter wird von der amtsführenden Stadträtin oder dem amtsführenden Stadtrat für die Finanzverwaltung entsandt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Sozialversicherung werden von der Sozialversicherung entsandt. Der Bund entsendet eine Vertreterin oder einen Vertreter.
(3) Die Funktion als Vertreterin oder Vertreter in der Wiener Zielsteuerungskommission ist ein unbesoldetes Ehrenamt.
(4) Ist die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern erforderlich, so hat das Amt der Landesregierung die nach Abs2 hiezu Berechtigten schriftlich dazu aufzufordern.
(5) Die Vertreterinnen und Vertreter werden auf die Dauer der Gesetzgebungsperiode des Wiener Landtages entsandt; nach dem Zusammentritt des neu gewählten Landtages ist eine neue Entsendung vorzunehmen. Bis dahin bleiben die bisherigen Vertreterinnen und Vertreter im Amt. Ihre neuerliche Entsendung ist zulässig.
(6) Die Abberufung aus der Funktion als Vertreterin oder Vertreter in der Wiener Zielsteuerungskommission erfolgt, wenn ein neuer Entsendungsvorschlag von den nach Abs2 hiezu Berechtigten erstattet worden ist.
(7) Den Vorsitz in der Wiener Zielsteuerungskommission führt die für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständige amtsführende Stadträtin oder der für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständige amtsführende Stadtrat gleichberechtigt mit der Obfrau oder dem Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse (Co‑Vorsitz).
(8) Zur Vorbereitung der Sitzungen der Wiener Zielsteuerungskommission ist ein Präsidium, bestehend aus der für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständigen amtsführenden Stadträtin oder dem für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständigen amtsführenden Stadtrat und der Obfrau oder dem Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse, einzurichten.
(9) Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Wiener Zielsteuerungskommission ist je eine gleichberechtigte Koordinatorin oder ein gleichberechtigter Koordinator vom Land und von der Sozialversicherung namhaft zu machen. Die Landes‑Koordinatorin oder der Landes‑Koordinator wird von der für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständigen amtsführenden Stadträtin oder dem für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständigen amtsführenden Stadtrat namhaft gemacht. Die Landes‑Koordinatorin oder der Landes‑Koordinator ist gleichberechtigt mit der von der Sozialversicherung namhaft gemachten Koordinatorin oder dem von der Sozialversicherung namhaft gemachten Koordinator für alle Angelegenheiten der Wiener Zielsteuerungskommission zuständig. Die Landes‑Koordinatorin oder der Landes‑Koordinator ist in dieser Funktion ausschließlich der für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständigen amtsführenden Stadträtin oder dem für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständigen amtsführenden Stadtrat in der Funktion als Co‑Vorsitz verantwortlich.
(10) Hinsichtlich der Beschlussfassung in der Wiener Zielsteuerungskommission gilt Folgendes:
1. Jede Kurie hat eine Stimme.
2. Die gemeinsamen Positionen zu den Themen der Wiener Zielsteuerungskommission sind innerhalb der Kurie des Landes zu akkordieren.
3. Die für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständige amtsführende Stadträtin oder der für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständige amtsführende Stadtrat hat die Stimmabgabe für die Kurie des Landes gemäß Z1 wahrzunehmen.
4. Für Beschlussfassungen ist Einvernehmen zwischen der Kurie des Landes und der Kurie der Träger der Sozialversicherung erforderlich.
5. Die Vertreterin oder der Vertreter des Bundes verfügt über ein Vetorecht gegen Beschlüsse, die gegen geltendes Recht, die geltenden Vereinbarungen gemäß Art15a B‑VG, den Zielsteuerungsvertrag oder gegen Beschlüsse der Organe der Bundesgesundheitsagentur verstoßen. Im Falle der Verhinderung der Vertreterin oder des Vertreters des Bundes an der Sitzungsteilnahme kann der Bund binnen einer Woche schriftlich und begründet sein Vetorecht einbringen.
(11) Die Wiener Zielsteuerungskommission hat sich ihre Geschäftsordnung selbst zu geben.
(12) Die Geschäftsordnung hat zu regeln, dass die Sitzungen gemeinsam vorzubereiten (Tagesordnung und Unterlagen) sind und zu diesen gemeinsam einzuladen ist.
Aufgaben der Wiener Zielsteuerungskommission
§8. (1) In der Wiener Zielsteuerungskommission sind vierjährige Landes‑Zielsteuerungsübereinkommen zu beschließen. Diese bilden die Grundlage und den Rahmen für die Aufgaben gemäß Abs2.
(2) In der Wiener Zielsteuerungskommission erfolgen zu nachstehenden Punkten Festlegungen (Beschlüsse):
1. Koordination, Abstimmungen und Festlegungen aller aus dem Zielsteuerungsvertrag und den Landes‑Zielsteuerungsübereinkommen inklusive Finanzzielsteuerung resultierenden Aufgaben,
2. Mitwirkung am bundesweiten Monitoring und Behandlung des Monitoringberichts,
3. Wahrnehmung von Agenden zum Sanktionsmechanismus gemäß §18 und Regelungen bei Nicht-Zustandekommen eines Landes‑Zielsteuerungsübereinkommens gemäß §19,
4. Umsetzung der Regelungen für vertragliche und gemeinsam von Sozialversicherung und Ländern zu verantwortende sektorenübergreifende Finanzierungs- und Verrechnungsmechanismen auf Landesebene (zB Spitalsambulanzen, Gruppenpraxen und niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte, tagesklinische Versorgung, innovative Versorgungsformen usw); Umsetzung von vereinbarten innovativen Modellen zur sektorenübergreifenden Finanzierung des ambulanten Bereichs,
5. Angelegenheiten des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien,
6. Angelegenheiten der Großgeräte intra- und extramural,
7. Strategie zur Gesundheitsförderung,
8. Entscheidung über die Verwendung der Mittel aus dem Gesundheitsförderungsfonds gemäß §3 Abs2,
9. Mitwirkung bei der Umsetzung von Qualitätsvorgaben für die Erbringung von intra- und extramuralen Gesundheitsleistungen,
10. Umsetzung von Vorgaben zum Nahtstellenmanagement,
11. Evaluierung der von der Wiener Zielsteuerungskommission wahrgenommenen Aufgaben.
(3) In der Wiener Zielsteuerungskommission erfolgt eine wechselseitige und rechtzeitige Information und Konsultation über Festlegungen zu wesentlichen operativen und finanziellen Angelegenheiten der Leistungserbringung im Gesundheitswesen von Land und Sozialversicherung.
Regionaler Strukturplan Gesundheit Wien (RSG)
§9. (1) Der Regionale Strukturplan Gesundheit Wien (RSG) ist in der Wiener Zielsteuerungskommission entsprechend den Vorgaben des Österreichischen Strukturplanes Gesundheit (ÖSG) bezüglich Inhalten, Planungshorizonten und Planungsrichtwerten kontinuierlich weiterzuentwickeln und regelmäßig zu revidieren.
(2) Der RSG hat jedenfalls Folgendes zu beinhalten:
1. Festlegung der Kapazitätsplanungen standortbezogen für den akutstationären Bereich mit Angabe der Kapazitäten, Organisationsformen, Versorgungsstufen, Referenz‑, Spezial- und Expertisezentren je Fachbereich (im Sinne des ÖSG);
2. Festlegung der Kapazitätsplanungen für die ambulante Versorgung für die Leistungserbringer (ambulanter Bereich der Sachleistung, d.h. niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte mit Kassenverträgen, Gruppenpraxen mit Kassenverträgen und sonstige in der Gesundheitsversorgung frei praktizierende Berufsgruppen mit Kassenverträgen, selbstständige Ambulatorien mit Kassenverträgen einschließlich der eigenen Einrichtungen der Versicherungsträger, Spitalsambulanzen) – soweit noch nicht vorliegend – gesamthaft mit Angabe der Kapazitäten und Betriebsformen von Spitalsambulanzen sowie Versorgungstypen im ambulanten Bereich sowie Versorgungsaufträgen nach Fachbereichen auf Ebene der Versorgungsregionen (im Sinne des ÖSG);
3. Stärkung der Primärversorgung durch Ausbau von wohnortnahen multiprofessionellen und/oder interdisziplinären Versorgungsangeboten entsprechend Art6 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, LGBl für Wien Nr 29/2017, sowie insbesondere durch rasche flächendeckende Entwicklung von Primärversorgungsstrukturen und ambulanten Fachversorgungsstrukturen, wobei in der Umsetzung vor allem bestehende Vertragspartner berücksichtigt werden, und Bereinigung von Parallelstrukturen; beim Ausbau der Primärversorgung nach dem Primärversorgungsgesetz, BGBl I Nr 131/2017 (PrimVG) ist, um den unterschiedlichen Versorgungsbedürfnissen der Bevölkerung nachkommen zu können, im Hinblick auf das im Art31 Abs1 letzter Satz der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens genannte Planungsziel ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Versorgungsangeboten als Netzwerk oder Zentrum sicherzustellen;
4. Abbildung der überregionalen Versorgungsplanung für hochspezialisierte komplexe Leistungen von überregionaler Bedeutung in Form von Bedarfszahlen zu Kapazitäten sowie der Festlegung von Leistungsstandorten und deren jeweiliger Zuständigkeit für zugeordnete Versorgungsregionen, inklusive Definition von Versorgungsgebieten je Standort;
5. Transparente Berücksichtigung der Versorgung inländischer und ausländischer Gastpatientinnen und ‑patienten.
Dabei ist auf die Bestimmungen in Abs3 (Planung von Primärversorgungseinheiten) und Abs5 (Bedarfsfeststellung und regionale Planung von Kapazitäten für die multiprofessionelle und/oder interdisziplinäre ambulante Fachversorgung auf Basis von im ÖSG festgelegten Kriterien) des Art6 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, LGBl für Wien Nr 29/2017, sowie in §4 Abs2, 2b und 2c und §5 Abs2 und 3 Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 – Wr. KAG, LGBl für Wien Nr 23 in der Fassung LGBl für Wien Nr 10/2018, Bedacht zu nehmen.
(3) Bei der Kapazitätsplanung im RSG für den gesamten ambulanten Bereich ist darauf zu achten, dass diese insbesondere auf die Stärkung der ambulanten Versorgung durch Ausbau von wohnortnahen multiprofessionellen und/oder interdisziplinären Versorgungsangeboten und die Bereinigung von Parallelstrukturen abzielt.
(4) Der RSG ist gemäß der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, LGBl für Wien Nr 29/2017, auf Landesebene zwischen dem Land und der Sozialversicherung festzulegen. Der Bund ist bereits im Entwurfsstadium des RSG entsprechend zu informieren und es ist mit dem Bund vor Einbringung zur Beschlussfassung insbesondere das Vorliegen der Rechts- und ÖSG‑Konformität abzustimmen.
(5) Der Ärztekammer für Wien und den betroffenen gesetzlichen Interessensvertretungen ist frühzeitig und strukturiert mindestens aber vier Wochen vor Beschlussfassung des RSG in der Wiener Zielsteuerungskommission die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen, der Ärztekammer für Wien insbesondere hinsichtlich der Umsetzbarkeit im Stellenplan (§342 Abs1 Z1 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG, BGBl Nr 189/1955 in der Fassung BGBl I Nr 131/2017). Dazu sind die für die Beschlussfassung vorgesehenen Planungsunterlagen zu übermitteln.
(6) Die Wiener Zielsteuerungskommission hat die Planungsvorgaben des RSG, die Angelegenheiten des Art12 B‑VG betreffen und rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen, dazu zählen insbesondere Festlegungen zur Kapazitätsplanung sowie die überregionale Versorgungsplanung, als solche auszuweisen. Die Planungsvorgaben sind jedenfalls so konkret festzulegen, dass sie für die Bedarfsprüfung in Bewilligungsverfahren nach dem Wr. KAG herangezogen werden können.
Verbindlichkeitserklärung von Inhalten des Österreichischen Strukturplans
Gesundheit und des Regionalen Strukturplans Gesundheit Wien
§10. (1) Die Gesundheitsplanungs GmbH gemäß §23 Abs3 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz-G‑ZG), BGBl I Nr 26/2017 in der Fassung BGBl I Nr 131/2017, wird ermächtigt, die von der Bundes‑Zielsteuerungskommission nach §23 Abs1 G‑ZG ausgewiesenen Teile des ÖSG, soweit diese das Land Wien betreffen, und die nach §9 Abs6 ausgewiesenen Teile des RSG – jeweils insoweit dies Angelegenheiten gemäß Art12 B‑VG betrifft – durch Verordnung als verbindlich zu erklären.
(2) Jene Teile des RSG, die nach §9 Abs6 rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen, sind von der Gesundheitsplanungs GmbH vorab einem allgemeinen, als solches ausgewiesenen, Begutachtungsverfahren zu unterziehen. Ergeben sich nach der Begutachtung Änderungen, ist über die geänderten Teile des RSG eine nochmalige Beschlussfassung in der Wiener Zielsteuerungskommission herbeizuführen.
(3) Die Tätigkeit der Gesundheitsplanungs GmbH unterliegt – insoweit Angelegenheiten des Art12 B‑VG berührt sind – der Aufsicht und den Weisungen der Landesregierung. Die Gesundheitsplanungs GmbH ist auf Verlangen der Landesregierung zur jederzeitigen Information verpflichtet.
(4) In Fällen, in denen kein Einvernehmen über die verbindlich zu erklärenden Teile des RSG gemäß §9 Abs6 bzw deren Änderung gemäß Abs2 in der Wiener Zielsteuerungskommission zustande kommt, ist hinsichtlich der Erlassung eines Wiener Krankenanstaltenplans §5a Abs1 Wiener Krankenanstaltengesetz 1987, LGBl für Wien Nr 23/1987 in der Fassung LGBl für Wien Nr 10/2018, anzuwenden."
"Aufsicht über den Wiener Gesundheitsfonds
§20. (1) Der Wiener Gesundheitsfonds untersteht der Aufsicht der Landesregierung.
(2) Der Wiener Gesundheitsfonds ist verpflichtet, der Landesregierung auf Verlangen alle zur Wahrnehmung der Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
(3) Die Landesregierung kann im Einzelfall die Beschlüsse und Richtlinien der Wiener Gesundheitsplattform und der Wiener Zielsteuerungskommission anfordern. Die Wiener Gesundheitsplattform und die Wiener Zielsteuerungskommission haben der Landesregierung auf Verlangen die Beschlüsse und Richtlinien vorzulegen.
(4) Die Landesregierung hat Beschlüsse und Richtlinien der Wiener Gesundheitsplattform und der Wiener Zielsteuerungskommission, die gegen dieses Gesetz oder gegen die Geschäftsordnung der Wiener Gesundheitsplattform oder gegen die Geschäftsordnung der Wiener Zielsteuerungskommission verstoßen, aufzuheben.
(5) Der Wiener Gesundheitsfonds hat der Landesregierung jährlich jeweils nach Genehmigung des Jahresabschlusses Bericht über seine Tätigkeit zu erstatten."
10. Die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), am 9. Juli 2018 kundgemacht unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), lautete auszugsweise samt Anlage 2 (ohne die weiteren Anlagen) wie folgt (die in Prüfung gezogenen Bestimmungen sind hervorgehoben):
"Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018)
Aufgrund des
- §23 Abs1 und 4 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I Nr 26/2017, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr 131/2017,
- §15 Abs4 des Burgenländischen Gesundheitswesengesetzes 2017, LGBl Nr 6/2018,
- §15b Abs1 des Kärntner Gesundheitsfondsgesetzes, LGBl Nr 67/2013, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl Nr 69/2017,
- §17 Abs1 des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds-Gesetzes 2006, LGBl 9450, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl Nr 92/2017,
- §17a Abs4 des Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetzes 2013, LGBl Nr 83/2013, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl Nr 96/2017,
- §4 Abs1 des Salzburger Krankenanstaltengesetzes 2000, LGBl Nr 24/2000, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl Nr 43/2018,
- §23 Abs5 des Steiermärkisches Gesundheitsfondsgesetzes 2017, LGBl Nr 2/2018,
- §62a Abs2 des Tiroler Krankenanstaltengesetzes, LGBl Nr 5/1958, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl Nr 7/2018,
- §42 Abs1 des Gesetzes über die Errichtung eines Gesundheitsfonds für das Land Vorarlberg, LGBl Nr 45/2013, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl Nr 11/2018, und
- §10 Abs1 des Gesetzes, mit dem das Gesetz über die Errichtung (Fortführung) eines Wiener Gesundheitsfonds 2017 (Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017) erlassen wird, LGBl Nr 10/2018,
- werden die von der Bundes‑Zielsteuerungskommission am 30. Juni 2017, zuletzt geändert mit Beschluss der Bundes‑Zielsteuerungskommission vom 29. Juni 2018, im Österreichischen Strukturplan Gesundheit 2017 (ÖSG 2017) als verbindlich zu machende ausgewiesene Teile verordnet:
[…]
Festlegungen zum Großgeräteplan
§4. (1) Im bundesweiten Großgeräteplan (GGP) werden die medizinisch-technischen Großgeräte festgelegt, die der öffentlichen Versorgung dienen. Der Großgeräteplan enthält die bundesweit sowie je Bundesland jeweils erforderliche Anzahl der Großgeräte und umfasst folgende Großgeräte:
1. Computertomographiegeräte (CT)
2. Magnetresonanz-Tomographiegeräte (MR)
3. Emissions‑Computer-Tomographiegeräte (ECT; inkl. ECT‑CT)
4. Coronarangiographische Arbeitsplätze (Herzkatheterarbeitsplätze) (COR)
5. Strahlen- bzw Hochvolttherapiegeräte (STR) (Linearbeschleuniger)
6. Positronen‑Emissions-Tomographiegeräte (PET; inkl. PET‑CT, PET‑MR)
(2) Die in Anlage 2 enthaltenen Festlegungen zum Großgeräteplan umfassen für die Großgeräte gemäß Abs1,
1. die bundesländerspezifische und österreichweite Gesamtanzahl und die Standorte in über Landesgesundheitsfonds abgerechnete Krankenanstalten (Fonds-Krankenanstalten) und
2. die bundesländerspezifische und österreichweite Gesamtzahl und die Gesamtzahl je Versorgungsregion in sonstigen Akut‑Krankenanstalten, Rehabilitationszentren und im extramuralen Sektor (selbstständige Ambulatorien inklusive eigene Einrichtungen der Sozialversicherungsträger und niedergelassener Bereich).
(3) Anlage 2 enthält jene Großgeräte, die zum Stichtag 30. Juni 2017 bereits öffentlich finanziert wurden (Status quo) beziehungsweise in Zukunft öffentlich finanziert werden sollen. Öffentlich finanzierte Großgeräte sind solche, deren Betreiberin/Betreiber über einen Kassenvertrag verfügt oder für deren Leistungen durch die Sozialversicherung Kostenerstattungen an Anspruchsberechtigte erfolgen.
(4) Die in Anlage 2 festgelegten Kapazitäten sind – sofern in Anlage 2 nichts Abweichendes vorgesehen ist – bis 2020 zu realisieren.
(5) Änderungen des Großgeräteplans basieren auf folgenden Planungskriterien:
1. Sicherstellung einer regional möglichst ausgewogenen Verteilung der Versorgungsangebote (Versorgungskriterium) insbesondere durch:
a) Berücksichtigung der im ÖSG 2017 festgelegten Planungsrichtwerte für Großgeräte sowie des Versorgungsbedarfs von Gastpatientinnen und ‑patienten und Pendlerinnen/Pendlern,
b) örtlich gut erreichbare und mit anderen Gesundheitsversorgungseinrichtungen gut vernetzte Standorte und
c) im Falle der Versorgung ambulanter Patientinnen und Patienten entsprechende Öffnungs‑/Betriebszeiten auch an Tagesrandzeiten.
2. Sicherstellung der für die Erfüllung der Versorgungsaufträge der Fonds‑Krankenanstalten erforderlichen Vorhaltung von Großgeräten (Vorrangkriterium).
3. Sofern aus gesundheitsplanerischer Sicht keine vollständige Auslastung des Großgeräts in der Fonds-Krankenanstalt zu erwarten ist, ist zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit unter Berücksichtigung von gesamtwirtschaftlichen Erwägungen gemäß Z4 vorzusehen, dass dieses Großgerät zusätzlich auch zur Abdeckung eines ungedeckten extramuralen Versorgungsauftrages in der Versorgungsregion verwendet wird, wobei für solche Fälle – vor Abdeckung des extramuralen Versorgungsauftrages – zwingend eine entsprechende Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung mit der Sozialversicherung abzuschließen ist. Hinsichtlich der Grundzüge der Kooperationsvereinbarung (insbesondere Grundlagen und Methodik der Tarifierung) ist bereits vor der Änderung des Großgeräteplanes das Einvernehmen zwischen dem Landesgesundheitsfonds und der Sozialversicherung herzustellen.
4. Sicherstellung einer gesamtwirtschaftlich möglichst kostengünstigen Leistungserbringung bei gleichzeitiger Nutzung von Synergien (Kooperationen intra- und extramural) und Sicherstellung einer Mindestauslastung der Großgeräte (Wirtschaftlichkeitskriterium) nach Maßgabe des Abs6.
(6) Für Änderungen des Großgeräteplans sind das Versorgungskriterium und/oder das Vorrangkriterium zu erfüllen. Das Wirtschaftlichkeitskriterium kommt nur dann zusätzlich zur Anwendung, wenn eine Entscheidung zwischen zwei oder mehr Großgeräten zu treffen ist.
(7) Großgeräte, die ausschließlich intraoperativ, für die unmittelbar erforderliche Abklärung im Schockraum oder für Therapieplanung bzw‑überwachung bei Strahlentherapie zum Einsatz kommen (Funktionsgeräte) sowie Großgeräte in Universitätskliniken, die ausschließlich der universitären Lehre und Forschung dienen, sind von den verbindlichen Festlegungen zum Großgeräteplan nicht erfasst.
[…]
Inkrafttretens- und Schlussbestimmungen
§6. Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Kundmachung im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) in Kraft.
[…]
Diese Verordnung (ÖSG VO 2018) wurde mit Verordnung der Gesundheitspla-nungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Struktur-plans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019), am 5. November 2019 kundgemacht unter Nr 6/2019 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), mit Wirkung vom 6. November 2019 novelliert; Anlage 2 idF dieser Novelle lautete hinsichtlich Niederösterreich (§4 und die Oberösterreich betreffenden Teile der Anlage 2 wurden von dieser Novelle nicht berührt): "[…]
[…]"
Die ÖSG VO 2018 trat gemäß §6 Abs2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2020), am 18. Februar 2021 kundgemacht unter Nr 2/2021 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), mit Ablauf des 18. Februar 2021 außer Kraft.
11. Die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplans Gesundheit Wien 2017 (RSG Wien – VO 2019), am 8. Jänner 2020 kundgemacht unter Nr 1/2020 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), in Kraft getreten am 9. Jänner 2020, lautet samt Anlage 1 (ohne die weiteren Anlagen) wie folgt:
"Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von
Teilen des Regionalen Strukturplans Gesundheit Wien (RSG Wien – VO 2019)
Verbindlicherklärung
§1. (1) Aufgrund des §23 Abs4 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Ziel-steuerung-Gesundheit, BGBl I Nr 26/2017, zuletzt geändert durch das Bundesge-setz BGBl I Nr 100/2018 und §10 Abs1 des Gesetzes, mit dem das Gesetz über die Errichtung (Fortführung) eines Wiener Gesundheitsfonds 2017 (Wiener Gesundheitsfonds-Gesetz 2017) erlassen wird, LGBl Nr10/2018, werden folgende von der Wiener Landes‑Zielsteuerungskommission mit Beschluss vom 18.3.2019 und 7.6.2019 als verbindlich zu erklärend ausgewiesenen Teile des 'Regionalen Strukturplans Gesundheit Wien' verordnet:
1. Planung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Wien gemäß Anlage 1
2. Planung von Primärversorgungseinheiten in Wien gemäß Anlagen 2a und 2b
3. Planung des akutstationären Bereichs in Wien gemäß Anlage 3
(2) Für die Bedeutung der in dieser Verordnung verwendeten Abkürzungen ist das Abkürzungsverzeichnis gemäß Anlage 4 maßgebend.
(3) Das Umsetzungsziel für die geplante ambulante ärztliche Versorgung und für die Planung von Primärversorgungseinheiten ist das Jahr 2025.
(4) Das Umsetzungsziel für den geplanten akutstationären Bereich ist das Jahr 2020.
Inkrafttreten
§2. Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
[…]
12. Die §§84a und 338 Abs2a des Bundesgesetzes vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG.), BGBl 189/1955, idF BGBl I 100/2018 (§84a) und BGBl I 32/2022 (§338 Abs2a) lauten:
"7. UNTERABSCHNITT
Mitwirkung und Beteiligung der Sozialversicherung an der Planung und
Steuerung des Gesundheitswesens sowie an der Zielsteuerung-Gesundheit
Grundsätze
§84a. (1) Zur nachhaltigen Sicherstellung der Versorgung der Versicherten haben sich der Dachverband und die Sozialversicherungsträger unter Einbeziehung von wissenschaftlichen (insbesondere gesundheitsökonomischen) Erkenntnissen an einer regionen- und sektorenübergreifenden Planung im Sinne des 6. Abschnitts des Gesundheits-Zielsteuerungsgesetzes, Steuerung und Finanzierung des Gesundheitswesens zu beteiligen. Die Vertragsparteien nach dem Sechsten Teil haben die dabei abgestimmten Planungsergebnisse (zB Österreichischer Struktur-plan Gesundheit, Regionale Strukturpläne Gesundheit) in ihrem Verwaltungshandeln und bei der Planung und Umsetzung der Versorgung der Versicherten mit dem Ziel eines optimierten Mitteleinsatzes zu beachten.
(2) Der Dachverband hat jeweils Vertreterinnen/Vertreter nach Maßgabe
1. des §26 Abs1 G‑ZG in die Bundes‑Zielsteuerungskommission,
2. des §27 Abs2 G‑ZG in den ständigen Koordinierungsausschuss
3. des §29 Abs1 G‑ZG in die jeweiligen Gesundheitsplattformen im Rahmen der Landesgesundheitsfonds sowie
4. des §30 Abs2 Z4 G‑ZG in die Bundesgesundheitskommission,
zu entsenden.
(3) Die gesetzlichen Krankenversicherungsträger haben nach §29 Abs2 und 3 G‑ZG Vertreter/innen in die Gesundheitsplattform sowie in die Landes-Zielsteuerungskommission des jeweiligen Landesgesundheitsfonds zu entsenden. Demzufolge haben die gesetzlichen Krankenversicherungsträger jeweils insgesamt fünf Vertreter/innen in die Gesundheitsplattformen und die Landes-Zielsteuerungskommissionen der Landesgesundheitsfonds zu entsenden, und zwar vier Vertreter/in der Österreichischen Gesundheitskasse, wovon drei Vertreter/innen vom jeweiligen Landesstellenausschuss zu nominieren sind, darunter jedenfalls der/die Vorsitzende des Landesstellenausschusses und der/die Stellvertreter/in des Vorsitzenden, und ein/e Vertreter/in der Sonderversicherungsträger je Bundesland. Bei der Entsendung von Vertretern/Vertreterinnen und der Wahrnehmung der Aufgaben ist auf die Wahrung der aus der Selbstverwaltung erfließenden Rechte zu achten.
(4) Die Sozialversicherungsträger haben für Reformpoolprojekte, die nach dem 31. Dezember 2012 als Teil der Landes-Zielsteuerungsübereinkommen fortgeführt werden, im Bedarfsfall die erforderlichen Mittel zu überweisen.
(5) Für die Datenübermittlung gilt Folgendes:
1. Die Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, auf elektronischem Weg
a) der Bundesgesundheitsagentur und den Landesgesundheitsfonds auf deren Anforderung die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Daten in entsprechend aufbereiteter und nachvollziehbarer Form zu übermitteln und
b) der Bundesgesundheitsagentur und den Landesgesundheitsfonds pseudonymisierte Diagnose- und Leistungsdaten über die auf ihre Rechnung erbrachten medizinischen Leistungen in einer standardisierten und verschlüsselten Form zur Verfügung zu stellen.
2. Der Dachverband und die Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten entsprechend den Bestimmungen des §4 Abs6 des Bundesgesetzes über die Gesundheit Österreich GmbH, BGBl I Nr 132/2006 und des Bundesgesetzes über die Dokumentation im Gesundheitswesen, BGBl I Nr 745/1996, datenschutzrechtskonform auf elektronischem Weg bereitzustellen bzw zu übermitteln.
Alle personenbezogenen Daten sind vor der Übermittlung an die Bundesgesundheitsagentur, die Landesgesundheitsfonds und die im Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen genannten Stellen zur Sicherstellung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Pseudonymisierungsstelle nach §30c Abs1 Z7 zu pseudonymisieren."
"SECHSTER TEIL
Beziehungen der Träger der Sozialversicherung (des Dachverbandes) zu den
Angehörigen der Gesundheitsberufe und anderen Vertragspartnerinnen und
Vertragspartnern
ABSCHNITT I
Gemeinsame Bestimmungen
Regelung durch Verträge
§338. (1)‑(2) […]
(2a) Die Versicherungsträger haben sich beim Abschluss von Verträgen nach Abs1 an den von der Bundes‑Zielsteuerungskommission im Rahmen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit (ÖSG) beschlossenen Großgeräteplan zu halten. Dieser Großgeräteplan ist nach Abstimmung mit der Sozialversicherung, bezüglich der nicht landesfondsfinanzierten Krankenanstalten sowie des extramuralen Bereiches auch nach Abstimmung mit der für diese Krankenanstalten in Betracht kommenden gesetzlichen Interessensvertretung im Einvernehmen mit den Ländern festzulegen. Verträge die dem widersprechen, sind ungültig.
[…]"
III. Erwägungen
1. Zur Zulässigkeit der Verfahren
1.1. Gesetzesprüfungsverfahren
1.1.1. Die Bundesregierung erachtet das Gesetzesprüfungsverfahren in Ansehung des G‑ZG insofern teilweise als unzulässig, als der Prüfungsumfang nicht zutreffend abgegrenzt sei:
1.1.2. Hinsichtlich des Bedenkens, dass die §§18, 19, 20 Abs1 und 2 G‑ZG als gesetzliche Determinanten von (auch) krankenanstaltenrechtlichen Verordnungen entgegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG nicht als Grundsatzbestimmungen erlassen worden seien, führt die Bundesregierung ins Treffen, dass die Determinierung der RSG (auch) durch den nicht vom Prüfungsumfang mit umfassten §21 G‑ZG erfolge, der ebenfalls inhaltliche Vorgaben für die RSG enthalte und damit in untrennbarem Zusammenhang mit den genannten Bestimmungen stehe. Durch eine allfällige Aufhebung der in Prüfung gezogenen Bestimmungen könne die angenommene Verfassungswidrigkeit nicht gänzlich beseitigt werden.
1.1.3. Dieser Einwand der Bundesregierung ist nicht berechtigt: Im Unterschied zu den in Prüfung gezogenen Bestimmungen unterscheidet §21 G‑ZG zwischen grundsatzgesetzlichen und anderen Bestimmungen, weshalb sich die Bedenken des Verfassungsgerichtshofes nicht auf diese Bestimmungen erstreckt haben. Vor dem Hintergrund der gehegten Bedenken ist §21 G‑ZG trennbar.
1.1.4. Weiters vertritt die Bundesregierung die Auffassung, dass der Prüfungsbeschluss hinsichtlich des Bedenkens, dass §23 Abs4 und 5 G‑ZG den Anforderungen der Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG an die Leitungsbefugnis oberster Organe der Vollziehung widerspreche, weil die maßgebliche Festlegung des Verordnungsinhaltes der Bundes- und den Landes‑Zielsteuerungskommissionen überantwortet sei, zu eng gefasst sei. Es hätte auch §23 Abs1 erster Satz und Abs2 erster Satz G‑ZG mit in Prüfung gezogen werden müssen, aus denen sich dies erst ergeben würde.
1.1.5. Der Verfassungsgerichtshof teilt die Auffassung der Bundesregierung nicht: Zwar trifft es zu, dass die Bundes‑Zielsteuerungskommission bzw die Landes‑Zielsteuerungskommissionen die Grundlage für die – als bedenklich erachtete – Verordnungserlassung herstellen. Das Bedenken des Verfassungsgerichtshofes richtete sich jedoch dagegen, dass eine Verwaltungsbehörde Verordnungen zu erlassen hat, deren Inhalte nicht in der verfassungsrechtlich gebotenen Ingerenz oberster Organe stehen, weshalb der Sitz der Verfassungswidrigkeit in §23 Abs4 und 5 G‑ZG liegt. Im Fall der Aufhebung dieser Bestimmungen bliebe es bei unverbindlichen Planungsakten der Bundes‑Zielsteuerungskommission bzw der Landes‑Zielsteuerungskommissionen, wogegen der Verfassungsgerichtshof keine Bedenken gehegt hat.
1.1.6. Die Bundesregierung zieht in ihrer Äußerung weiters teilweise die hinreichend präzise Darlegung der Bedenken in Zweifel:
1.1.7. So sei das Bedenken, dass die Übertragung der (auch finanziellen) Planung für wesentliche Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge auf einen privaten Rechtsträger gegen die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung verstoße, keiner spezifischen Bestimmung des G‑ZG oder das KAKuG zugeordnet. Weiters würden im Prüfungsbeschluss keine Bedenken gegen den – gleichwohl in Prüfung gezogenen – §23 Abs8 G‑ZG vorgebracht. Schließlich hege der Verfassungsgerichtshof auch das Bedenken, dass §3a Abs3a KAKuG auf verfassungswidrige Weise in den Schutzbereich der Erwerbsfreiheit eingreife, weil durch die in den durch Verordnung für verbindlich erklärten Plänen die Zahl bestimmter Großgeräte taxativ festgesetzt sei. Dieses Bedenken betreffe jedoch seinem Grunde nach – allenfalls bloß – §20 Abs1 Z10 und 11 G‑ZG, in dem inhaltliche Vorgaben für den Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) auch im Hinblick auf Großgeräte getroffen würden; mit §3a Abs3a KAKuG werde allerdings keinerlei Kontingentierung von Großgeräten angeordnet.
1.1.8. Entgegen der Auffassung der Bundesregierung ergibt sich aus dem Prüfungsbeschluss, der in den Punkten III.5.1.1.6. und III.5.1.1.7. die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung thematisiert, mit hinreichender Deutlichkeit, dass sich diese Bedenken gegen die in Punkt III.5.1.1.6. des Prüfungsbeschlusses genannten Beleihungsanordnungen richtet. §23 Abs8 G‑ZG steht mit diesen Beleihungsanordnungen im Zusammenhang. Was das Bedenken der – zu starren – Großgeräteplanung anlangt, so geht dieses nicht dahin, dass Großgeräte überhaupt einer Planung unterliegen (§20 Abs1 Z10 und Z11 G‑ZG), sondern dahin, dass §3a Abs3a KAKuG die Bedarfsprüfung unverhältnismäßig gestalte. Die Bedenken hatten daher §3a Abs3a KAKuG zum Gegenstand.
1.1.9. Das Landesverwaltungsgericht Salzburg ficht zu V46/2019 §4 iVm der Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), an. Diese Verordnung wurde mit Ablauf des 18. Februar 2021 durch §6 Abs2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2020), kundgemacht unter Nr 2/2021 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), aufgehoben und durch die ÖSG VO 2020 ersetzt. Vor dem Hintergrund, dass das Landesverwaltungsgericht Salzburg seine Entscheidung an der maßgeblichen Rechtslage zum Zeitpunkt seiner Entscheidung auszurichten hat, ist es ausgeschlossen, dass das Landesverwaltungsgericht Salzburg §4 iVm der Anlage 2 der ÖSG VO 2018 anzuwenden und seiner Entscheidung zugrunde zu legen hat. Diese Bestimmung ist sohin (für das Landesverwaltungsgericht Salzburg) nicht mehr präjudiziell. Ihre Anfechtung erweist sich damit als unzulässig. Daher ist das (ausschließlich) aus Anlass dieses Verordnungsprüfungsantrages eingeleitete Gesetzesprüfungsverfahren zur Prüfung von §4 Abs1 Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000 (SKAG), LGBl 24/2000 (WV), idF LGBl 25/2018, einzustellen.
1.1.10. Im Übrigen erweist sich, da sonst keine Prozesshindernisse hervorgekommen sind, das Gesetzesprüfungsverfahren als zulässig.
1.2. Verordnungsprüfungsverfahren
Es ist nichts hervorgekommen, was an der Präjudizialität der in Prüfung gezogenen Verordnungsbestimmungen in den zu E2445/2019, E2462/2019 und E2872/2020 protokollierten Anlassverfahren zweifeln ließe.
1.3. Da auch sonst keine Prozesshindernisse hervorgekommen sind, erweist sich das Verordnungprüfungsverfahren als zulässig.
2. In der Sache
2.1. Die im Prüfungsbeschluss dargelegten Bedenken des Verfassungsgerichtshofes konnten im Gesetzesprüfungsverfahren nur zum Teil zerstreut werden.
2.2. Die in Prüfung gezogenen Bestimmungen stehen in folgendem normativen Zusammenhang:
2.2.1. Gemäß Art10 Abs1 B‑VG sind unter anderem das Sozial- und Vertragsversicherungswesen (Z11) und das "Gesundheitswesen mit Ausnahme des Leichen- und Bestattungswesens sowie des Gemeindesanitätsdienstes und Rettungswesens, hinsichtlich der Heil- und Pflegeanstalten, des Kurortewesens und der natürlichen Heilvorkommen jedoch nur die sanitäre Aufsicht" (Z12) in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache. Hingegen sind "Heil- und Pflegeanstalten" – also im Besonderen das Krankenanstaltenrecht –, abgesehen von der sanitären Aufsicht, nach Art12 Abs1 Z1 B‑VG Bundessache nur in der Grundsatzgesetzgebung, hinsichtlich der Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung jedoch Landessache (vgl dazu ua VfSlg 13.023/1992, 17.232/2004). Während also das Berufsrecht der selbständig niedergelassenen Ärzte Bundessache ist (Art10 Abs1 Z12 B‑VG), unterfallen bettenführende Krankenanstalten und selbständige Ambulatorien Art12 Abs1 Z1 B‑VG (vgl näher VfSlg 13.023/1992).
2.2.2. Vor dem Hintergrund dieser geteilten Kompetenzrechtslage haben der Bund und die Länder die (unbefristete) Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG Zielsteuerung-Gesundheit (kundgemacht ua in BGBl I 97/2017) und die Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens (kundgemacht ua in BGBl I 98/2017) abgeschlossen. Mit letzterer Vereinbarung sind der Bund und die Länder unter anderem übereingekommen, den Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) und die Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG) als zentrale Planungsinstrumente für die integrative Versorgungsplanung einzusetzen. Mit Art5 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens haben sich der Bund und die Länder detailliert auf die Vorgangsweise zur Erarbeitung und Verbindlicherklärung des ÖSG und der RSG geeinigt. Gemäß der Präambel zur Art15a B‑VG-Vereinbarung Zielsteuerung-Gesundheit sollen "[d]urch das vertragliche Prinzip Kooperation und Koordination […] die organisatorischen und finanziellen Partikularinteressen der Systempartner überwunden" werden.
2.2.3. Diese Vereinbarungen nach Art15a B‑VG binden die jeweiligen Vertragspartner (zB VfSlg 14.146/1995, 15.972/2000, 16.959/2003, 20.177/2017) und haben nicht selbst den Charakter genereller Normen (weshalb ihre Kundmachung auch nicht Teil des Rechtssetzungsverfahrens ist, sondern bloß der Information der Allgemeinheit dient, VfSlg 17.232/2004). Insbesondere stellen sie – wie der Verfassungsgerichtshof in VfSlg 14.146/1995 festgehalten hat – keine Zwischenstufe zwischen einfachem Gesetzesrecht und Verfassungsrecht dar; auch sind sie keine höherrangigen Normen, an denen ein Gesetz gemessen werden kann (zB VfSlg 14.146/1995, 19.747/2013). Vielmehr handelt es sich um Vertragsnormen, die – gegebenenfalls – umsetzungsbedürftig sind (VfSlg 20.177/2017). Gegebenenfalls können Bestimmungen von Art15a B‑VG-Vereinbarungen auch zur Interpretation von einfachgesetzlichen Bestimmungen, die der Umsetzung solcher Vereinbarungen dienen, herangezogen werden (vgl zB VfSlg 19.964/2015). Die Umsetzung kann nach Umständen auch eine Verfassungsänderung bedingen, wenn ansonsten eine verfassungskonforme Verwirklichung des in einer Vereinbarung nach Art15a B‑VG Bedungenen nicht möglich wäre.
2.2.4. Zur Umsetzung dieser Übereinkommen hat der Bundesgesetzgeber mit dem Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017, BGBl I 26/2017, das Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz (G‑ZG) erlassen, das überwiegend unmittelbar anwendbares Bundesrecht, bisweilen aber auch bloß Bundes‑Grundsatzrecht iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG enthält:
2.2.5. Gemäß §19 Abs1 G‑ZG sind der ÖSG und die RSG die zentralen Planungs-instrumente für die integrative Versorgungsplanung; dabei soll der ÖSG der österreichweit verbindliche Rahmenplan für die in den RSG vorzunehmende konkrete Gesundheitsstrukturplanung und Leistungsangebotsplanung sein. Der ÖSG hat in näher bestimmten Bereichen verbindliche Vorgaben für die RSG festzulegen (§19 Abs2 G‑ZG; siehe zu den Inhalten des ÖSG und der RSG die §§20 f. G‑ZG).
2.2.6. Nach §18 Abs1 G‑ZG hat (in Umsetzung von Art4 der Art15a B‑VG-Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens) die integrative Planung der österreichischen Gesundheitsversorgungsstruktur "sektorenübergreifend" ("insbesondere") den ambulanten Bereich der "Sachleistung" (d.h. niedergelassene [Zahn‑]Ärzte, Gruppenpraxen, sonstige in der Gesundheitsversorgung frei praktizierende Berufsgruppen und selbständige Ambulatorien, jeweils mit Kassenverträgen, einschließlich der eigenen Einrichtungen der Versicherungsträger und Spitalsambulanzen), (Z1), weiters den "akutstationäre[n] Bereich und [den] tagesklinische[n] Bereich (d.h. landesgesundheitsfondsfinanzierte Krankenanstalten und Unfallkrankenhäuser), sofern dieser aus Mitteln der Gebietskörperschaften und/oder der Sozialversicherung zur Gänze oder teilweise finanziert wird" (Z2), ferner den Rehabilitationsbereich (Z3) zu umfassen. Gemäß §18 Abs2 Z1 G‑ZG ist die Versorgungswirksamkeit von Wahlärzten, Wahltherapeuten, Sanatorien und sonstigen Wahleinrichtungen, "sofern von diesen sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbracht werden", bloß als Rahmenbedingung bei der integrativen Versorgungsplanung "mit zu berücksichtigen", das heißt aber, nicht selbst Gegenstand der integrativen Versorgungsplanung (gleichsinnig §19 Abs2 G‑ZG).
2.2.7. Der ÖSG ist "auf Bundesebene zwischen dem Bund, den Ländern und der Sozialversicherung einvernehmlich abzustimmen" (§20 Abs3 G‑ZG) und in der Bundes‑Zielsteuerungskommission zu beschließen (§20 Abs4 G‑ZG). Die RSG sind "auf Landesebene zwischen dem jeweiligen Land und der Sozialversicherung festzulegen" (§21 Abs7 G‑ZG, vgl auch die – teilweise grundsatzgesetzlichen – Abs1 bis 6 leg. cit.; §16 Abs4 NÖGUS‑G 2006, §9 Abs4 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017) und in den Landes‑Zielsteuerungskommissionen zu beschließen (vgl §21 Abs10 G‑ZG; vgl aber auch landesgesetzlich §17a Abs2 und 3 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013 und §9 Abs1 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Die Planungsvorgaben sind jedenfalls so konkret festzulegen, dass sie für die Bedarfsprüfung herangezogen werden können (§23 Abs2 dritter Satz G‑ZG, §2 Abs4 Z7 lita NÖGUS‑G 2006, §17a Abs3 zweiter Satz Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §9 Abs6 zweiter Satz Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat sodann die jeweils aktuelle Fassung des ÖSG jedenfalls im RIS (§22 Abs1 G‑ZG) zu veröffentlichen; ebenso hat der Landeshauptmann die jeweils aktuelle Fassung des RSG im RIS zu veröffentlichen (§22 Abs2 G‑ZG). §59k Z1 KAKuG qualifiziert den ÖSG (zunächst) als "objektiviertes Sachverständigengutachten" (vgl idS bereits Art5 Abs9 Z1 der Art15a B‑VG-Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens).
2.2.8. §23 G‑ZG regelt die Verbindlicherklärung von Inhalten des ÖSG und der RSG: Zunächst hat die Bundes‑Zielsteuerungskommission (siehe §25 Abs1 Z1 und §26 G‑ZG) die "für die nachhaltige Versorgung der Bevölkerung unerlässlichen Teile des ÖSG", die eine "rechtlich verbindliche Grundlage für Planungsentscheidungen des RSG bilden sollen", als solche "auszuweisen" (§23 Abs1 G‑ZG). Hinsichtlich der RSG wendet sich der – unmittelbar anwendbare – §23 Abs2 G‑ZG an die Vertreter des Bundes und der Sozialversicherung in der jeweiligen Landes‑Zielsteuerungskommission: Diese haben "sicherzustellen", dass jene Planungsvorgaben des RSG, die rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen, als solche ausgewiesen werden.
Für den Fall, dass kein Einvernehmen über die verbindlich zu erklärenden Teile des RSG bzw deren Änderungen in der Landes‑Zielsteuerungskommission zustande kommt, hat der Landesgesetzgeber gemäß der grundsatzgesetzlichen Bestimmung des §10a KAKuG (vgl auch §24 G‑ZG und Art5 Abs12 der Art15a B‑VG-Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens) die Landesregierung zu verpflichten, für "Fondskrankenanstalten einen Landeskrankenanstaltenplan durch Verordnung zu erlassen" (vgl landesgesetzlich etwa §21a NÖ KAG, §39 Abs4 Oö. KAG 1997, §5a Abs1 Wr. KAG).
2.2.9. Die rechtliche Verbindlichkeit der ausgewiesenen Teile des ÖSG bzw der RSG wird durch Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH hergestellt (§23 Abs1 zweiter Satz bzw Abs2 zweiter Satz, Abs4 und Abs5 G‑ZG), die zunächst ein Begutachtungsverfahren durchzuführen hat; wenn sich dabei Änderungen ergeben, ist vor der Verbindlicherklärung eine nochmalige Beschlussfassung in der Bundes‑Zielsteuerungskommission (im Fall des ÖSG) bzw der Landes‑Zielsteuerungskommission (im Fall eines RSG) "herbeizuführen" (§23 Abs1 und 2 G‑ZG, jeweils vorletzter und letzter Satz). Gemäß §23 Abs4 G‑ZG erklärt die Gesundheitsplanungs GmbH die von der Bundes‑Zielsteuerungskommission bzw den Landes‑Zielsteuerungskommissionen ausgewiesenen Teile des ÖSG bzw der RSG, insoweit sie Angelegenheiten des Art10 B‑VG betreffen, für verbindlich. §23 Abs5 G‑ZG weist als Grundsatzbestimmung die Landesgesetzgeber an, die solcherart ausgewiesenen Teile des ÖSG bzw der jeweiligen RSG, soweit sie Angelegenheiten des Art12 B‑VG betreffen, durch die Gesundheitsplanungs GmbH für verbindlich erklären zu lassen (entsprechende ausführungsgesetzliche Bestimmungen finden sich etwa in §17 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013 und §10 Abs1 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Gemäß §23 Abs6 G‑ZG hat die Gesundheitsplanungs GmbH "die für verbindlich zu erklärenden Teile im Wege einer Verordnung zu erlassen und im RIS (www.ris.bka.gv.at ) kundzumachen" (eine Kundmachungspflicht im RIS sehen auch §17 Abs1 NÖGUS‑G 2006 und §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013 vor).
2.2.10. Die Rechtsstellung der Bundes‑Zielsteuerungskommission, der Landes‑Zielsteuerungskommissionen und der Gesundheitsplanungs GmbH stellt sich folgendermaßen dar:
2.2.10.1. Die Bundes‑Zielsteuerungskommission ist ein Organ der Bundesgesundheitsagentur (§25 Abs1 Z1 G‑ZG), die durch (den unmittelbar anwendbaren) §56a KAKuG als Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit eingerichtet ist. Ihr gehören vier Vertreter des Bundes, vier Vertreter der Sozialversicherung sowie neun Vertreter der Länder an (§26 Abs1 G‑ZG, §84a Abs2 Z1 ASVG). Den Vorsitz in der Bundes‑Zielsteuerungskommission führt der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister (§26 Abs2 G‑ZG). Die Bundes‑Zielsteuerungskommission fasst ihre Beschlüsse in Angelegenheiten des ÖSG einvernehmlich (§26 Abs3 Z1 und Abs4 Z1 litj G‑ZG), wobei jede "Kurie" eine Stimme hat. Die Bundes‑Zielsteuerungskommission ist keinen Weisungen staatlicher Organe unterworfen.
2.2.10.2. Die Landes‑Zielsteuerungskommissionen sind landesgesetzlich als Organe der Landesgesundheitsfonds eingerichtet (vgl zB §4 Abs1 Z2 NÖGUS‑G 2006, §5 Abs1 Z2 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §4 Abs1 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Diese sind als Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit gestaltet (vgl zB §1 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §1 Abs1 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §1 Abs1 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Den Landes‑Zielsteuerungskommissionen gehören fünf Vertreter des Landes, fünf Vertreter der Sozialversicherungsträger und ein Bundesvertreter an (zB §8 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §10 Abs1 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §7 Abs1 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017, weiters §29 Abs2 G‑ZG und §84a Abs3 ASVG). Gemäß §28 Abs1 G‑ZG hat der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister einen Vertreter in die jeweilige Landes‑Zielsteuerungskommission zu entsenden, der durch §28 Abs2 leg. cit. ermächtigt ist, ua gegen rechtswidrige Beschlüsse ein Veto einzulegen. Gemäß §29 Abs2 G‑ZG haben die gesetzlichen Krankenversicherungsträger (jeweils) fünf Vertreter in die Landes‑Zielsteuerungskommissionen zu entsenden, die dort (jeweils) eine "Kurie mit einer Stimme" bilden (§29 Abs3 G‑ZG). Für die Beschlussfassung in der Landes‑Zielsteuerungskommission ist das Einvernehmen zwischen der Kurie des Landes und der Kurie der Sozialversicherungsträger erforderlich (zB §8 Abs4 Z1 NÖGUS‑G 2006, §12 Abs2 Z1 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §7 Abs10 Z4 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017); der Bundesvertreter ist vetoberechtigt (zB §8 Abs4 Z2 NÖGUS‑G 2006, §12 Abs2 Z3 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §7 Abs10 Z5 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Die Landes‑Zielsteuerungskommissionen sind keinen Weisungen staatlicher Organe unterworfen (vgl auch §19 NÖGUS‑G 2006 und §20 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 über die "Aufsicht" über den Fonds).
2.2.10.3. Die Gesundheitsplanungs GmbH ist eine auf Grundlage von §23 Abs3 G‑ZG eingerichtete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Gesellschafter der Bund, die Länder und der Dachverband der Sozialversicherungsträger sind. Die Gesellschafter entsenden jeweils einen Vertreter in die Generalversammlung der Gesellschaft, deren Beschlussfassung einstimmig erfolgt (§23 Abs3 G‑ZG). Die Gesellschafter bestellen die Geschäftsführung der Gesundheitsplanungs GmbH; sie besteht aus einem Geschäftsführer und zwei Stellvertretern (§23 Abs3 G‑ZG). Gemäß §7 Abs2 des vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz im Vorverfahren zu V419/2020 vorgelegten Gesellschaftsvertrages wird die Gesellschaft "durch den Geschäftsführer vertreten. Im Verhinderungsfall wird dieser durch die Stellvertreter gemeinsam vertreten." Gemäß §7 Abs3 dieses Gesellschaftsvertrages hat "die Geschäftsführung […] alle Entscheidungen und Verfügungen zu treffen, die nicht durch das Gesetz, diesen Gesellschaftsvertrag oder allenfalls durch die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Beschlussfassung der Generalversammlung vorbehalten sind".
§7 Abs5 des Gesellschaftsvertrages ermächtigt die Generalversammlung, eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung zu erlassen. Unter dem Titel der "Kundmachung der Verordnungen" legt §3 der Geschäfts- und Verfahrensordnung fest, dass der "Geschäftsführer" den Verordnungsentwurf nach der Rückmeldung im Begutachtungsverfahren "zu unterzeichnen" und "im Anschluss gemäß §23 Abs6 G‑ZG im Rechtsinformationssystem des Bundes als Verordnung zu veröffentlichen" hat.
Gemäß §23 Abs7 G‑ZG unterliegt "die Tätigkeit der Gesellschaft", soweit Angelegenheiten des Art10 B‑VG berührt sind, der Aufsicht des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers und es ist die "Gesellschaft" bei Besorgung ihrer diesbezüglichen Aufgaben an dessen Weisungen gebunden. Die Grundsatzbestimmung des §23 Abs8 G‑ZG verpflichtet die Landesgesetzgeber, die "Tätigkeit der Gesellschaft", soweit Angelegenheiten des Art12 B‑VG berührt sind, der Aufsicht und den Weisungen der jeweiligen Landesregierung zu unterstellen. Die Landes-Ausführungsgesetze sehen entsprechende Bestimmungen vor (vgl zB §17 Abs2 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs5 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §10 Abs3 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017).
2.2.11. Gemäß Art5 Abs11 der Art15a B‑VG‑Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens sind die verbindlichen Inhalte von RSG‑Verordnungen "als verbindliche Grundlage anzuwenden", "[s]oweit krankenanstaltenrechtliche oder ärzterechtliche Bedarfsprüfungen durchzuführen sind":
2.2.11.1. Die Krankenanstaltengesetze der Länder (vgl zB §10c Abs3 NÖ KAG, §6a Abs6a Oö. KAG 1997, §5 Abs3a Wr. KAG) sehen in der Folge in Ausführung der Grundsatzbestimmung des §3a KAKuG unter anderem vor, dass die Bewilligung der Errichtung von selbständigen Ambulatorien grundsätzlich einen Bedarf voraussetzt, der im Fall der Geltung von Verordnungen nach den §§23 oder 24 G‑ZG, sofern sie den "verfahrensgegenständlichen Leistungsumfang" regeln, am Maßstab dieser Verordnungen, also am Maßstab der als verbindlich erklärten Teile des ÖSG bzw der RSG, hilfsweise am Maßstab von Landeskrankenanstaltenplänen (siehe oben III.2.2.8.), zu beurteilen ist.
2.2.11.2. Ähnliche Bestimmungen finden sich auch in §3 Abs2b KAKuG und den dazu ergangenen Landesausführungsgesetzen, in §52c Abs2 Ärztegesetz 1998 (siehe ferner §47a Abs2 und §52b Abs2 leg. cit.) und in §26b Zahnärztegesetz für die Bewilligung von Gruppenpraxen.
2.2.11.3. Die §§2, 8 ff. und 14 Primärversorgungsgesetz sichern die Beachtung der RSG (iSv §21 Abs8 G‑ZG) bei der Einrichtung von Primärversorgungseinheiten.
2.2.11.4. Die Bindung der Sozialversicherungsträger an ÖSG und RSG ergibt sich ua aus §84a Abs1 und §338 Abs2a ASVG.
2.3. Zu den Bedenken im Einzelnen:
2.3.1. Zu den Bedenken im Hinblick auf Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG
2.3.1.1. Der Verfassungsgerichtshof ging vorläufig davon aus, dass die ÖSG- und RSG‑Verordnungen derart zustande kommen, dass zunächst der ÖSG zwischen Vertretern des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung bzw die RSG zwischen Vertretern der Länder und der Sozialversicherung (unter Einbeziehung des Bundes) akkordiert werden. Dieser Abstimmungsvorgang dürfte zumindest teilweise nicht hoheitlicher Natur sein (so dürfte etwa die Beteiligung von Bundesvertretern am Abstimmungsvorgang hinsichtlich des ÖSG in Belangen, die der Sache nach Krankenanstaltenrecht betreffen, schon aus Gründen der Kompetenzverteilung nicht hoheitlich deutbar sein). In einem weiteren Schritt dürfte das Ergebnis dieser Abstimmungen von den Zielsteuerungskommissionen zu beschließen sein (womit ihm zunächst einmal der Charakter eines "objektivierten Sachverständigengutachtens" zukommen dürfte; vgl §59k Z1 KAKuG) und dürften Teile für die Verbindlicherklärung auszuwählen sein. Die Tätigkeit dieser Zielsteuerungskommissionen dürfte, wenn sie hoheitlich als Teilschritt des Verordnungserlassungsverfahrens zu deuten wäre, mangels Weisungsingerenz der obersten Organe der Vollziehung verfassungswidrig sein. Die – zweifellos hoheitlich handelnde – Gesundheitsplanungs GmbH dürfte hingegen keinen Einfluss auf den Inhalt der ÖSG- und RSG‑Verordnungen haben, insbesondere dürfte sie nicht zu entscheiden haben, welche Teile eines ÖSG oder von RSG für verbindlich zu erklären sind. Sie dürfte vielmehr verpflichtet sein, abgestimmte und von der zuständigen Zielsteuerungskommission beschlossene, ausgewiesene Teile des ÖSG bzw der RSG als verbindlich zu erklären.
Damit dürfte aber die maßgebliche Festlegung des Verordnungsinhaltes – zumindest in wesentlichen Teilen – der Gesundheitsplanungs GmbH entzogen und (zumindest teilweise) nicht-hoheitlich handelnden oder (zumindest teilweise) der Ingerenz der (im Hinblick auf Art10 Abs1 Z12 bzw Art12 Abs1 Z1 B‑VG zuständigen) obersten Organe der Vollziehung nicht unterworfenen Organen überantwortet sein. Dies dürfte wiederum die verfassungsrechtlich gebotenen Verantwortungszusammenhänge unterlaufen. Im Ergebnis dürfte damit die gewählte Konstruktion, die in §23 Abs4 und 5 G‑ZG und den entsprechenden Landes‑Ausführungsbestimmungen ihren Sitz hat, den Anforderungen der Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG an die Leitungsbefugnis oberster Organe der Vollziehung widersprechen.
In diesem Zusammenhang werde – so der Verfassungsgerichtshof in seinem Prüfungsbeschluss – auch zu prüfen sein, ob ein verordnungserlassendes Organ durch die Zielsteuerungskommission derart gebunden werden dürfe, dass es im Ergebnis keine Entscheidungsbefugnis mehr habe. Zudem werde im Gesetzesprüfungsverfahren zu prüfen sein, ob die vorläufig angenommene Prämisse dieser Bedenken, dass die Gesundheitsplanungs GmbH keinen Entscheidungsspielraum habe und jedenfalls zur Erlassung der von den Zielsteuerungskommissionen bezeichneten Teile der Strukturpläne als Verordnungen verpflichtet sei, tragfähig sei.
2.3.1.2. Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass die Abstimmung des ÖSG und der RSG durch Bund, Länder und Sozialversicherung nicht hoheitlicher Natur sei. Auch die im G‑ZG geregelten Aufgaben der Zielsteuerungskommissionen seien nicht als hoheitliche Tätigkeiten aufzufassen, weshalb keine Weisungsingerenz der obersten Organe der Vollziehung geboten sei. Die Zielsteuerungskommissionen seien unstrittig nicht mit der Setzung von Hoheitsakten betraut, sodass ihr Handeln lediglich als schlicht-hoheitliches Verwaltungshandeln qualifiziert werden könnte. Es sei aber im Allgemeinen davon auszugehen, dass eine "Beleihung" ausgegliederter öffentlich-rechtlicher Rechtsträger zur Voraussetzung habe, dass dem Rechtsträger eine Befugnis zur Umsetzung von Rechtsakten übertragen werde. Die Übertragung einer Befugnis lediglich zu einem Handeln, das, würde es durch Behörden erfolgen, als schlicht-hoheitliches Verwaltungshandeln (und damit dennoch als "Vollziehung" in einem verfassungsrechtlichen Sinn) zu verstehen wäre, führe demnach noch nicht zur Qualifikation als Beleihung (Hinweis auf Wiederin, Die Beleihung, in: Fuchs/Merli/Pöschl/Sturn/Wiederin/Wimmer [Hrsg.], Staatliche Aufgaben, private Akteure II, 2017, 31 [42 f.]). Sollte der Verfassungsgerichtshof der Auffassung sein, dass eine Beleihung auch dann vorliegen könne, wenn der Rechtsträger mit der Befugnis zu schlicht-hoheitlichem Handeln ermächtigt werde, stelle die Bundesregierung zur Erwägung, das Handeln der Zielsteuerungskommissionen nicht als schlicht-hoheitliches Handeln ("Vollziehung" in einem verfassungsrechtlichen Sinn) zu qualifizieren, sondern als einen gesetzlich geordneten politischen Prozess. Die Bundesregierung sei daher der Auffassung, dass das Bedenken des Verfassungsgerichtshofes, wonach die im G‑ZG vorgesehene Konstruktion auf Grund fehlender Weisungsingerenz der obersten Organe hinsichtlich der Tätigkeit der Zielsteuerungskommissionen verfassungswidrig sei, nicht zutreffe.
Die Bundesregierung ist weiters der Auffassung, dass es keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegne, wenn ein Verwaltungsorgan wie die Gesundheitsplanungs GmbH durch Gesetz verpflichtet werde, einen Inhalt durch Verordnung für verbindlich zu erklären, der nicht vom Verwaltungsorgan selbst, sondern von anderen Stellen festgelegt werde. Zunächst sei es unproblematisch, wenn im Gesetz eine Pflicht der Behörde zur Erlassung einer Verordnung bestimmten Inhaltes vorgesehen werde. Nach Lehre und Rechtsprechung sei es zulässig, eine Verwaltungsbehörde durch das Gesetz zur Erlassung einer Verordnung zu verpflichten; dies würde umso mehr für beliehene Rechtsträger gelten, zumal diese keine originäre Kompetenz zur Erlassung von Verordnungen gemäß Art18 Abs2 B‑VG hätten (Hinweis auf VfSlg 16.995/2003). Unbedenklich sei es auch, dass die Gesundheitsplanungs GmbH nur auf Initiative anderer eine Verordnung erlassen dürfe. Zwar leite der Verfassungsgerichtshof aus der Stellung oberster Organe der Vollziehung ab, dass diese nur unter bestimmten Voraussetzungen an Anträge anderer Stellen gebunden werden dürften; dies gelte aber nicht für Organe, die keine obersten Organe seien (Hinweis auf VfSlg 13.880/1994). Es sei daher zulässig, die Gesundheitsplanungs GmbH an Anträge anderer Stellen zu binden. Insofern sei es auch verfassungsrechtlich unproblematisch, dass die Gesundheitsplanungs GmbH nur dann zum Handeln berechtigt (und verpflichtet) sei, wenn die jeweils zuständige Zielsteuerungskommission für verbindlich zu erklärende Teile des ÖSG oder der RSG ausweise.
Schließlich sei es auch verfassungsrechtlich unbedenklich, dass die Gesundheitsplanungs GmbH keinen Einfluss auf den Inhalt der für verbindlich zu erklärenden Pläne habe. Welchen Inhalt eine Verordnung haben müsse, sei Verwaltungsbehörden regelmäßig heteronom vorgegeben, dies insbesondere durch das die Verordnung bestimmende Gesetz (vgl Art18 Abs2 B‑VG). So könne beispielsweise die Kultusbehörde verpflichtet sein, eine bestimmte Religionsgemeinschaft durch Verordnung anzuerkennen, also eine Verordnung mit einem bestimmten Inhalt zu erlassen (Hinweis auf VfSlg 11.931/1988). Die Straßenpolizeibehörde könne verpflichtet sein, auf Antrag einer Person mit Behinderung eine Verordnung mit einem bestimmten Inhalt (Errichtung eines "Behindertenparkplatzes") zu erlassen (Hinweis auf VwGH 28.1.2021, Ro 2019/02/0017). Über die Determinierung des Inhalts von Verordnungen hinausgehend sei in einigen Gesetzen auch vorgesehen, dass die Behörde Inhalte, die von anderen Stellen stammten, durch Verordnung für verbindlich erkläre, so etwa bei der Erklärung eines Kollektivvertrages zur Satzung durch das Bundeseinigungsamt auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft (§§18 ff. ArbVG), bei der Verbindlicherklärung der deutschsprachigen Fassung des europäischen Arzneibuches durch den Bundesminister für Gesundheit (§2 Abs1 ArzneibuchG 2012) oder bei der Verbindlicherklärung einer nationalen Norm, die von der Normungsorganisation angenommen worden sei (§9 NormG 2016).
Schließlich weise die Bundesregierung darauf hin, dass das G‑ZG sicherstelle, dass die jeweils zuständigen obersten Organe – ihrer Verantwortlichkeit entsprechend – Einfluss auf den Inhalt des ÖSG und der RSG ausüben könnten: Die obersten Organe hätten zunächst im Rahmen der Akkordierung (vgl §20 Abs3 und §21 Abs7 G‑ZG) Einfluss auf den Inhalt der Gesundheitsplanungsakte. In der Bundes‑Zielsteuerungskommission, deren Vorsitz von dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister geführt werde (§26 Abs2 G‑ZG), könne der ÖSG nur im Einvernehmen zwischen den Kurieren des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung beschlossen werden (§26 Abs3 Z1 G‑ZG). Die RSG könnten von der Landes‑Zielsteuerungskommission nur im Einvernehmen zwischen den Kurieren des Landes und der Sozialversicherung beschlossen werden (vgl Art26 Abs2 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG). Der Vertreter des Bundes habe ein Vetorecht (vgl §28 Abs2 G‑ZG). Die Strukturpläne seien daher regelmäßig vom gemeinsamen politischen Willen des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung getragen. Es erscheine damit geradezu ausgeschlossen, dass ein Gesundheitsplan gegen den Willen der zuständigen obersten Organe der Vollziehung zustande komme und Verbindlichkeit erlange.
Zusammengefasst ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die in Prüfung gezogenen Bestimmungen nicht den Anforderungen der Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG widersprächen.
2.3.1.3. Die Wiener Landesregierung geht davon aus, dass die Gesundheitsplanungs GmbH keine "Gestaltungsmöglichkeit" bei der Verordnungserlassung habe, dass dies aber unproblematisch sei, wie etwa auch die Zulässigkeit der Verbindlicherklärung von ÖNORMEN zeige.
2.3.1.4. Der Verfassungsgerichtshof hegte im Kern das Bedenken, dass die zu beurteilende Rechtsgestaltung dazu führe, dass Verordnungsinhalte durch nicht der Weisungsingerenz und Verantwortung oberster Organe unterliegende Rechtsträger (Zielsteuerungskommissionen als Organe der Bundesgesundheitsagentur bzw der Landesgesundheitsfonds) vorgegeben würden, die in der Folge nur noch "formal" durch einen zwar der Weisungsbefugnis oberster Organe unterstehenden, aber der inhaltlichen Einflussmöglichkeit entbehrenden, beliehenen Rechtsträger mit normativer Verbindlichkeit ausgestattet werde, und dass dies in Widerspruch zu den Anforderungen an die Leitungsbefugnis oberster Organe gemäß den Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105. Abs2 und Art142 B‑VG stehe.
2.3.1.5. Dieses Bedenken trägt der Gesamtkonstruktion der Gesundheits‑Zielsteuerung nicht hinreichend Rechnung:
Die ÖSG- bzw RSG‑Verordnungen werden von der (beliehenen) Gesundheitsplanungs GmbH auf Veranlassung der jeweiligen Zielsteuerungskommissionen erlassen:
Der Bund und die Länder sind in den Art4 f. der Vereinbarung nach Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens übereingekommen, die – nach der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung separierten – Materien (vor allem) des Gesundheits- und Krankenanstaltenwesens (unter Einbeziehung der Erfordernisse des Sozialversicherungswesens) im Bereich der Planung wegen der gegebenen unauflöslichen (vor allem auch finanziellen) Wechselwirkungen kooperativ zu bewältigen. Die zitierte Vereinbarung, die insbesondere mit dem G‑ZG umgesetzt wird, sieht in diesem Zusammenhang einen gesetzlich strukturierten politischen Prozess vor.
Zu diesem Zweck richten das G‑ZG und die Landesgesundheitsfonds‑Gesetze in Umsetzung der genannten Art15a B‑VG-Vereinbarung zunächst besondere Koordinationsgremien, die Zielsteuerungskommissionen, ein (näher oben III.2.2.10.1. und III.2.2.10.2.), die nach ihrer Zusammensetzung und Organisation, ihrer Vorgangsweise und ihrer in finaler Determinierung erfolgenden Bindung an Zielvorgaben, in einem gesetzlich geordneten politischen Prozess (siehe oben III.2.2.7.), koordiniert eine kompetenzübergreifende Planung bestimmter Themen mit gesundheitsrechtlichen, krankenanstaltenrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Implikationen abstimmen. Die gesetzliche Regelung dieses Prozesses ist derart gestaltet, dass eine Planung das Einvernehmen des Bundes, der Länder und der Sozialversicherungsträger voraussetzt, wobei die jeweils leitungsbefugten, zuständigen obersten Organe, mithin der für das Gesundheitswesen (und idR auch für das Krankenversicherungswesen) zuständige Bundesminister (§26 Abs2 G‑ZG) und das für Krankenanstaltenangelegenheiten zuständige Mitglied der Landesregierung (vgl etwa §8 Abs1 und 2 iVm §6 Abs1 Z1 NÖGUS‑G 2006, §10 Abs1 Z1 iVm §6 Abs2 Z1 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §7 Abs2 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017) von Gesetzes wegen leitende Mitglieder dieser Koordinationsgremien sind. Diese sind nicht Teil der staatlichen Verwaltung im organisatorischen Sinn, sondern als Organ der Bundesgesundheitsagentur bzw der Landesgesundheitsfonds Koordinationseinrichtungen mit einer Mischung aus Sachverstand und politischer Legitimation. Als solche Einrichtungen sind sie letztlich durch die politisch letztverantwortlichen obersten Organe der Vollziehung beherrscht. Damit sind im konkreten Fall die Bedenken des Verfassungsgerichtshofes in Hinblick auf Art20 Abs1 B‑VG ausgeräumt.
Als Ergebnis des gesetzlich solcherart geregelten, strukturierten politischen Prozesses in diesen Zielsteuerungkommissionen können sich, wenn sich die maßgeblichen politischen Akteure einigen, unverbindliche, aber akkordierte, gemeinsame Planungen bestimmter Themen des Gesundheits‑, Sozialversicherungs- und Krankenanstaltenwesens ergeben. Der Verfassungsgerichtshof hegt keine Bedenken dagegen, dass die jeweils zuständigen Gesetzgeber in Umsetzung der Art4 f. der Vereinbarung nach Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens und im Bestreben, den Besonderheiten der Kompetenzverteilung auf den Gebieten des Gesundheits‑, Sozialversicherungs- und Krankenanstaltenrechts Rechnung zu tragen, eine solchermaßen gestaltete Organisationsstruktur für den genannten geordneten politischen Prozess einrichten.
In weiterer Folge sehen das G‑ZG und die komplementären Landesgesetze vor, dass in den jeweiligen Zielsteuerungskommissionen – im Ergebnis wieder einvernehmlich – Teile dieser Planungen ausgewählt werden, von denen die Mitglieder dieser Kommissionen, darunter die zuständigen obersten Organe der Vollziehung, der Auffassung sind, dass sie verbindlich sein sollten. Im Ergebnis handelt es sich bei den gesetzlich (in §23 Abs1 und 2 G‑ZG, §2 Abs4 Z7 lita NÖGUS‑G 2006, §17a Abs3 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §9 Abs6 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017) vorgesehenen Vorgaben, solche Planteile auszuweisen, gleichsam – wie sich letztlich aus der Gesetzessystematik ergibt – um die Stellung von "Anträgen" der jeweiligen Kommissionen auf Verbindlicherklärung durch die Gesundheitsplanungs GmbH. Die Bundesregierung hat zutreffend darauf hingewiesen, dass es von Verfassungs wegen nicht ausgeschlossen ist, die Erlassung von Verordnungen an darauf gerichtete "Anträge" selbst von Privaten, aber auch – wie hier – von Einrichtungen wie den mit Vertretern des Bundes, der Länder und der Sozialversicherungsträger beschickten Zielsteuerungskommissionen zu binden.
Die Verbindlicherklärung von Planteilen setzt somit einen "Antrag" der jeweils zuständigen Zielsteuerungskommission voraus und fällt in die Zuständigkeit der beliehenen Gesundheitsplanungs GmbH. Diese hat ein Begutachtungsverfahren durchzuführen (§23 Abs1 und 2 G‑ZG, §17 Abs1 letzter Satz NÖGUS‑G 2006, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §10 Abs2 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017), das auch zu einer Änderung des Planes führen kann, die einer neuerlichen Beschlussfassung und damit implizit einer neuerlichen "Antragstellung" der jeweiligen Zielsteuerungskommission bedarf (§23 Abs1 und 2 G‑ZG, §17 Abs1 letzter Satz NÖGUS‑G 2006, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §10 Abs2 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017).
Die Gesundheitsplanungs GmbH hat den zur Verbindlicherklärung eingereichten Planausschnitt auf seine Gesetzes- und Verfassungskonformität zu prüfen; dies folgt schon aus der behördlichen Verantwortung der Gesundheitsplanungs GmbH für die von ihr zu erlassenden Verordnungen. Diese Prüfung hat jedenfalls die Einhaltung der Vorschriften des Planungsvorganges in der Zielsteuerungskommission sowie der finalen Determinierungskriterien des Planes zu umfassen. Erweist sich der "ausgewiesene" (sohin zur Verbindlicherklärung "beantragte") Planausschnitt als rechtswidrig, so hat die Verbindlicherklärung zu unterbleiben; kommt nachträglich eine Rechtswidrigkeit der Verordnung hervor, so hat die Gesundheitsplanungs GmbH die Verordnung jederzeit aufzuheben (vgl allgemein etwa VfSlg 12.555/1990, 13.744/1994). Ein weitergehender rechtspolitischer Beurteilungsspielraum oder ein Planungsermessen kommt der Gesundheitsplanungs GmbH hingegen nicht zu (vgl zu Anträgen Privater auf Verordnungserlassung etwa die §§18 ff. ArbVG und dazu VfSlg 2410/1952, 13.880/1994, 20.189/2017). Im Unterschied zu der Konstellation, die der Verfassungsgerichtshof mit seinem Erkenntnis vom 14. Dezember 2021, G232/2021, zu beurteilen hatte und in der der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice in Bindung an die Beurteilung des Regionalbeirates eine eigenständige Beurteilung des Vorliegens der gesetzlichen Bewilligungsvoraussetzungen entzogen war, liegt im hier zu beurteilenden Fall daher keine Bindung der Gesundheitsplanungs GmbH vor, die über eine – verfassungsrechtlich zulässige – "Antragsbindung" hinausgeht.
Die Gesundheitsplanungs GmbH unterliegt bei diesem "antragsgebundenen" Akt der Verordnungserlassung je nach Regelungs- und damit Zuständigkeitsbereich den Weisungen entweder des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers oder der zuständigen obersten Organe der Landesvollziehung. Diese obersten Organe können daher die Verbindlicherklärung ausgewiesener Planteile für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich verhindern, dürfen von ihrem Weisungsrecht bei sonstiger Gesetzwidrigkeit der Weisung aber nur Gebrauch machen, wenn es um die Verhinderung der Erlassung (oder um die Aufhebung) einer rechtswidrigen Verordnung geht, können also ebenso wenig wie die Gesundheitsplanungs GmbH das Zustandekommen der Verordnung aus rechtspolitischen oder Gründen des Planungsermessens verhindern. Auch insofern unterscheidet sich der Einwirkungsspielraum der obersten Organe auf die Gesundheitsplanungs GmbH nicht von anderen Fällen, in welchen untergeordnete Behörden eine gebundene Entscheidung zu treffen haben.
Im Ergebnis sieht daher das Gesetz einen strukturierten politischen Planungsprozess unter Einbindung der zuständigen obersten Organe der Vollziehung vor, der die Verwendung öffentlicher Finanzmittel zum Gegenstand hat, dessen Resultate auf "Antrag" der Planungsträger von der beliehenen Gesundheitsplanungs GmbH unter der Voraussetzung der Rechtskonformität mit Verbindlichkeit auszustatten sind, wobei die Rechtmäßigkeitsprüfung durch die Gesundheitsplanungs GmbH und die anschließende Verbindlicherklärung der vollen Weisungsingerenz des jeweils zuständigen obersten Organs unterliegt.
In einer Gesamtbetrachtung vermag der Verfassungsgerichtshof daher seine Bedenken ob der Gestaltung der Verordnungsinhalte durch nicht der Ingerenz oberster Organe unterliegende Einrichtungen nicht aufrechtzuerhalten.
2.3.1.6. Der Verfassungsgerichtshof äußerte in seinem Prüfungsbeschluss weiters das Bedenken, dass mit §23 Abs4 (und 5) G‑ZG, §17 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013 und §10 Abs1 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 die Grenzen einer zulässigen Beleihung deshalb überschritten sein könnten, weil die Leitungsbefugnisse, die den zuständigen obersten Organen gegenüber der Gesundheitsplanungs GmbH eingeräumt sind, nicht ausreichend effektiv sein dürften, um eine Missachtung von Weisungen effektiv abzustellen.
2.3.1.7. Die Bundesregierung konzediert, dass die Steuerungsbefugnisse oberster Organe gegenüber beliehenen Rechtsträgern effektiv sein müssten; Art20 Abs1 B‑VG verpflichte die Gesetzgebung, dem obersten Organ eine effektive Leitungs- und Steuerungsfunktion einzuräumen (Hinweis auf VfSlg 16.400/2001, 17.421/2004). Die Beachtung von Weisungen müsse in einer dem Art20 B‑VG entsprechenden Weise durchgesetzt werden können (Hinweis auf VfSlg 15.946/2000). Der Verfassungsgerichtshof habe auch eine direkte Steuerungsbefugnis hinsichtlich des Personals verlangt (Hinweis auf VfSlg 16.400/2001). Die in §23 Abs7 G‑ZG vorgesehenen Befugnisse würden diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben genügen:
In §23 Abs7 G‑ZG werde ein umfassendes Aufsichts- und Weisungsrecht des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers in Bezug auf die Tätigkeit "der Gesellschaft" begründet, insoweit Angelegenheiten des Art10 B‑VG berührt seien. Adressat der Weisungen sei die Gesundheitsplanungs GmbH im Ganzen, also sowohl die Generalversammlung als auch die Geschäftsführung. Da zur Kundmachung der Verordnung der Geschäftsführer zuständig sei, könne der Bundesminister – sofern Angelegenheiten des Art10 B‑VG betroffen seien – unmittelbar mit Weisung auf die Verordnungserlassung Einfluss nehmen. Die Geschäftsführung werde durch Beschluss der Generalversammlung bestellt. Auch die Mitglieder der Generalversammlung unterlägen in den Angelegenheiten des Art10 B‑VG den Weisungen des Bundesministers, und zwar auch dann, wenn sie von anderen Rechtsträgern (Länder und Sozialversicherung) entsandt worden seien (Hinweis auf Stöger, Die Gesundheitsreform 2017 im Überblick – Neue Rechtsprobleme der Gesundheitsplanung, in: Baumgartner [Hrsg.], Jahrbuch Öffentliches Recht 2018, 2018, 11 [23]). Der Bundesminister könne daher durch Weisung auf die Bestellung der Geschäftsführung Einfluss nehmen. Sollte sich die Geschäftsführung im Hinblick auf Angelegenheiten des Art10 B‑VG rechtswidrig verhalten (also etwa eine Verordnung nicht kundmachen), könne der Bundesminister die Generalversammlung anweisen, eine neue Geschäftsführung zu bestellen. Eine unmittelbare Bestellung oder Abberufung der Geschäftsführung durch den Bundesminister sei im Gesetz zumindest nicht ausdrücklich vorgesehen. Auf Grund der Funktion der Gesundheitsplanungs GmbH erscheine eine solche Befugnis in der Praxis nach Auffassung der Bundesregierung auch nicht erforderlich: Die Gesundheitsplanungs GmbH habe von Bund, Ländern und Sozialversicherung abgestimmte und in der zuständigen Zielsteuerungskommission beschlossene Planungsakte (ÖSG und RSG) für verbindlich zu erklären, soweit sie von der zuständigen Zielsteuerungskommission gemäß §23 Abs1 erster Satz und Abs2 erster Satz G‑ZG ausgewiesen worden seien. Einen Einfluss auf den Inhalt der Planungsakte habe die Gesundheitsplanungs GmbH nicht. Der ÖSG könne nur im Einvernehmen zwischen den Kurien des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung beschlossen werden (§26 Abs3 Z1 G‑ZG). Bei der Beschlussfassung über die RSG habe der Vertreter des Bundes ein Vetorecht (§28 Abs2 G‑ZG). Gesundheitsplanungsakte seien daher regelmäßig vom gemeinsamen Willen des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung getragen. Sollte sich die Geschäftsführung der Gesundheitsplanungs GmbH im Zusammenhang mit der Verbindlicherklärung der Planungsakte rechtswidrig verhalten (etwa eine Verordnung nicht kundmachen), so werde dies daher regelmäßig nicht nur dem Willen des Bundes, sondern auch dem Willen der Länder und dem des Dachverbands der Sozialversicherungsträger widersprechen. In solchen Fällen könne dann durch die Vertreter des Bundes, der Länder und des Dachverbands der Sozialversicherungsträger in der Generalversammlung eine neue Geschäftsführung bestellt werden, wodurch die Gesetzmäßigkeit der Tätigkeit der Gesundheitsplanungs GmbH sichergestellt werde. Da die Funktion der Gesundheitsplanungs GmbH darin bestehe, bereits abgestimmte Planungsakte für verbindlich zu erklären, erscheine eine einseitige Befugnis des Bundesministers zur Abberufung des Geschäftsführers in der Praxis nicht erforderlich. Vor diesem Hintergrund werde erklärlich, warum eine solche Befugnis im Gesetz nicht ausdrücklich genannt werde. Dessen ungeachtet sei die Bundesregierung der Auffassung, dass §23 Abs7 G‑ZG auch ein Abberufungsrecht des Bundesministers in Bezug auf die Geschäftsführung einschließe. Denn im ersten Satz dieser Bestimmung werde ein (unbeschränktes) Aufsichtsrecht des Bundesministers in Angelegenheiten des Art10 B‑VG normiert. Im Wesen der Aufsicht (nach Art20 Abs1 B‑VG) liege auch das Recht, nachgeordnete Organe des Amtes zu entheben (Hinweis auf Grabenwarter/Frank, B‑VG, 2020, Art20 B‑VG, Rz 10). Vor diesem Hintergrund sei anzunehmen, dass auch das Aufsichtsrecht nach §23 Abs7 erster Satz G‑ZG ein solches Recht einschließe, zumal Bestellungs- und Abberufungsrechte in §23 Abs7 G‑ZG nicht ausdrücklich geregelt und somit auch nicht ausgeschlossen seien. Die in §23 Abs7 G‑ZG normierten Steuerungsbefugnisse seien daher hinreichend effektiv.
2.3.1.8. Die Niederösterreichische Landesregierung vertritt in ihrer Stellungnahme die Auffassung, dass §17 Abs2 NÖGUS‑G 2006 den verfassungsrechtlichen Anforderungen hinreichend Rechnung trage. Da die Bestellung der Geschäftsführung der Gesundheitsplanungs GmbH durch die Länder, den Bund und den Dachverband der Sozialversicherungsträger erfolge und für Beschlüsse der Gesundheitsplanungs GmbH Einstimmigkeit in der Generalversammlung erforderlich sei, die Generalversammlung jeweils aus einem Vertreter der Länder, des Bundes und des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger bestehe, sei eine effektive Leitungs- und Steuerungsfunktion des obersten Organes, der Landesregierung, gegeben.
2.3.1.9. Die Wiener Landesregierung vertritt die Auffassung, dass die Anordnung des §10 Abs3 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetzes 2017 "aufgrund [ihres] öffentlich-rechtlichen Charakters […] unabhängig vom Willen der Gesellschafter einer GmbH gilt". Es sei zu betonen, dass "ausschließlich ausverhandelte Inhalte in die Verordnung einfließen" würden. Wenn die Gesellschaft gesetzwidrig andere Inhalte für verbindlich erkläre oder im Einzelfall Weisungen nicht befolge, hätten die Gesellschafter geeignete Maßnahmen bis hin zur Abberufung der betreffenden Organe zu treffen. Es bestehe daher auf Grund der gesetzlich normierten Aufsichts‑, Weisungs- und Informationsrechte nach §10 Abs3 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017, der gesellschaftsrechtlichen Durchgriffsrechte und insbesondere im Hinblick auf die rein formalen Aufgaben der Gesundheitsplanungs GmbH eine ausreichende Steuerungsmöglichkeit der obersten Organe der Verwaltung.
2.3.1.10. Die Bedenken des Verfassungsgerichtshofes konnten zerstreut werden:
Die Zulässigkeit einer Beleihung privater Rechtsträger mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Hoheitsverwaltung setzt von Verfassungs wegen jedenfalls die Unterstellung des privaten Rechtsträgers unter die (zumindest mittelbare) Leitungsbefugnis des zuständigen obersten Organes voraus (vgl VfSlg 14.473/1996, 16.400/2001, 17.421/2004). Da Art20 B‑VG gegenüber einem ausgegliederten Rechtsträger nicht unmittelbar wirkt, ist der Gesetzgeber verpflichtet, Rechtsvorschriften zu erlassen, die einem obersten Organ eine effektive Leitungs- und Steuerungsfunktion einräumen, und dabei insbesondere ein umfassendes Weisungsrecht einzurichten (VfSlg 17.421/2004). Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes müssen hinreichende Instrumente zur Effektuierung der Weisungsbefugnis vorhanden seien (vgl nur VfSlg 14.473/1996). Dazu kann bei beliehenen Gesellschaften mit beschränkter Haftung auch das Gesellschaftsrecht einen Beitrag leisten, etwa, wenn der beleihenden Gebietskörperschaft gesetzlich die Mehrheit der Gesellschaftsanteile vorbehalten ist, womit angesichts des §20 GmbHG sichergestellt ist, dass auch die Gesellschafterrechte durch ein dem Parlament verantwortliches oberstes Organ wahrgenommen werden müssen (so VfSlg 14.473/1996).
Der Verfassungsgerichtshof hat bislang nicht abschließend definiert, welche Anforderungen an ein hinreichendes Aufsichtsrecht zu stellen sind, sondern jeweils auf die Umstände des Einzelfalles abgestellt: Welches Maß an Eingriffsmöglichkeiten eingeräumt sein muss, kann nämlich nicht losgelöst von der Art und dem Umfang der übertragenen Aufgaben und weiteren Umständen der Beleihung beurteilt werden. Aus Art20 Abs2 B‑VG, der Abs1 leg. cit. präzisiert und auch auf Beleihungskonstruktionen anzuwenden ist (VfGH 16.12.2021, G390/2020 ua), ergibt sich jedenfalls, dass ein angemessenes Aufsichtsrecht der obersten Organe gegenüber beliehenen Rechtsträgern – grundsätzlich – auch das Recht umfassen muss, Organwalter beliehener Rechtsträger "aus wichtigem Grund abzuberufen".
§23 Abs7 G‑ZG und die in Prüfung gezogenen Landesausführungsgesetze zu §23 Abs8 G‑ZG (§17 Abs2 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs5 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013 und §10 Abs3 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017) räumen (letztlich) dem jeweils zuständigen obersten Organ der Verwaltung neben einer Weisungsbefugnis auch noch die Befugnis zur Ausübung der "Aufsicht" über die Gesundheitsplanungs GmbH ein. Die Landesgesetze (§17 Abs2 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs5 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §10 Abs3 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017) verpflichten die Gesundheitsplanungs GmbH überdies auch auf Verlangen der Landesregierung "zur jederzeitigen Information".
Der Verfassungsgerichtshof vermag zunächst der Ansicht der Bundesregierung nicht zu folgen, dass bereits in §23 Abs7 G‑ZG ein Recht des Bundesministers zur (hoheitsrechtlichen) Abberufung von Organwaltern der Gesundheitsplanungs GmbH eingeräumt sei, weil es diesfalls an einer ausreichenden gesetzlichen Determinierung dieses Abberufungsrechts (Art18 Abs1 B‑VG) fehlen würde. Daran vermag der Hinweis der Bundesregierung auf Art20 Abs1 B‑VG nichts zu ändern, weil hier nämlich kein Fall der Aufsicht im Rahmen der inneren (und damit nicht näher regelungsbedürftigen, vgl VfSlg 4117/1961) Organisation der Gebietskörperschaft, sondern ein – determinierungsbedürftiger – Fall der Aufsicht gegenüber einem eigenständigen Rechtsträger vorliegt. Entsprechendes gilt für die insofern gleichlautenden landesrechtlichen Aufsichtsregelungen.
§23 Abs7 G‑ZG, §17 Abs2 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs5 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013 und §10 Abs3 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 ermöglichen es daher (für sich allein) noch nicht, eine Missachtung von Weisungen durch Abberufung zuwiderhandelnder Organwalter effektiv abzustellen.
Es bleibt daher zu prüfen, ob aus dem G‑ZG in Verbindung mit dem Gesellschaftsrecht hinreichende Leitungsmöglichkeiten und insbesondere ein Recht zur Abberufung der Gesellschaftsorgane folgen.
Zunächst ist festzuhalten, dass §23 G‑ZG die – jeweiligen – Gesellschaftsanteile des Bundes, der Länder und des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger an der Gesundheitsplanungs GmbH nicht festlegt, sondern dies der privatautonomen Gestaltung der Gesellschafter überlässt. Wohl aber folgt aus §23 Abs3 G‑ZG, dass ausschließlich der Bund, die Länder und der Dachverband der Sozialversicherungsträger als Gesellschafter in Betracht kommen, womit andere Personen von Gesetzes wegen als Gesellschafter ausgeschlossen sind. Der – im Verfahren vorgelegte – Gesellschaftsvertrag der Gesundheitsplanungs GmbH weist aus, dass der Bund und der Dachverband der Sozialversicherungsträger jeweils zu einem Drittel und die neun Bundesländer jeweils zu einem Siebenundzwanzigstel (gemeinsam also wiederum zu einem Drittel) beteiligt sind. Die gesellschaftsrechtliche Relevanz dieser Anteilsverhältnisse wird jedoch durch den Umstand überlagert, dass §23 Abs3 G‑ZG anordnet, dass der Bund, die Länder und der Dachverband der Sozialversicherungsträger jeweils einen Vertreter in die Generalversammlung entsenden und dass die Generalversammlung ihre Beschlüsse einstimmig zu fassen hat.
Vor diesem Hintergrund folgt aus §16 Abs1 iVm §34 Abs1 GmbHG, dass die Gesellschafter (nur) gemeinsam in der Gesellschafterversammlung die Abberufung der Geschäftsführung beschließen können. Eine Abberufung eines – etwa weisungswidrig handelnden – Geschäftsführers durch den Bund oder ein Land allein ist damit aber nicht – zumindest nicht ohne weiteres – möglich. Dies schadet jedoch vor dem Hintergrund der Eigenart der der Gesundheitsplanungs GmbH übertragenen Aufgabe nicht: Die Gesundheitsplanungs GmbH hat zur Aufgabe, auf Veranlassung der jeweiligen Zielsteuerungskommission (Teile von) Strukturplänen für verbindlich zu erklären. Ein Strukturplan und die Veranlassung der Verbindlicherklärung kommen aber nach dem Konzept des G‑ZG und der entsprechenden Landesgesetze nur zustande, wenn dies vom einvernehmlichen Willen des Bundes, der (beteiligten) Länder und Sozialversicherungsträger getragen wird, wenn sie sohin ohnehin ein gleichgerichtetes Interesse haben. In dieser Konstellation ist aber gleichzeitig auch gesichert, dass ein allfälliges rechtswidriges Verhalten der Geschäftsführung einvernehmlich von den Gesellschaftern unter Einsatz von Instrumenten des Gesellschaftsrechts sanktioniert wird. Es würde die aus Art20 Abs1 und 2 B‑VG abzuleitenden Anforderungen überspannen, müsste der Gesetzgeber daneben auch noch jede sonst theoretisch denkbare Eventualität bedenken. Damit ergibt sich, dass die in Prüfung gezogenen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen iVm den Befugnissen des Gesellschaftsrechts ein den Umständen der konkret zu beurteilenden Beleihungskonstruktion angemessenes, den Anforderungen des Art20 B‑VG Rechnung tragendes Aufsichtsrecht einräumen, das die hinreichend effektive Möglichkeit zur Abberufung der Geschäftsführung einschließt. Das Bedenken, dass das vorgesehene Aufsichtsrecht nicht ausreichend effektiv sei, trifft daher nicht zu.
2.3.2. Zu den Bedenken im Hinblick auf die Grenzen der Beleihung
2.3.2.1. Der Verfassungsgerichtshof hegte weiters das Bedenken, dass die Übertragung der (auch finanziellen) Planung für wesentliche Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge gegen die verfassungsrechtliche Beschränkung der Beleihung auf vereinzelte Aufgaben außerhalb staatlicher Kernaufgaben verstoßen könnte.
2.3.2.2. Nach der Auffassung der Bundesregierung hängt die Frage, ob in einem konkreten Fall die Grenzen der Ausgliederung von Aufgaben der Hoheitsverwaltung auf private Rechtsträger überschritten werde, von Wertungen ab, die verbindlich vorzunehmen in der Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes lägen (Hinweis auf Holoubek, Öffentlich-rechtliche Rahmenbedingungen von Ausgliederungen und Privatisierungen, ÖGZ 2000, 22 [23]). In der Literatur werde überwiegend die Meinung vertreten, dass die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung im Fall der Gesundheitsplanungs GmbH nicht überschritten würden (Hinweis auf Souhrada, Verbindliche Planung, SV‑Verträge und Krankenanstalten, SozSi 2017, 104 [117]; Baumgartner, Die Verbindlicherklärung von Strukturplänen durch die Gesundheitsplanungs GmbH, ZfV 2018, 255 [259 f.]; Friedrich, Strukturprobleme und Lösungen im österreichischen Gesundheitswesen anhand der "Gesundheitsplanungs GmbH", SPRW 2019, 25 [44 f.]; Schrattbauer, Verbindlichkeit der Gesundheitsplanung – ÖSG‑VO 2018 verfassungskonform?, SozSi 2020, 56 [58]; wohl auch Stöger, Gesundheitsreform 2017, 21 f.; siehe auch Berka, Die Verantwortung des Staates für die medizinische Versorgung, RdM 2019, 227 [228]; aA Kopetzki/Perthold-Stoitzner, Die Verbindlicherklärung der Strukturpläne aus verfassungsrechtlicher Sicht, RdM 2018, 44 [46 f.]). Die Bundesregierung schließe sich dieser (überwiegenden) Auffassung an.
Zum einen handle es sich bei der Gesundheitsplanung um keine staatliche Kernaufgabe: Der Verfassungsgerichtshof habe in seiner Rechtsprechung die Vorsorge für die Sicherheit im Inneren und nach außen wie die allgemeine Sicherheitspolizei und das Militärwesen (einschließlich des Wehrersatzdienstes), die Ausübung der (Verwaltungs‑)Strafgewalt und die außenpolitischen Beziehungen zu anderen Staaten zu den ausgliederungsfesten Kernaufgaben des Staates gezählt (VfSlg 14.473/1996, 16.400/2001, 16.995/2003, 17.341/2004). Vor diesem Hintergrund erscheine es inkonsistent, auch die Gesundheitsplanung zu den staatlichen Kernaufgaben zu rechnen. Denn die vom Verfassungsgerichtshof genannten Aufgaben würden allesamt mit dem Gewaltmonopol des Staates und seinen Beziehungen zu anderen Staaten zusammenhängen. Die Planung der Gesundheitsversorgung stehe aber mit diesen Bereichen nicht in Zusammenhang. Soweit in der Literatur erwogen werde, eine Kernaufgabe des Staates in der Gesundheitsversorgung unter Verweis auf grundrechtliche Schutzpflichten zu begründen (Hinweis auf Kopetzki/Perthold-Stoitzner, RdM 2018, 46), könne dies nach Auffassung der Bundesregierung nicht überzeugen. Denn grundrechtliche Schutzpflichten würden auf den effektiven Schutz der Rechtspositionen Einzelner abzielen. Sofern die Rechte Einzelner auch unter Einsatz von Privaten effektiv geschützt werden könnten, könne aus Schutzpflichten daher nicht abgeleitet werden, dass eine bestimmte Aufgabe ausschließlich vom hoheitlich handelnden Staat selbst besorgt werden müsse.
Zum anderen handle es sich bei der Verbindlicherklärung des ÖSG und der RSG durch Verordnung auch lediglich um eine einzelne Aufgabe der staatlichen Verwaltung: Die Gesundheitsplanung umfasse nur einen Teilbereich der Angelegenheiten, die unter die Kompetenztatbestände "Sozialversicherungswesen" (Art10 Abs1 Z11 B‑VG), "Gesundheitswesen" (Art10 Abs1 Z12 B‑VG) und "Heil- und Pflegeanstalten" (Art12 Abs1 Z1 B‑VG) fielen. Zahlreiche Regelungsbereiche der staatlichen Gesundheitsverwaltung, welche auch unter diese Kompetenztatbestände fielen, seien daher von der Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH von vornherein nicht betroffen. Bereits dies spreche gegen die Annahme, dass der Gesundheitplanungs GmbH mehr als nur vereinzelte Aufgaben der staatlichen Verwaltung übertragen worden seien. Auch innerhalb der Aufgabe der Gesundheitsplanung komme der Gesundheitsplanungs GmbH lediglich eine einzelne Befugnis zu, nämlich die Kompetenz zur Verbindlicherklärung der ausgewiesenen Teile des ÖSG und der RSG durch Verordnung. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes sei die Übertragung einer Befugnis zur Erlassung von Verordnungen auf Beliehene auch grundsätzlich zulässig (VfSlg 16.995/2003, 19.307/2011). Andere Zuständigkeiten, die mit der Gesundheitsplanung im Zusammenhang stünden, seien von der Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH nicht betroffen, so beispielsweise die Zuständigkeit der Landesregierungen zur Erlassung von Krankenanstaltenplänen (§10a KAKuG), aber auch die Zuständigkeit zur Erteilung krankenanstaltenrechtlicher Bewilligungen (vgl insb. die §§3 Abs1, 3a Abs1 KAKuG), wodurch auch planungsrechtliche Vorgaben umgesetzt würden. Unberührt bliebe grundsätzlich auch die Verpflichtung der Länder zur Sicherstellung öffentlicher Krankenanstaltspflege (§18 KAKuG). Die Kompetenz der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verordnungserlassung stelle zudem nur einen einzelnen Schritt bei der Umsetzung des ÖSG und der RSG dar. Der Verordnungserlassung gehe ein Verfahren voraus, in dessen Rahmen der Inhalt der Pläne und der Umfang der für verbindlich zu erklärenden Teile bestimmt werde. Die Funktion der Gesundheitsplanungs GmbH erschöpfe sich darin, die von den zuständigen Zielsteuerungskommissionen ausgewiesenen Teile einem Begutachtungsverfahren zu unterziehen und sie durch Verordnung für verbindlich zu erklären. Die Gesundheitsplanungs GmbH habe keinen Einfluss auf den Inhalt der für verbindlich zu erklärenden Planungsakte.
Schließlich hält die Bundesregierung fest, dass Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH dem öffentlichen Interesse der umfassenden und integrativen Planung des österreichischen Gesundheitswesens diene (Erläut zur RV 1333 BlgNR 25. GP , 9 f.). Hiedurch werde ein geordnetes Vorgehen von Bund und Ländern erreicht, was letztlich auch dem in Lehre und Rechtsprechung angenommenen Effizienzgebot der Bundesverfassung entspreche (Hinweis auf Stöger, Gesundheitsreform 2017, 21, und Baumgartner, ZfV 2018, 260). Auch dies spreche nach Auffassung der Bundesregierung gegen die Annahme, dass die Grenzen der Ausgliederung von Aufgaben der Hoheitsverwaltung auf private Rechtsträger durch die Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH überschritten würden.
Durch die Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH mit der Kompetenz, die ausgewiesenen Teile des ÖSG und der RSG durch Verordnung für verbindlich zu erklären, würden daher weder eine staatliche Kernaufgabe noch mehr als nur vereinzelte Aufgaben der staatlichen Verwaltung übertragen.
2.3.2.3. Die Niederösterreichische Landesregierung weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass in der Literatur überwiegend vertreten werde, dass die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung nicht verletzt würden (Hinweise auf Baumgartner, ZfV 2018, 258 f.; Stöger, Gesundheitsreform 2017, 20; Souhrada, SozSi 2017, 117, und Berka, RdM 2019, 228).
2.3.2.4. Die Wiener Landesregierung vertritt die Auffassung, dass die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung auf hohem Qualitätsniveau eine Kernaufgabe der staatlichen Verwaltung sei. Um dieses Ziel zu erreichen, sei eine auf alle Elemente des Versorgungssystems abgestimmte Planung erforderlich, die gemeinsam durch Bund, Länder und Sozialversicherung insbesondere mittels ÖSG und RSG erfolge. Bei der Verbindlicherklärung handle es sich um einen "reinen Formalakt"; der Gesundheitsplanungs GmbH obliege lediglich die "technische Durchführung der Verbindlicherklärung von Plänen, deren Inhalt von den Zielsteuerungskommissionen, denen Vertreter von Bund, den Ländern sowie den Sozialversicherungsträgern angehören, festgelegt werden". Davon bleibe die Verpflichtung der Länder zur Sicherstellung der Krankenanstaltenpflege nach krankenanstaltenrechtlichen Vorschriften sowie die Verpflichtung der Sozialversicherungsträger gegenüber den Anspruchsberechtigten auf Gewährung von Leistungen nach sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen unberührt. Im Ergebnis sei damit lediglich eine einzelne Aufgabe, nämlich die Verordnungserlassung, an einen beliehene Rechtsträger übertragen.
2.3.2.5. Die Bedenken des Verfassungsgerichtshofes, dass die Gesundheitsplanungs GmbH mit nicht bloß vereinzelten oder mit Kernaufgaben des Staates beliehen wurde, haben sich zerstreut:
Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes besteht die verfassungsrechtliche Ermächtigung zu Beleihungen nur für "vereinzelte Aufgaben" (zB VfSlg 3685/1960, 10.213/1984, 14.473/1996, 19.307/2011). Weiters dürfen keine Kernaufgaben des Staates an Beliehene übertragen werden. Zu den Kernbereichen der staatlichen Verwaltung zählt die Rechtsprechung etwa die Vorsorge für die Sicherheit im Inneren und nach außen, die Ausübung der (Verwaltungs‑)Strafgewalt sowie die Außenpolitik (VfSlg 14.473/1996, 16.400/2001, 16.995/2003). Das verfassungsrechtliche Verbot der Ausgliederung von staatlichen Kernaufgaben oder von mehr als bloß vereinzelten Aufgaben schützt vor einer Aushöhlung der verfassungsrechtlich vorgegebenen Staatsorganisation in qualitativer und quantitativer Hinsicht.
Angesichts der Breite der den Staatsorganen insgesamt zur unmittelbaren Wahrnehmung vorbehaltenen Kompetenzen in Angelegenheiten des Gesundheitswesens und des Krankenanstaltenrechts handelt es sich bei der der Gesundheitsplanungs GmbH zur Besorgung übertragenen Verbindlicherklärung von Gesundheits-Strukturplänen um eine bloß vereinzelte Aufgabe. In inhaltlicher Hinsicht übertragen die in Prüfung gezogenen Vorschriften zwar einen wichtigen Teil der strategischen Gesundheitsplanung auf einen beliehenen Rechtsträger; die besondere sachliche Rechtfertigung dieser Rechtsgestaltung liegt jedoch darin, dass sie bei komplexer kompetenzrechtlicher Lage eine Gebietskörperschaften übergreifende Kooperation ermöglicht. Schließlich hat die der Gesundheitsplanungs GmbH übertragene Aufgabe auch keine staatliche Kernaufgabe wie etwa die Gewährleistung der inneren und äußeren Sicherheit, die Strafgewalt oder die Außenpolitik zum Gegenstand, zumal die Bundesverfassung den Staat auch nicht verpflichtet, die allgemeine Gesundheitsversorgung in staatlicher Verwaltung zu organisieren.
2.3.3. Zum Bedenken im Hinblick auf Art102 B‑VG
2.3.3.1. Der Verfassungsgerichtshof hegte – ausgehend von der Annahme, dass §23 (Abs4) G‑ZG zur Erlassung von Verordnungen auf dem Gebiet des "Gesundheitswesens" (Art10 Abs1 Z12 B‑VG) ermächtigt – das Bedenken, dass die Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH mit der Erlassung von Verordnungen (auch) auf dem Gebiet des Gesundheitswesens mangels Zustimmung der Länder in Widerspruch zu Art102 B‑VG stehen dürfte.
2.3.3.2. Nach Auffassung der Bundesregierung werfe das im Prüfungsbeschluss gehegte Bedenken die grundsätzliche Frage auf, wie sich die Ausgliederung von Staatsaufgaben zu den verfassungsrechtlich vorgesehenen Modellen der Vollziehung verhalte; nämlich, ob die verfassungsrechtlichen Vorgaben, die im Fall der Vollziehung durch staatliche Organe zu beachten seien, auch dann zur Anwendung gelangen würden, wenn die Vollziehung nicht durch staatliche Organe, sondern durch ausgegliederte Rechtsträger besorgt werde.
Wäre es zutreffend, dass Art102 B‑VG auf die Angelegenheiten des Gesundheitswesens schlechthin anzuwenden wäre, könnte daraus der Schluss gezogen werden, dass diese Bestimmung einer (über vereinzelte Angelegenheiten hinausgehenden) Ausgliederung von Aufgaben per se entgegenstünde und die Vollziehung in den Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung dem Landeshauptmann und den unterstellten Behörden (das wären ausschließlich die Bezirksverwaltungsbehörden bzw Städte mit eigenem Statut; vgl §8 Abs5 litb ÜG 1920) verfassungsrechtlich vorbehalten wäre (Hinweis auf Wielinger, BVG ÄmterLReg §8/5 lita und b ÜG 1920, in: Korinek/Holoubek et. al. [Hrsg.], Österreichisches Bundesverfassungsrecht. Kommentar, 10. Lfg. 2011, Rz 19, demzufolge es unzulässig sei, einen Rechtsträger "ausschließlich oder primär zu dem Zweck zu schaffen, um die Besorgung hoheitlicher Aufgaben aus der Landesvollziehung oder der mittelbaren Bundesverwaltung zu übertragen").
Dieser Auffassung stehe die jüngere Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes entgegen, wonach Beleihungen grundsätzlich zulässig seien (Hinweis auf VfSlg 14.473/1996). Soweit ersichtlich habe der Verfassungsgerichtshof in dieser jüngeren Rechtsprechung – gegenüber VfSlg 3685/1960, in dem ausdrücklich auf Art102 B‑VG abgestellt werde – zur Beurteilung der Zulässigkeit der Beleihung an sich nie auf Art102 B‑VG Bezug genommen.
Abgesehen davon könne Art102 B‑VG auf Beleihungen nur dann anwendbar sein, wenn der beliehene Rechtsträger als "Bundesbehörde" im Sinn dieser Bestimmung zu qualifizieren sei; nur in einem solchen Fall würde das Zustimmungsrecht der Länder zur Anwendung gelangen. Im Einzelnen sei dazu Folgendes auszuführen:
Ob Art102 B‑VG auf die Begründung von Zuständigkeiten privater Rechtsträger anwendbar sei, sei in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes bisher nicht entschieden worden. In einem obiter dictum (VfSlg 19.721/2012) habe der Gerichtshof die Auffassung vertreten, dass Art102 Abs4 B‑VG auch auf Beleihungen anwendbar sei. In einem Prüfungsbeschluss habe er diese Frage – lediglich – aufgeworfen (VfSlg 19.728/2012), sei in weiterer Folge jedoch nicht darauf eingegangen.
Nach Auffassung der Bundesregierung liege dem Begriff der "Bundesbehörde" iSv Art102 Abs1 und Abs4 B‑VG ein – wie weitreichend auch immer geartetes – organisatorisches Verständnis zugrunde. Die Bundesregierung verkenne dabei nicht, dass der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis VfSlg 20.323/2019 implizit (jedoch ohne nähere Begründung) die zuvor in der Lehre vertretene enge Auffassung des Begriffs der "Bundesbehörde" (Hinweis auf Pernthaler, Die verfassungsrechtlichen Schranken der Selbstverwaltung in Österreich, 3. ÖJT, Bd. I/3, 1967, 77) abgelehnt und auch Selbstverwaltungskörper als "Bundesbehörden" angesehen habe. Daraus aber folge – entgegen der in der Literatur vertretenen Auffassung (Hinweis auf Wiederin, Anmerkung zu VfSlg 20.323/2019, RdM 2019, 181 [184]) – nicht, dass beliehene private Rechtsträger gleichermaßen als "Bundesbehörden" anzusehen seien, legte man diesem Begriff ein (wenn auch etwas abgeschwächtes) staatsorganisatorisches Verständnis zugrunde.
Würden Selbstverwaltungskörper keine "Bundesbehörden" iSd Art102 Abs2 B‑VG darstellen, wäre es demnach unzulässig, die in dieser Bestimmung genannten Angelegenheiten durch Selbstverwaltungskörper besorgen zu lassen. Dies hätte etwa zur Konsequenz, dass die Vollziehung des "Sozialversicherungswesens" durch Selbstverwaltungskörper in unmittelbarer Bundesverwaltung ausgeschlossen wäre. Nach Ansicht der Bundesregierung verfange dieses Argument aber in Bezug auf die Vollziehung durch beliehene private Rechtsträger nicht in gleichem Maße, wenn man annähme, dass Beliehene überhaupt nicht als "Bundesorgane" iSd Art102 B‑VG (und auch nicht dessen Abs2) anzusehen seien.
Während für Selbstverwaltungskörper nämlich noch gesagt werden könne, dass sie in einem bestimmten "Vollziehungsbereich" eingerichtet seien (Hinweis auf VfSlg 4413/1963) und sich demnach staatliches Handeln auch auf die Organisation des Selbstverwaltungskörpers selbst beziehen könne (wobei die Kompetenz zur Vollziehung nicht mit jener der Gesetzgebung zusammenfallen müsse – vgl Art11 Abs1 Z2 B‑VG), könne dies für beliehene private Rechtsträger nicht gleichermaßen gesagt werden. Diese müssten nicht durch das jeweilige (die Kompetenz zur Regelung der Organisation des Beliehenen einschließende) Materiengesetz geschaffen werden, sondern es könne das Materiengesetz auch die Zuständigkeit solcher privater Rechtsträger begründen, die nicht erst gesetzlich errichtet würden, sondern schon zuvor durch privatrechtlichen Rechtsakt errichtet worden seien (Hinweis auf Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5, 2017, Rz 115). In einem solchen Fall könne aber nicht beurteilt werden, in welchem Vollziehungsbereich der private Rechtsträger eingerichtet sei und ob es sich um eine "Bundesbehörde" handle.
Auch vor dem Hintergrund des Erkenntnisses VfSlg 17.421/2004 betreffend die Gebühreninkasso Service GmbH sei davon auszugehen, dass auch der Verfassungsgerichtshof in seiner bisherigen Rechtsprechung implizit die Auffassung vertreten haben dürfte, dass Beliehene nicht als in einem bestimmten Vollziehungsbereich eingerichtete Behörden anzusehen seien und sich die Frage der Trennung der Vollziehungsbereiche gar nicht stelle (Hinweis auf Mayr, Organisationsrechtliche Fragen einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle, in: Lienbacher/Wielinger [Hrsg.], Öffentliches Recht. Jahrbuch 2010, 2010, 93 [102 f.]; Pürgy, Die Mitwirkung von Beliehenen des Bundes an der Landesvollziehung, ZfV 2011, 745 [746 ff., 753]).
Die gegenteilige Deutung, wonach eine beliehene Gesellschaft des Privatrechts eine "Bundesbehörde" iSd Art102 Abs1 und 4 B‑VG darstelle, erscheine auch mit der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zur Anwendbarkeit sonstiger verfassungsrechtlicher Bestimmungen auf Beleihungen nur schwer vereinbar. So sollen auch Art18 Abs2 B‑VG und Art20 Abs1 B‑VG nicht unmittelbar auf Beliehene anwendbar (VfSlg 16.995/2003 bzw 16.400/2001) und die Begriffe der "Verwaltungsbehörden" bzw der "Organe" in den genannten Bestimmungen in einem organisatorischen Sinn aufzufassen sein.
Wären beliehene Private als "Bundesbehörden" anzusehen, sodass die bundesstaatliche Kompetenzverteilung auch auf diese anzuwenden wäre, so hätte dies überdies zur Folge, dass eine Beleihung Privater in den Angelegenheiten des Art11 B‑VG gänzlich ausgeschlossen wäre, zumal diese Angelegenheiten (ausschließlich) durch Landesbehörden zu vollziehen seien und eine davon abweichende Zuständigkeit von "Bundesbehörden" mangels verfassungsrechtlicher Ermächtigung – auch mit Zustimmung der Länder – nicht begründet werden dürfte (Hinweis auf Wiederin, Öffentliche und private Umweltverantwortung – Verfassungsrechtliche Vorgaben, in: ÖWAV [Hrsg.], Staat und Privat im Umweltrecht. Österreichische Umweltrechtstage 2000, 2000, 75 [89]).
Die Bundesregierung übersehe nicht, dass dem Prinzip der mittelbaren Bundesverwaltung in der jüngeren Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes eine Schutzfunktion zugunsten der Stellung des Landeshauptmannes zugeschrieben werde, nämlich dahingehend, dass Art102 B‑VG einen Vollziehungsvorbehalt zugunsten der in dieser Bestimmung genannten Behörden (des Landeshauptmannes und der ihm unterstellten Bezirksverwaltungsbehörden und Städte mit eigenem Statut) enthalte. Die Bundesregierung gebe jedoch zu bedenken, dass der Vorbehalt zugunsten dieser Behörden schon immer dann nicht zum Tragen komme, wenn ein privater Rechtsträger beliehen werde.
Nach Ansicht der Bundesregierung würden daher die besseren Gründe dafür sprechen, dass eine beliehene Gesellschaft des Privatrechts wie die Gesundheitsplanungs GmbH keine Bundesbehörde iSd Art102 B‑VG und die entsprechende in Prüfung gezogene Bestimmung daher nicht verfassungswidrig sei.
2.3.3.3. Die Wiener Landesregierung vertritt die Auffassung, dass vor dem Hintergrund der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG, BGBl I 97/2017, an der alle Länder teilgenommen hätten, "davon auszugehen [sei], dass der Bundesgesetzgeber für die Umsetzung der integrativen Gesundheitsplanung im §23 G‑ZG von der Zustimmung aller Länder ausgehen konnte".
2.3.3.4. Das Bedenken des Verfassungsgerichtshofes erweist sich als zutreffend:
§23 Abs4 G‑ZG beleiht die Gesundheitsplanungs GmbH mit der Verbindlicherklärung bestimmter Teile des ÖSG und der jeweiligen RSG durch Verordnung, "insoweit dies Angelegenheiten des Art10 B‑VG betrifft". Es ist unbestritten, dass sich diese Beleihung auch auf Angelegenheiten des "Gesundheitswesens" (Art10 Abs1 Z12 B‑VG) bezieht.
Da Angelegenheiten des "Gesundheitswesens" nicht zu den in Art102 Abs2 B‑VG genannten Materien zählen (zuletzt VfSlg 20.323/2019), sieht Art102 B‑VG für das Gesundheitswesen den Grundsatz der mittelbaren Bundesverwaltung vor, wonach die Vollziehung des Bundes im Bereich der Länder "der Landeshauptmann und die ihm unterstellten Landesbehörden" ausüben. Soweit Gesetze in Angelegenheiten, die in mittelbarer Bundesverwaltung zu besorgen sind, die die Einbindung von Bundesbehörden in die Vollziehung in Unterordnung unter den Landeshauptmann anordnen, dürfen sie nur mit Zustimmung der beteiligten Länder kundgemacht werden (Art102 Abs1 zweiter Satz B‑VG). Die Einrichtung von eigenen Bundesbehörden für andere als die in Art102 Abs2 B‑VG genannten Angelegenheiten – also unter Ausschaltung des Landeshauptmannes – kann nach Art102 Abs4 B‑VG ebenfalls nur mit Zustimmung der beteiligten Länder erfolgen.
Dass auch die Betrauung von Einrichtungen der nichtterritorialen Selbstverwaltung mit Vollzugsaufgaben des Bundes (Art120b Abs2 B‑VG) an das Regelungsmodell des Art102 B‑VG gebunden ist, hat der Verfassungsgerichtshof bereits (wiederholt) festgestellt (VfSlg 20.323/2019; VfGH 12.6.2020, G252/2019 ua; 17.6.2021, G297/2020 ua).
Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner bisherigen Rechtsprechung zu Beleihungen privater Rechtsträger betont, dass diese zwar nicht schlechthin unzulässig, allerdings nur insoweit verfassungsmäßig sind, als sich nicht aus dem Organisationskonzept oder aus einzelnen besonderen Bestimmungen der Bundesverfassung (wie etwa Art102 B‑VG) eine Einschränkung ergibt (VfSlg 3685/1960, 14.473/1996).
Die in der Literatur vorherrschende Meinung geht davon aus, dass Fälle der Beleihung nicht per se von der Anwendbarkeit des Art102 B‑VG ausgenommen sind (vgl Bußjäger, Art102 B‑VG, in: Kneihs/Lienbacher [Hrsg.], Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht, 14. Lfg. 2014, Rz 20; Raschauer, Art102 B‑VG, in: Korinek/Holoubek et. al. [Hrsg.], Österreichisches Bundesverfassungsrecht, 4. Lfg. 2001, Rz 60; Ranacher/Sonntag, Art102 B‑VG, in: Kahl/Khakzadeh/Schmid [Hrsg.], Kommentar zum Bundesverfassungsrecht, 2021, Rz 5 und 18; Wiederin, Staatliche Aufgaben, 38 f.; vgl weiters Grabenwarter/Frank, B‑VG, Art102 B‑VG Rz 5).
Der Verfassungsgerichtshof teilt diese in der Literatur überwiegend vertretene Auffassung: Art102 B‑VG sichert den Ländern – als "tragendes Element" des bundesstaatlichen Prinzips (VfSlg 11.403/1987) – eine wesentliche Teilhabe an der Vollziehung des Bundes, was darin zum Ausdruck kommt, dass Abweichungen an eine Zustimmung der Länder gebunden sind (Art102 Abs1 zweiter Satz und Abs4 B‑VG). Vor diesem Hintergrund ist es unerheblich, ob der Anteil der Länder an der Bundesverwaltung durch die Betrauung von Bundesbehörden im organisatorischen Sinn oder durch eine Beleihung privater Rechtsträger geschmälert wird (vgl Wiederin, Staatliche Aufgaben, 38 f.). Die Beleihung privater Rechtsträger mit Aufgaben der Bundesverwaltung im Bereich der Länder bedarf daher in Angelegenheiten, die nicht in Art102 Abs2 B‑VG genannt sind, sofern (wie hier) auch keine andere verfassungsrechtliche Ermächtigung besteht, ebenfalls der Zustimmung der Länder (vgl idS für die Betrauung eines öffentlich-rechtlichen Rechtsträgers bereits VfSlg 19.721/2012).
Die in §23 Abs4 G‑ZG angeordnete Überantwortung hoheitlicher Aufgaben auf dem Gebiet des Gesundheitswesens an die Gesundheitsplanungs GmbH führt zu einem Übergang der Vollziehung des Bundes von der mittelbaren Bundesverwaltung zu einer Vollziehung des Bundes in unmittelbarer Bundesverwaltung (vgl abermals VfSlg 19.721/2012) und bedurfte daher der Zustimmung der Länder nach Art102 Abs1 bzw Abs4 B‑VG "in ausdrücklicher und förmlicher Weise" (VfSlg 19.721/2012). Dass eine solche Zustimmung eingeholt worden wäre, behauptet auch die Bundesregierung nicht. Eine Vereinbarung nach Art15a B‑VG kann eine solche Zustimmung von vornherein nicht ersetzen.
§23 Abs4 G‑ZG steht damit in Widerspruch zu Art102 B‑VG.
2.3.3.5. Der Verfassungsgerichtshof hat den Umfang der zu prüfenden und allenfalls aufzuhebenden Bestimmungen derart abzugrenzen, dass einerseits nicht mehr aus dem Rechtsbestand ausgeschieden wird, als Voraussetzung für den Anlassfall ist, dass aber andererseits der verbleibende Teil keine Veränderung seiner Bedeutung erfährt; da beide Ziele gleichzeitig niemals vollständig erreicht werden können, ist in jedem Einzelfall abzuwägen, ob und inwieweit diesem oder jenem Ziel der Vorrang vor dem anderen gebührt (VfSlg 7376/1974, 16.929/2003, 16.989/2003, 17.057/2003, 18.227/2007, 19.166/2010, 19.698/2012).
2.3.3.6. Zur Bereinigung der Rechtslage erweist sich die Aufhebung von §23 Abs4 und des damit in Zusammenhang stehenden §23 Abs1 zweiter, dritter und vierter Satz, Abs2 zweiter, dritter, vierter und fünfter Satz, Abs6 und 7 G‑ZG als erforderlich.
2.3.4. Zum Bedenken im Hinblick auf Art18 Abs1 iVm Art83 Abs2 B‑VG
2.3.4.1. Der Verfassungsgerichtshof ging vorläufig davon aus, dass die "Gesundheitsplanungs GmbH" die ausgewiesenen Teile des ÖSG bzw der RSG für verbindlich zu erklären habe, wobei die Gesundheitsplanungs GmbH gemäß §23 Abs3 G‑ZG (zumindest) über zwei Organe verfüge, nämlich das Kollegialorgan Generalversammlung, die kraft gesetzlicher Anordnung ihre Beschlüsse einstimmig zu fassen habe, und die monokratisch organisierte Geschäftsführung. Weder §23 Abs4 G‑ZG noch das NÖGUS‑G 2006, das Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013 oder das Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 dürften aber festlegen, welches Organ der Gesundheitsplanungs GmbH für den Akt der Verordnungserlassung zuständig sein solle. Der Verfassungsgerichtshof hegte daher vorläufig das Bedenken, dass es Art18 Abs1 B‑VG iVm Art83 Abs2 B‑VG und dem daraus abzuleitenden Gebot der exakten Regelung von Behördenzuständigkeiten widerstreiten dürfte, wenn die zitierten Bestimmungen zwar die Gesundheitsplanungs GmbH mit Aufgaben der Erlassung von Verordnungen beleihen, aber offenlassen dürften, welches von mehreren in Betracht kommenden Gesellschaftsorganen konkret dafür zuständig sei.
2.3.4.2. Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass es im Hinblick auf Art18 Abs1 iVm Art83 Abs2 B‑VG zulässig sei, einer GmbH durch Gesetz die Kompetenz zur Ausübung von Hoheitsgewalt zu übertragen, ohne im Gesetz ausdrücklich festzulegen, welches Organ der beliehenen Gesellschaft zur Willensbildung betreffend die Erlassung des Hoheitsaktes zuständig sei und begründet dies wie folgt:
Art83 Abs2 B‑VG binde auch die Gesetzgebung und bedeute nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, dass die sachliche Zuständigkeit der Behörden im Gesetz selbst festgelegt sein müsse (Hinweis auf VfSlg 2909/1955, 3156/1957, 6675/1972). Art18 iVm Art83 Abs2 B‑VG verpflichte die Gesetzgebung zu einer – strengen Prüfungsmaßstäben standhaltenden – präzisen Regelung der Behördenzuständigkeit (Hinweis auf VfSlg 19.991/2015). Die Zuständigkeitsfestlegung müsse klar und unmissverständlich sein (Hinweis auf VfSlg 19.965/2015).
§23 Abs1, 2, 4, 5 und 6 G‑ZG ermächtige übereinstimmend die Gesundheitsplanungs GmbH zur Erlassung einer Verordnung. Behörde sei somit nach dem klaren Wortlaut die Gesundheitsplanungs GmbH selbst, nicht jedoch eines ihrer Organe. Auch auf Grund der Materialien sei nicht zweifelhaft, dass die Gesundheitsplanungs GmbH selbst beliehen werden solle (Hinweis auf Erläut zur RV 1333 BlgNR 25. GP , 9 f.).
Es sei der Gesetzgebung auch grundsätzlich erlaubt, eine juristische Person des Privatrechts zur Ausübung von Hoheitsgewalt zu ermächtigen und damit dieser selbst die Stellung einer Behörde einzuräumen. Es sei nicht ersichtlich, dass es verfassungsrechtlich geboten wäre, dass nicht der Rechtsträger selbst, sondern lediglich eines seiner Organe Behörde sein dürfe (Hinweis auf Wiederin, Verbandskompetenzen, Behördenzuständigkeiten und Organbefugnisse in der sonstigen Selbstverwaltung, FS Kopetzki, 2019, 723 [727 ff.]). So würden auch an anderen Stellen juristische Personen des Privatrechts – nicht jedoch eines ihrer Organe – gesetzlich zur Ausübung von Hoheitsgewalt ermächtigt, so beispielsweise die Austro Control GmbH, die GIS Gebühren Info Service GmbH, die Schienen-Control‑GmbH oder die Rundfunk und Telekom Regulierungs‑GmbH. Der Verfassungsgerichtshof habe in seiner bisherigen Rechtsprechung zu Beleihungen keine grundsätzlichen Bedenken dagegen erhoben, eine juristische Person des Privatrechts selbst zu beleihen (Hinweis auf VfSlg 14.473/1996 und 19.307/2011).
Da der Gesundheitsplanungs GmbH selbst – in verfassungsrechtlich zulässiger Weise – die Stellung einer Behörde zukommen solle, entspreche es nach Auffassung der Bundesregierung auch den Anforderungen des Art18 Abs1 iVm Art83 Abs2 B‑VG, die Gesundheitsplanungs GmbH (und eben nicht eines ihrer Organe) als zuständige Behörde im Gesetz zu bezeichnen (Hinweis auf Wiederin, Die Beleihung, in: Fuchs/Merli/Pöschl/Sturn/Wiederin/Wimmer [Hrsg.], Staatliche Aufgaben, private Akteure II, 2017, 31 [62]).
Im Schrifttum werde demgegenüber teilweise die Auffassung vertreten, dass die Beleihung einer juristischen Person des Privatrechtes gegen das Recht auf den gesetzlichen Richter verstoße, wenn sich das zuständige Organ nicht schon aus dem Gesetz ergebe (Hinweis auf Kopetzki, Unterbringungsrecht I, 1995, 205 FN 1369 mwN). Diesem Bedenken werde aber zutreffend entgegengehalten, dass es nur dann stichhaltig wäre, wenn ein bestimmtes Organ der juristischen Person und nicht die juristische Person selbst Behörde wäre. Sollte jedoch die juristische Person selbst Behörde sein, dann sei mit ihrer Benennung im beleihenden Gesetz dem Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter Genüge getan (Hinweis auf Wiederin, Beleihung, 62).
Welches Organ der Gesundheitsplanungs GmbH zuständig sei, den behördlichen Willen zu bilden und die Kundmachung des Hoheitsaktes zu bewirken, müsse sich nicht bereits aus dem Gesetz ergeben. Denn sofern die juristische Person selbst Behörde sei, beträfen diese Fragen nicht die behördliche Zuständigkeit, sondern lediglich die innerbehördliche Organisation, die nicht im Gesetz geregelt werden müsse:
Der Verfassungsgerichtshof habe in ständiger Rechtsprechung ausgesprochen, dass die innere Einrichtung der Behörde, ihre Gliederung in Sektionen, Abteilungen usw durch interne Verwaltungsmaßnahmen geregelt werden könne (Hinweis auf VfSlg 13.578/1993). Auch die Regelung der Approbationsbefugnis sei nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes eine Angelegenheit der inneren Organisation, die die Zuständigkeit der Behörde und damit auch das Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter nicht berühre (VfSlg 10.338/1985). Diese Grundsätze seien auch auf die innere Organisation von beliehenen Gesellschaften des Privatrechts zu übertragen.
Soweit der Verfassungsgerichtshof zu bedenken gebe, dass erhebliche Unterschiede in der Willensbildung zwischen den Organen der Gesundheitsplanungs GmbH bestünden, sei darauf hinzuweisen, dass solche Divergenzen in jeder Behörde auftreten könnten. Art18 Abs1 iVm Art83 Abs2 B‑VG werde dadurch aber nicht berührt, weil innerbehördliche Divergenzen nicht die Zuständigkeit der Behörde betreffen würden.
Angesichts der verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit könne daher dahingestellt bleiben, ob sich aus den gesetzlichen Regelungen des Gesellschaftsrechts Anhaltspunkte für die innergesellschaftliche Zuständigkeit ergeben und welches Organ der Gesundheitsplanungs GmbH zuständig sei, den behördlichen Willen zu bilden und die Verordnung kundzumachen. Der Vollständigkeit halber sei jedoch darauf hinzuweisen, dass der Geschäftsführer einer beliehenen Gesellschaft gemäß den §§18 f. GmbHG zur Willensbildung betreffend die Erlassung von Hoheitsakten zuständig sei. Denn nach diesen Vorschriften würde die Gesellschaft nach außen vom Geschäftsführer vertreten, und bei einem Hoheitsakt wie einem Bescheid oder einer Verordnung handle es sich um einen Akt, der nach außen gerichtet sei. Demgemäß sei auch in der Geschäfts- und Verfahrensordnung der Gesundheitsplanungs GmbH vorgesehen, dass der Geschäftsführer zuständig sei, den jeweiligen Verordnungsentwurf zu unterzeichnen und ihn als Verordnung der GmbH im RIS kundzumachen (Hinweis auf §1 Z1 litb und §3 der Geschäfts- und Verfahrensordnung). Die Geschäftsführung – bestehend aus einem Geschäftsführer und zwei Stellvertretern – werde durch die Generalversammlung bestellt (Hinweis auf §23 Abs3 G‑ZG). Die Bestellung könne gemäß §16 Abs1 GmbHG jederzeit widerrufen werden. Nach allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen könne die Generalversammlung dem Geschäftsführer auch jederzeit Weisungen erteilen (Hinweis auf Enzinger, §20, in: Straube/Ratka/Rauter [Hrsg.], WK GmbHG, Rz 30 [Stand 1.11.2018, rdb.at]). Vor diesem Hintergrund würden sich nach Ansicht der Bundesregierung auch die im Prüfungsbeschluss dargelegten Bedenken des Verfassungsgerichtshofes, wonach erhebliche Unterschiede in der Willensbildung zwischen den Organen der Gesundheitsplanungs GmbH bestehen dürften, als unbegründet erweisen. Denn die Geschäftsführung sei insofern von der Generalversammlung "abhängig", als sie von dieser ernannt und abberufen werde und an ihre Weisungen gebunden sei. Divergenzen zwischen den Organen der Gesellschaft würden daher in der Praxis kaum vorkommen bzw könnten von der Generalversammlung – durch eine Weisung oder Neubestellung der Geschäftsführung – ausgeräumt werden.
2.3.4.3. Die Wiener Landesregierung vertritt die Auffassung, dass mangels gesetzlicher Regelung des zuständigen Organs auf die allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen des GmbHG zurückzugreifen sei, die zwingend die Geschäftsführung und die Generalversammlung als Organe vorsehen würden. Die Generalversammlung habe die durch §35 GmbHG gesetzlich zugewiesenen Aufgaben; im Gesellschaftsvertrag könnten ihr weitere Aufgaben zugewiesen werden. Da die Erlassung der in Rede stehenden Verordnungen der einzige Unternehmensgegenstand der Gesundheitsplanungs GmbH sei, könne dafür nur die Geschäftsführung zuständig sein, weil sie andernfalls keinen Aufgabenbereich in Bezug auf den einzigen Unternehmensgegenstand der Gesellschaft habe. §10 Abs1 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz sei daher in Zusammenschau mit den gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen hinreichend exakt.
2.3.4.4. Das Bedenken des Verfassungsgerichtshofes konnte im Gesetzesprüfungsverfahren zerstreut werden:
Der Verfassungsgerichtshof hegte schon in seiner bisherigen Rechtsprechung (vgl etwa VfSlg 14.473/1996, 19.307/2011) keine prinzipiellen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Beleihung einer juristischen Person privaten Rechts als solcher (und nicht bloß einzelner ihre Organe) und sieht sich nicht veranlasst, von dieser Rechtsprechung abzugehen.
Die Bundesregierung und die Wiener Landesregierung haben im Ergebnis zutreffend darauf hingewiesen, dass sich aus der Zusammenschau des §23 G‑ZG (bzw der entsprechenden landesgesetzlichen Beleihungsanordnungen) mit §18 GmbHG die Zuständigkeit der Geschäftsführung zur Verbindlicherklärung der Gesundheits-Strukturpläne ergibt, weil und solange der zuständige Gesetzgeber keine abweichende Regelung vorsieht. Die insofern in Prüfung gezogenen Bestimmungen verstoßen daher nicht gegen Art18 Abs1 iVm Art83 Abs2 B‑VG.
2.3.5. Zum Bedenken der Zulässigkeit der Beleihung im Hinblick auf Art12 Abs1 Z1 B‑VG
2.3.5.1. §23 Abs5 G‑ZG ordnet als Grundsatzbestimmung an, dass die Landesgesetzgebung vorzusehen hat, dass die Gesundheitsplanungs GmbH jene ausgewiesenen Teile des ÖSG und der jeweiligen RSG, welche Angelegenheiten des Art12 B‑VG betreffen, für verbindlich erklärt.
Gegen diese Bestimmung hegte der Verfassungsgerichtshof in seinem Prüfungsbeschluss zusammengefasst das Bedenken, dass es dem Bundes-Grundsatzgesetzgeber nach Art12 Abs1 Z1 B‑VG verwehrt sein dürfte, die Länder zu Beleihungen zu verpflichten, weil damit ein Abweichen von der landesrechtlich zu regelnden Landesorganisation verbunden sein dürfte.
2.3.5.2. Die Bundesregierung tritt diesem Bedenken wie folgt entgegen:
Die Festlegung der behördlichen Zuständigkeit falle in die Kompetenz der jeweiligen Materiengesetzgebung (Hinweis auf VfSlg 2425/1952). Die Bundesgesetzgebung sei daher im Rahmen ihrer Grundsatzkompetenz gemäß Art12 Abs1 Z1 B‑VG ("Heil- und Pflegeanstalten") als Materiengesetzgebung grundsätzlich auch zuständig, die behördliche Zuständigkeit zu regeln. Die Grundsatzgesetzgebung habe sich auf die Aufstellung von Grundsätzen zu beschränken und dürfe über diese im Art12 B‑VG gezogene Grenze hinaus nicht Einzelregelungen treffen, die der Landesgesetzgebung vorbehalten seien (Hinweis auf VfSlg 16.244/2001). Diese Grenzen würden im Allgemeinen dann nicht überschritten, wenn das Grundsatzgesetz Fragen von grundsätzlicher Bedeutung regle, die einer für das ganze Bundesgebiet einheitlichen Regelung bedürften (Hinweis auf VfSlg 2087/1951). Der Grundsatzgesetzgebung sei es auch nicht verwehrt, Regelungen betreffend die Zuständigkeit zur Vollziehung des Ausführungsgesetzes vorzusehen. So habe der Verfassungsgerichtshof eine grundsatzgesetzliche Regelung, nach der die Landesgesetzgebung die Landesregierungen zu verpflichten habe, einen Landeskrankenanstaltenplan durch Verordnung zu erlassen, im Hinblick auf Art12 Abs1 Z1 B‑VG als unbedenklich qualifiziert (Hinweis auf VfSlg 17.232/2004). Vor diesem Hintergrund gehe die Bundesregierung davon aus, dass die Grundsatzgesetzgebung die Ausführungsgesetzgebung auch verpflichten dürfe, die Zuständigkeit eines bestimmten Organs zur Erlassung einer Verordnung vorzusehen, durch die ausgewiesene Teile des ÖSG und der RSG für verbindlich erklärt würden. Denn durch diese Verordnungserlassung würde eine umfassende und integrative Planung des österreichischen Gesundheitswesens sichergestellt (Hinweis auf Erläut zur RV 1333 BlgNR 25. GP , 9 f.). Die Zuständigkeit zur Erlassung dieser Verordnungen stelle damit eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung dar, die einer für das ganze Bundesgebiet einheitlichen Regelung bedürfe und daher vom Bund als Grundsatzgesetzgeber geregelt werden dürfe. In diesem Sinne habe auch der Verfassungsgerichtshof in VfSlg 17.232/2004 anerkannt, dass die Krankenanstaltenplanung nach bundesweit einheitlichen Grundsätzen und Zielen erfolge, um ihren Zweck zu erfüllen. Die Grundsatzgesetzgebung dürfe auch vorsehen, dass ein privater Rechtsträger durch die Landesgesetzgebung mit einer bestimmten Kompetenz zu beleihen sei. Denn dies sei eine Regelung über die behördliche Zuständigkeit, welche die Organisation der Behörden der Länder nicht betreffe:
Durch eine Beleihung werde eine Person, welche im organisatorischen Sinn kein Staatsorgan sei, zu einem Staatsorgan im funktionellen Sinn. Die Organisation der staatlichen Behörden (iSd Art10 Abs1 Z16 und Art15 Abs1 B‑VG) bleibe hiedurch grundsätzlich unberührt. Auf Grund dieser Organisationskompetenzen seien der Bund und die Länder nämlich nur zuständig, ihre jeweiligen Organe im organisatorischen Sinn zu errichten und einzurichten (Hinweis auf Lukan, Die Kreation von Verwaltungsorganen, 2018, 183 mwN). Durch eine Beleihung werde aber weder ein Staatsorgan im organisatorischen Sinn errichtet noch erfolge eine Umbildung der bestehenden Organisation der staatlichen Behörden. Würde man der gegenteiligen Auffassung folgen, so müsste man konsequenterweise annehmen, dass zur Übertragung von Hoheitsgewalt an Private allein die Organisationsgesetzgebung (insb. Art10 Abs1 Z16 und Art15 Abs1 B‑VG) zuständig sei, was jedoch mit der Auffassung, dass Zuständigkeitsregelungen durch Materiengesetz zu treffen seien, nur schwer vereinbar wäre (Hinweis auf Baumgartner, ZfV 2018, 262 FN 86 mwN). Träfe das Bedenken des Verfassungsgerichtshofes zu, so hätte dies schließlich zur Folge, dass in allen Angelegenheiten, die in der Gesetzgebung Landessache seien (wozu strukturell auch jene des Art12 B‑VG gehören würden), die Beleihung einer nicht durch Landesgesetz errichteten "Landesbehörde" ausgeschlossen wäre. Denn auch eine solche Regelung müsste – so man ihr die Prämissen des Prüfungsbeschlusses zugrunde legen würde – dahingehend gedeutet werden, dass sich die Landesgesetzgebung ihrer Kompetenz zur Organisation der Landesbehörden entledige, was aber verfassungsrechtlich nicht zulässig wäre. Auch eine Delegation der Gesetzgebungskompetenz der Länder betreffend ihre Landesbehörden auf den Bund sehe das B‑VG nicht vor. Dass es – im Hinblick auf die Trennung der Vollziehungsbereiche von Bund und Ländern – aber zulässig sei, landesgesetzlich einer durch Bundesgesetz eingerichteten privatrechtlichen Gesellschaft hoheitliche Befugnisse der Landesvollziehung zu übertragen, habe der Verfassungsgerichtshof in VfSlg 17.421/2004 zumindest implizit vorausgesetzt (Hinweis auf Pürgy, ZfV 2011, 746 f.). Vor diesem Hintergrund begegne auch die Beleihung einer bundesgesetzlich eingerichteten GmbH in den Angelegenheiten des Art12 B‑VG keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Ob es der Grundsatzgesetzgebung auch erlaubt wäre, die Ausführungsgesetzgebung zur Errichtung (und Beleihung) eines bestimmten privaten Rechtsträgers zu verpflichten, könne in diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben (wäre aber wohl zu verneinen).
Die Bundesregierung könne daher nicht erkennen, dass §23 Abs5 G‑ZG eine kompetenzwidrige Regelung über die Organisation der Landesbehörden wäre. Durch die Bestimmung würden die Länder verpflichtet, eine bestimmte hoheitliche Zuständigkeit eines bestimmten privaten Rechtsträgers zu begründen. Jedoch würden die Länder nicht verpflichtet, spezielle Landesbehörden zu errichten oder die Organisation der Landesbehörden in sonstiger Weise umzubilden.
Das Schrifttum verweise in diesem Zusammenhang auch auf die früheren krankenanstaltenrechtlichen Schiedskommissionen (Hinweis auf Stöger, Gesundheitsreform 2017, 22). In den §§28a und 28b Krankenanstaltengesetz (KAG), BGBl 1/1957, idF BGBl 281/1984 sei (als Grundsatzbestimmung) vorgesehen gewesen, dass in jedem Land eine Schiedskommission einzurichten sei. Die Vorschriften hätten nähere organisationsrechtliche Vorgaben etwa über die Zusammensetzung der Schiedskommissionen enthalten. Diese Bestimmungen seien durch ArtI Z22 BGBl 282/1988 aufgehoben worden. In den Materialien (Erläut zur RV 546 BlgNR 17. GP , 16 f.) werde dazu ausgeführt, dass die Aufhebung der Bestimmungen über Schiedskommissionen im Hinblick auf die durch die Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1974, BGBl 444, erfolgte Aufhebung der Grundsatzkompetenz des Bundes betreffend die "Organisation der Verwaltung in den Ländern" geboten sei: Da die Bildung und Errichtung von Verwaltungsbehörden nunmehr ausschließlich Sache der Landesgesetzgebung nach Art15 Abs1 B‑VG sei, könnten auch im (grundsatzgesetzlichen) Krankenanstaltengesetz des Bundes Vorschriften über Schiedskommissionen nicht mehr getroffen werden, weil es sich bei diesem um (Sonder‑)Verwaltungsbehörden der Länder handle. Daraus könne aber nach Ansicht der Bundesregierung kein Argument gegen die Kompetenzkonformität des §23 Abs5 G‑ZG gewonnen werden. Denn im Unterschied zu den §§28a und 28b KAG werde die Landesgesetzgebung durch §23 Abs5 G‑ZG nicht verpflichtet, spezielle Landesbehörden im organisatorischen Sinn einzurichten, sondern einem privaten Rechtsträger eine Zuständigkeit zu übertragen. Die kompetenzrechtlichen Bedenken gegen die Einrichtung von Schiedskommissionen würden daher gegen §23 Abs5 G‑ZG nicht verfangen.
Zusammengefasst ist die Bundesregierung daher der Auffassung, dass §23 Abs5 G‑ZG kompetenzkonform sei.
2.3.5.3. Die Wiener Landesregierung gibt zu bedenken, dass "materienspezifische Organisationsvorgaben" in den Angelegenheiten der Heil- und Pflegeanstalten von der Materienkompetenz mitumfasst seien.
2.3.5.4. Das Bedenken des Verfassungsgerichtshofes erweist sich als zutreffend:
Der Verfassungsgerichtshof hat bereits in seinem Prüfungsbeschluss festgehalten, dass er keine kompetenzrechtlichen Bedenken dagegen hegt, dass der Bundes‑Grundsatzgesetzgeber (in grundsätzlichen Fragen) die Zuständigkeit zu Vollzugsakten auf dem Gebiet des Krankenanstaltenrechtes bestehenden Landesbehörden zuordnet, weil die Festlegung der sachlichen Zuständigkeit zum materiellen Recht iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG zählt (vgl VfSlg 17.232/2004). Dem Bundesgesetzgeber ist es im Rahmen des Art12 Abs1 Z1 B‑VG jedoch verwehrt, den Landesgesetzgeber zur Einrichtung neuer Landesbehörden zu verpflichten, weil er damit in die Landes-Organisationskompetenz (Art15 Abs1 B‑VG) eingreifen würde (vgl VfSlg 8833/1980, 8834/1980). Auch die Anordnung einer Beleihung geht über den Rahmen der Kompetenz nach Art12 Abs1 Z1 B‑VG, den auch der Grundsatzgesetzgeber zu beachten hat, hinaus, weil sie den Landesgesetzgeber zu organisationsrechtlichen Maßnahmen verpflichtet, die nach Art15 Abs1 B‑VG in die Gesetzgebungsautonomie der Länder fallen. Aus allgemeinen staatsorganisationsrechtlichen Grundsätzen folgt nämlich, dass eine Beleihung eine gesetzliche Einbindung in den Weisungs‑, Leitungs- und Verantwortungszusammenhang zu den obersten Organen der Vollziehung bedingt (vgl nur etwa VfSlg 14.473/1996). Indem der Bundes‑Grundsatzgesetzgeber den Landesgesetzgeber zu einer Beleihung verpflichtet, verpflichtet er ihn – sei es explizit wie im §23 Abs8 G‑ZG, sei es implizit unmittelbar kraft verfassungsrechtlich gebotener Verantwortungszusammenhänge – auch dazu, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um den beliehenen Rechtsträger funktionell in das Organisationsgefüge des Landes einzubinden. Solche Regelungen gehen aber über das materielle Krankenanstaltenrecht iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG hinaus und haben bereits landes-organisationsrechtliche Implikationen iSv Art15 Abs1 B‑VG.
Der Verfassungsgerichtshof sieht sich im Ergebnis auch noch durch folgende Überlegung bestätigt: Wie oben ausgeführt, verlangt Art102 Abs1 B‑VG bereits bei einer Beleihung eines privaten Rechtsträgers in Unterordnung unter den Landeshauptmann in Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes, soweit diese in mittelbarer Bundesverwaltung wahrzunehmen sind, die Zustimmung der Länder. Mit diesen Wertungen des B‑VG wäre kaum vereinbar, wenn der Bundesgesetzgeber die Länder selbst gegen deren Willen verpflichten könnte, den ureigenen Bereich der Landesverwaltung, wenn auch nur in einzelnen Angelegenheiten, durch beliehene Rechtsträger (anstatt durch eigene Landesbehörden) wahrnehmen zu müssen.
An diesem Ergebnis vermag auch eine allfällige Vereinbarung nach Art15a B‑VG nichts zu ändern, weil diese bloß eine vertragliche Bindung zwischen den Vertragsparteien zur Folge hat, die übernommenen Verpflichtungen im Rahmen der Bundesverfassung zu erfüllen. Solche Vereinbarungen modifizieren daher insbesondere nicht die bundesstaatliche Kompetenzverteilung.
Die Beleihungsanordnung des §23 Abs5 G‑ZG (ebenso der damit in Zusammenhang stehende §23 Abs8 G‑ZG) erweist sich damit als verfassungswidrig.
Durch die Aufhebung von §23 Abs5 und 8 G‑ZG ist (in dieser Hinsicht) ein grundsatzfreier Raum hergestellt, in dem die Länder ohne Bindung an grundsatzgesetzliche Vorgaben des Bundes entscheiden können, ob sie die Gesundheitsplanungs GmbH mit Aufgaben der Verbindlicherklärung von Strukturplänen beleihen oder nicht bzw eine bereits vorgenommene Beleihung beibehalten oder zurücknehmen (eine andere Frage ist, ob eine Verpflichtung aus einer Vereinbarung nach Art15a B‑VG besteht). Die Aufhebung von §23 Abs5 und 8 G‑ZG hat daher nicht zur Folge, dass die Länder die erfolgte Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH revidieren müssten.
2.3.6. Zum Bedenken im Hinblick auf die Bezeichnungspflicht nach Art12 B‑VG
2.3.6.1. Weiters hegte der Verfassungsgerichtshof das Bedenken, dass die §§18, 19 und 20 Abs1 und 2 G‑ZG gegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG verstoßen würden: §23 Abs4 und 5 G‑ZG sehe die Erlassung von Teilen des ÖSG bzw der RSG als Verordnung vor, und zwar sowohl solcher Teile, die – als Verordnung – Gesundheitswesen iSv Art10 B‑VG regeln würden, als auch solcher Teile, die – als Verordnung – Krankenanstaltenrecht iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG zum Gegenstand hätten. Der Verfassungsgerichtshof ging im Prüfungsbeschluss davon aus, dass diese Verordnungen durch die §§18, 19, 20 Abs1 und 2 G‑ZG determiniert würden, die als unmittelbar anwendbares Bundesrecht erlassen worden seien. Diese Bestimmungen seien aber – so das Bedenken des Verfassungsgerichtshofes – als gesetzliche Determinierung von – auch – krankenanstaltenrechtlichen Verordnungen (insofern) entgegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG als Bundesgesetz und nicht als Grundsatzgesetz erlassen worden.
2.3.6.2. Die Bundesregierung hält diesem Bedenken entgegen, dass sich die genannten Bestimmungen auf die Kompetenztatbestände der Art10 Abs1 Z11 ("Sozialversicherungswesen") und Art10 Abs1 Z12 B‑VG ("Gesundheitswesen") stützen könnten. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die (Bundes‑)Gesetzgebung im Hinblick auf den Umstand, dass keine entsprechenden (ausdrücklich als solche bezeichneten) Grundsatzbestimmungen erlassen worden seien, von ihrer Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung in den Angelegenheiten der "Heil- und Pflegeanstalten" (Art12 Abs1 Z1 B‑VG) keinen Gebrauch gemacht habe, zumal im G‑ZG an anderen Stellen sehr wohl von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht worden sei (Hinweis auf §21 Abs2, 4 und 6, §23 Abs5 und 8 und §24 G‑ZG). Insoweit der Bund keine Grundsätze aufgestellt habe, könne die Landesgesetzgebung die Angelegenheit frei regeln (Art15 Abs6 fünfter Satz B‑VG).
Dem könne auch nicht entgegengehalten werden, dass der Anwendungsbereich der genannten Bestimmungen nicht auf die Angelegenheiten des Art10 Abs1 Z11 und 12 B‑VG eingeschränkt werde (so wie dies in den Grundsatzbestimmungen in Bezug auf Art12 Abs1 Z1 B‑VG gehandhabt werde), weil eine solche Einschränkung in den sonstigen Bestimmungen, die – zumindest theoretisch – auch Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG betreffen könnten, einerseits nur dort vorgesehen sei, wo eine Klarstellung unbedingt erforderlich sei (Hinweis auf §23 Abs4 und 7 G‑ZG), und sich andererseits ein solch eingeschränkter Anwendungsbereich ohnedies aus der salvatorischen Klausel in §1 Abs1 G‑ZG ergebe. Die in Prüfung gezogenen Bestimmungen seien daher kompetenzkonform.
2.3.6.3. Die Bedenken haben sich zerstreut:
Gemäß §1 Abs1 zweiter Satz G‑ZG und im Hinblick auf die Art15a B‑VG-Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens berührt das G‑ZG "nicht die Zuständigkeiten der Länder zur Gesetzgebung und Vollziehung". Die §§18, 19 und 20 Abs1 und 2 G‑ZG sind in diesem Sinne auf Planungsangelegenheiten reduziert, die in Gesetzgebung und Vollziehung, insbesondere als Angelegenheiten des Gesundheits- und des Sozialversicherungswesens, Bundessache sind. Dazu zählen – ungeachtet der Landeskompetenz zur konkreten Krankenanstaltenplanung (VfSlg 17.232/2004) – auch die gesamthafte integrative Planung im Bereich des Gesundheitswesens (inklusive Krankenanstalten), etwa durch Vorgabe gemeinsamer Planungsziele, dann die Grundlagenforschung durch Erhebung der Tatsachengrundlagen auch betreffend den Krankenanstaltenbereich und die Planung des niedergelassenen Bereiches unter Berücksichtigung der Gegebenheiten im Krankenanstaltenwesen. Die angefochtenen Bestimmungen können im Sinne solcher Inhalte verfassungskonform verstanden werden. Die §§18, 19 und 20 Abs1 und 2 G‑ZG sind daher nicht als verfassungswidrig aufzuheben (die landesgesetzlichen Determinanten des ÖSG sind hier nicht zu beurteilen).
2.3.6.4. Soweit der Verfassungsgerichtshof in seinem Prüfungsbeschluss das Bedenken erhoben hat, die Verfahrensbestimmungen des §23 Abs1 vorletzter und letzter Satz und Abs2 vorletzter und letzter Satz G‑ZG würden ebenfalls gegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG verstoßen, weil diese nicht als Grundsatzgesetz bezeichneten Verfahrensbestimmungen auch krankenanstaltenrechtliche Verordnungen zum Gegenstand haben dürften, erübrigt sich ein weiteres Eingehen auf dieses Bedenken, weil die betreffenden Bestimmungen bereits infolge ihres Zusammenhanges mit der gegen Art102 B‑VG verstoßenden Beleihungsbestimmung des §23 Abs4 G‑ZG aufzuheben sind (siehe oben III.2.3.3.6.).
2.3.7. Zum Bedenken im Hinblick auf die Freiheit der Erwerbsausübung (Art6 StGG)
2.3.7.1. Schließlich hat der Verfassungsgerichtshof gegen §3a Abs3a KAKuG, §10c Abs3 NÖ KAG und §6a Abs6a Oö. KAG 1997 das Bedenken gehegt, dass die dort grundsatzgesetzlich bzw ausführungsgesetzlich vorgesehene Bedarfsprüfung unter Bindung an die ÖSG- und RSG‑Verordnungen zu einer "starren Kontingentierung" führe, die in Widerspruch zur verfassungsgesetzlich gewährleisteten Erwerbsfreiheit stehen dürfte.
2.3.7.2. Nach Auffassung der Bundesregierung sei §3a Abs3a KAKuG zur Erreichung legitimer Ziele geeignet, adäquat und auch sonst sachlich gerechtfertigt im Sinne der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zum Gesetzesvorbehalt zur Erwerbsfreiheit: Gemäß §3a Abs3a KAKuG sei für den Fall, dass der beantragte Leistungsumfang des selbstständigen Ambulatoriums in den Verordnungen gemäß §23 (oder §24) G‑ZG geregelt sei, hinsichtlich des Bedarfs die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen. Diese Regelung sei Konsequenz des im G‑ZG vorgesehenen Konzepts: Der ÖSG und die RSG würden der integrativen Planung der Gesundheitsversorgungsstruktur in Österreich dienen. Dieses Ziel könne insbesondere dann effektiv verwirklicht werden, wenn die Gesundheitspläne rechtsverbindlich seien. Die Rechtsverbindlichkeit werde im Rahmen des im G‑ZG vorgesehenen Verfahrens hergestellt. §3a Abs3a KAKuG setze die Rechtsverbindlichkeit der Gesundheitspläne im Genehmigungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb selbstständiger Ambulatorien um, indem die Behörde verpflichtet werde, anstatt einer Bedarfsprüfung im Einzelfall (§3a Abs2 Z1 KAKuG) ausschließlich zu prüfen, ob das Vorhaben mit den durch Verordnung für verbindlich erklärten Gesundheitsplänen übereinstimme (Hinweis auf Erläut zur RV 1333 BlgNR 25. GP , 11). §3a Abs3a KAKuG verwirkliche damit die legitimen Ziele der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Dies komme auch und vor allem den Bewilligungswerbern selbst zugute, weil sie auf Grundlage der verbindlichen Planungsakte Klarheit über die Aussichten eines Bewilligungsantrages hätten. Nach Ansicht der Bundesregierung mache es auch keinen Unterschied, ob die Bewilligungsvoraussetzungen im Einzelfall anhand der gesetzlichen Vorgaben geprüft würden oder ob diese – gesetzlichen, gleichermaßen zur Anwendung gelangenden – antizipierend in einer Verordnung rechtsverbindlich hinreichend konkret festgelegt worden sei. Auch aus Sicht des Betroffenen mache es – in normativer Hinsicht – keinen Unterschied, ob die Kontingentierung im Einzelfall anhand des Gesetzes oder unter denselben Kriterien anhand der Verordnung erfolge. Schließlich würden auch Bedarfsprüfungen im Einzelfall im Ergebnis zur Kontingentierung von Leistungsangeboten führen. §3a Abs3a KAKuG (iVm den Vorschriften des G‑ZG) ziele nicht etwa darauf ab, das Leistungsangebot zu verringern und die Erwerbsfreiheit dadurch zusätzlich zu beschränken, sondern das Leistungsangebot in einem einheitlichen Verfahren festzulegen und damit bessere Planungssicherheit für alle Betroffenen – und damit auch für die Ausübung der Erwerbsfreiheit – herzustellen. Durch diese Konstruktion werde auch der Rechtsschutz der Bewilligungswerber nicht geschmälert: Der ÖSG und die RSG könnten, sofern sie durch Verordnung für verbindlich erklärt seien, durch den Verfassungsgerichtshof geprüft werden. Sollte ein Bewilligungswerber eine bestimmte in einem für verbindlich erklärten Gesundheitsplan vorgesehene Beschränkung für rechtswidrig halten, könne er diese Bedenken schließlich im Verfahren gemäß Art139 B‑VG an den Verfassungsgerichtshof herantragen. Bei einer Einzelfallprüfung sei gemäß §3a Abs3 KAKuG von den Festlegungen des (nicht durch Verordnung für verbindlich erklärten) jeweiligen RSG (als Sachverständigengutachten) auszugehen. Diese unterlägen in diesem Fall aber keiner entsprechenden Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof. Im Schrifttum sei §3a Abs3a KAKuG (und §3 Abs2b KAKuG) daher zutreffend als "deutliche Verbesserung" des Rechtsschutzes der Bewilligungswerber bezeichnet worden (Hinweis auf Stöger, Gesundheitsreform 2017, 27). Ferner könne §3a Abs3a KAKuG auch zur Einsparung von Sachverständigenkosten führen, die bei Püfung des Vorliegens eines Bedarfes im Einzelfall notwendigerweise anfielen; insofern diene die Regelung auch verwaltungsökonomischen Zwecken.
Zur Erforderlichkeit der Kontingentierung der Großgeräte weist die Bundesregierung auf den Zusammenhang mit dem Sozialversicherungsrecht hin: Gemäß §338 Abs2a ASVG idF BGBl I 210/2021 hätten sich die Versicherungsträger beim Abschluss von Verträgen an den von der Bundesgesundheitskommission (nunmehr: Bundes‑Zielsteuerungskommission) im Rahmen des ÖSG beschlossenen Großgeräteplan zu halten. Daran knüpfe auch das Leistungsrecht in der Krankenversicherung an. Gemäß §131 Abs1 ASVG gebühre dem Anspruchsberechtigten ein Ersatz der Kosten einer Krankenbehandlung iHv 80 %, wenn er nicht einen Vertragspartner eines Versicherungsträgers oder eigene Einrichtungen eines Versicherungsträgers zur Erbringung einer Sachleistung einer Krankenbehandlung in Anspruch nehme (Kostenerstattung). Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes gebühre dem Anspruchsberechtigten eine solche Kostenerstattung jedoch dann nicht, wenn die Versicherungsträger auf Grund des §338 Abs2a ASVG einen Vertrag nicht abschließen dürften (Hinweis auf OGH 1.6.1999, 10 ObS 365/98v; 29.6.1999, 10 ObS 6/99a; 1.6.2010, 10 ObS 79/10f). Das mit §338 Abs2a ASVG verfolgte Ziel, teurere Großgeräte auf einige wenige Standorte zu beschränken, würde sonst unterlaufen. In der Praxis werde dies als "Wahlarztsperre" bezeichnet. Aus §338 Abs2a ASVG sei auch abzuleiten, dass Untersuchungen mit Großgeräten als Sachleistung nur durch Betreiber von Krankenanstalten und nicht auch durch niedergelassene Ärzte erbracht werden dürften. Die in §338 Abs2a ASVG vorgesehene Beschränkung des Vertragspartnerrechtes diene, wie auch der Oberste Gerichtshof ausgesprochen habe, dem öffentlichen Interesse an einer Steuerung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung im Hinblick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit. Sie sollte die Rentabilität der bestehenden Großgeräte sicherstellen und ein Überangebot verhindern (OGH 1.6.2010, 10 ObS 79/10f) und damit auch die hohe Versorgungsqualität und die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung sicherstellen (Hinweis auf Grillberger, Wahlärzte, in: Grillberger/Mosler [Hrsg.], Ärztliches Vertragspartnerrecht, 2012, 240 [253 ff.]). Dabei handle es sich ohne Zweifel um ein legitimes öffentliches Interesse. Dieses Interesse sei für den sogenannten intramuralen Bereich dasselbe wie für den extramuralen Bereich. Die durchschnittlichen Tarife für Untersuchungen durch CT- und MRT‑Großgeräte durch nicht verrechnungsbefugte Ärzte lägen für CT bei mindestens € 150 und für MRT bei mindestens € 220. Es handle sich somit um kostenintensive Untersuchungen, weshalb ein besonderes öffentliches Interesse an Steuerungsmechanismen zur Kostenbegrenzung gegeben sei. Dass die Zahl der Großgeräte limitiert werden soll, erkläre sich auch daraus, dass in Österreich die Zahl der MRT‑Einheiten in der öffentlichen Gesundheitsversorgung zum Stand 2019 mit 19,8 je eine Million Einwohner über dem OECD‑Durchschnitt von 16,9 MRT‑Einheiten je eine Million Einwohner liege. Vergleichbares gelte für die Versorgung mit CT‑Geräten. Durch diese Zahl an Großgeräten sei demnach eine ausreichende und bedarfsgerechte Versorgung der Versicherten und ihrer anspruchsberechtigten Angehörigen sichergestellt. Demgegenüber könnte die Auffassung vertreten werden, dass eine Limitierung der Großgeräte deshalb unverhältnismäßig wäre, weil sie nicht nur der Verhinderung von Überkapazitäten diene, sondern auch der Beschränkung der Leistungen der Krankenversicherung. Dem sei allerdings entgegenzuhalten, dass eine solche Maßnahme zur Steuerung der Gesundheitsversorgung geeignet und sachgerecht sei, da in diesem Bereich eine angebotsinduzierte Nachfrage bestehe. Würde demnach die (ohnedies relativ hohe) Zahl der Großgeräte nicht kontingentiert, so hätte dies zwangsläufig eine unverhältnismäßig höhere finanzielle Belastung des Gesundheitswesens zur Folge. §3a Abs3a KAKuG sei daher im Hinblick auf Art6 StGG verfassungskonform.
2.3.7.3. Die Niederösterreichische Landesregierung vertritt in ihrer Stellungnahme die Auffassung, dass die Regelung der Konzessionserteilung keinen Eingriff in die Erwerbsausübungsfreiheit darstelle, weil die Regelung im öffentlichen Interesse, zur Erreichung der Ziele einer bestmöglichen Heilmittel- und ärztlichen Versorgung geeignet und nicht unverhältnismäßig sei (Hinweis auf VfSlg 18.513/2008). Auch das Bedarfsprüfungsverfahren im Krankenanstaltenrecht sei zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung im öffentlichen Interesse gelegen und für die nachhaltige Versorgung der Bevölkerung unerlässlich. Nur so könne für sämtliche Versorgungsbereiche eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung auf hohem Qualitätsniveau gewährleistet und könnten Versorgungslücken verhindert werden. Beim Verfassungsgerichtshof seien Anträge des Verwaltungsgerichtshofes auf Aufhebung von – die Bedarfsprüfung hinsichtlich selbstständiger Ambulatorien betreffenden – Bestimmungen des NÖ KAG anhängig gewesen. Diese Bestimmungen hätten sich jedoch aus den in VfSlg 19.529/2011 genannten Gründen nicht als verfassungswidrig erwiesen. §10c Abs3 NÖ KAG stelle insofern eine sachliche Regelung dar, als die Qualitätskriterien im ÖSG darauf abzielen würden, in den verschiedenen Versorgungsstrukturen österreichweit gleiche Versorgungsstandards zu erreichen. Mit dem ÖSG werde sichergestellt, dass die Gesundheitsversorgung in ganz Österreich ausgewogen verteilt und gut erreichbar sei und in vergleichbarer Qualität auf hohem Niveau angeboten werde. Der am 30. Juni 2017 von der Bundes‑Zielsteuerungskommission beschlossene ÖSG 2017 enthalte quantitative und qualitative Planungsvorgaben und ‑grundlagen für die bedarfsgerechte Dimensionierung der Versorgungskapazitäten bzw der Leistungsvolumina für ausgewählte Bereiche der ambulanten und der akutstationären Versorgung, für die ambulante und stationäre Rehabilitation und für medizinisch-technische Großgeräte. Bei der Erstellung des ÖSG 2017 seien insbesondere bestehende Angebote sowie demographische und epidemiologische Entwicklungen berücksichtigt worden. Das bedeutet, dass der Bund, die Länder und die Sozialversicherung bereits im Vorfeld bei der Erstellung des ÖSG 2017 die für eine harmonische und ausgewogene Verteilung der Ressourcen im Gesundheitssystem erforderlichen Überlegungen und Prüfungen angestellt hätten, um österreichweit eine gleichmäßige Versorgung der gesamten Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen sicherzustellen.
Hinsichtlich der Planung im Gesundheitswesen betone bereits der Gerichtshof der Europäischen Union, dass die Planung medizinischer Leistungen die Beherrschung der Kosten sicherstellen und soweit wie möglich jede Verschwendung finanzieller, technischer und menschlicher Ressourcen verhindern solle. Das Unionsrecht schließe nicht aus, dass die Infrastrukturen ambulanter Versorgung auch Gegenstand einer Planung sein könnten. Eine Planung, die eine vorherige Genehmigung für die Niederlassung neuer Anbieter medizinischer Leistungen verlange, könne sich als unerlässlich erweisen, um eventuelle Lücken im Zugang zu ambulanter Versorgung zu schließen. Weiters sei dies notwendig, um die Einrichtung von Strukturen einer Doppelversorgung zu vermeiden, sodass eine medizinische Versorgung gewährleistet sei, die den Bedürfnissen der Bevölkerung angepasst sei, das gesamte Staatsgebiet (daher nicht nur die Sozialversicherung) abdecke und geographisch isolierte oder auf andere Weise benachteiligte Regionen berücksichtige (Hinweis auf EuGH 10.3.2009, Rs. C‑169/07, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH).
Aus Sicht der Niederösterreichischen Landesregierung liege aus den genannten Gründen durch die getroffene Regelung kein überschießender Eingriff in den Schutzbereich des Grundrechtes auf Erwerbsfreiheit vor.
2.3.7.4. Die Bedenken des Verfassungsgerichtshofes konnten zerstreut werden:
Nach der Grundsatzbestimmung des §3a KAKuG ist die Errichtung selbständiger Ambulatorien grundsätzlich bewilligungspflichtig. Gemäß §3a Abs2 Z1 KAKuG darf die Errichtungsbewilligung ua nur erteilt werden, wenn nach dem angegebenen Anstaltszweck und dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot im Hinblick auf das (näher umschriebene) bestehende Versorgungsangebot "eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann", wobei bei der Beurteilung dieser Frage die in Abs3 leg. cit. genannten Kriterien zu berücksichtigen sind.
Gemäß §3a Abs3a KAKuG ist jedoch, wenn der Leistungsumfang in Verordnungen nach den §§23 f. G‑ZG geregelt ist, "hinsichtlich des Bedarfs" die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen; ist das Vorhaben nicht in den genannten Verordnungen geregelt, ist Abs3 sinngemäß anzuwenden. §6a Oö. KAG 1997 und §10c NÖ KAG enthalten entsprechende ausführungsgesetzliche Bestimmungen. Mit diesen Regelungen ist eine Bedarfsprüfung für selbständige Ambulatorien angeordnet. Von dieser Bedarfsprüfung sind selbständige Ambulatorien ausgenommen, nach deren vorgesehenem Leistungsangebot "ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen erbracht werden sollen" (§3a Abs4 KAKuG, §10c Abs5 NÖ KAG, §6a Abs7 Oö. KAG 1997).
Art6 StGG garantiert die Freiheit der Erwerbsbetätigung. Rechtliche Berufsantrittshindernisse sind nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nur zulässig, wenn sie durch ein öffentliches Interesse geboten, zur Zielerreichung geeignet, dieser adäquat und auch sonst sachlich zu rechtfertigen sind (vgl zB VfSlg 11.276/1987, 12.098/1989, 15.103/1998 und 15.740/2000). Errichtet das Gesetz eine Schranke schon für den Zugang zu einer Erwerbstätigkeit, die der Betroffene, der alle subjektiven Voraussetzungen erfüllt, aus eigener Kraft nicht überwinden kann (wie etwa eine Bedarfsprüfung), so liegt ein schwerer Eingriff in die verfassungsgesetzlich gewährleistete Erwerbsfreiheit vor, der nur angemessen ist, wenn dafür besonders wichtige öffentliche Interessen sprechen und wenn keine Alternativen bestehen, um den erstrebten Zweck in einer gleich wirksamen, aber das Grundrecht weniger einschränkenden Weise zu erreichen (VfSlg 13.023/1992).
Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes kommt der medizinischen Versorgung der Bevölkerung durch "gemeinnützige Einrichtungen", unabhängig davon, ob diese von einer Gebietskörperschaft, einem sonstigen Rechtsträger oder einer Privatperson betrieben werden, vorrangige Bedeutung zu, und zwar auch deshalb, weil durch öffentliche Mittel eine für den Einzelnen finanziell tragbare medizinische Behandlung sichergestellt wird (VfSlg 13.023/1992, 15.456/1999, 15.740/2000). Unter "gemeinnützigen Einrichtungen" versteht die Rechtsprechung in diesem Zusammenhang vor allem solche, die durch öffentliche Mittel (mit‑)finanziert werden und die ein wesentlicher Teil des der Volksgesundheit dienenden Systems der medizinischen Versorgung der Bevölkerung sind (VfSlg 15.456/1999). Die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz dieser Einrichtungen liegt daher nach ständiger Rechtsprechung im öffentlichen Interesse, sodass eine dem Konkurrenzschutz (Bestandsschutz) dienende Bedarfsprüfung vor dem die Erwerbsfreiheit verfassungsgesetzlich garantierenden Art6 StGG Bestand haben kann, sofern sie nicht unverhältnismäßig ist (VfSlg 15.456/1999, 15.610/1999, 15.613/1999, 17.848/2006). Der bloße Konkurrenzschutz von erwerbswirtschaftlich geführten Krankenanstalten untereinander rechtfertigt jedoch keine Bedarfsprüfung (VfSlg 13.023/1992, 14.552/1996, 15.740/2000).
Der Verfassungsgerichtshof bezweifelt nicht, dass eine geordnete Krankenanstaltenplanung der Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und allgemein zugänglichen medizinischen Versorgung und der Vermeidung einer erheblichen Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit (EuGH 10.3.2009, Rs. C‑169/07, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, Rz 47; VfSlg 15.456/1999, 19.607/2011) und damit dem wichtigen öffentlichen Interesse an einem funktionierenden Gesundheitswesen dient.
Die Bundesregierung hat zu Recht darauf hingewiesen, dass ein durch Verordnung für verbindlich erklärter Strukturplan (ÖSG, RSG), soweit er Bedarfe nach Ambulatorien etc. verbindlich festhält, der Sache nach nichts anderes als eine vorweggenommene, abstrakt-generelle Bedarfsprüfung darstellt. Soweit eine krankenanstaltenrechtliche Bedarfsprüfung zulässig ist (siehe vorhin), begegnet daher auch eine solche in Planform vorweggenommene abstrakt-generelle Bedarfsprüfung keinen prinzipiellen verfassungsrechtlichen Bedenken. Ob die Bedarfsbeurteilung in solchen als verbindlich erklärten Planungen konkret verfassungskonform festgelegt ist, insbesondere, ob sie dem Schutz der im öffentlichen Interesse liegenden öffentlichen, für den Einzelnen finanziell leistbaren Gesundheitsversorgung und der Sicherung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit dient, ist daher keine Frage der Verfassungsmäßigkeit des §3a Abs3a KAKuG bzw der dazu ergangenen Landes‑Ausführungsgesetze, sondern eine Frage der Gesetz-(Verfassungs‑)mäßigkeit der konkreten Strukturplan‑Verordnung.
2.4. Zu den Bedenken gegen die ÖSG VO 2018
2.4.1. Das Bedenken, die in Prüfung gezogenen Verordnungsbestimmungen seien vom unzuständigen Organ der Gesundheitsplanungs GmbH erlassen worden, hat sich zerstreut. Die (in Teilen) in Prüfung gezogenen Verordnungen wurden vom Geschäftsführer der Gesundheitsplanungs GmbH erlassen, der auch das dafür zuständige Organ ist (oben III.2.3.4.4.).
2.4.2. Der Verfassungsgerichtshof hat gegen die in Prüfung gezogenen Bestimmungen der ÖSG VO 2018 bzw der ÖSG VO 2018 idF der ÖSG VO 2019 weiters das Bedenken gehegt, dass es ihnen – im Fall der Aufhebung der §23 Abs4 G‑ZG, §17 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013 und §10 Abs1 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 (teilweise) an der gesetzlichen Grundlage fehlen würde.
Dieses Bedenken trifft zu, soweit diese Verordnungen in §23 Abs4 G‑ZG ihre Grundlage hatten.
2.4.2.1. Gemäß Art139 Abs3 (Z1) B‑VG darf der Verfassungsgerichtshof eine Verordnung nur insoweit als gesetzwidrig aufheben, als ihre Aufhebung ausdrücklich beantragt wurde oder als er sie in der bei ihm anhängigen Rechtssache anzuwenden hätte. Gelangt der Verfassungsgerichtshof jedoch zur Auffassung, dass die ganze Verordnung der gesetzlichen Grundlage entbehrt, so hat er die gesamte Verordnung als gesetzwidrig aufzuheben oder, wenn die Verordnung bereits außer Kraft getreten ist, auszusprechen, dass die gesamte Verordnung gesetzwidrig war (Art139 Abs4 letzter Satz B‑VG). Der Fall des Art139 Abs3 Z1 iVm Abs4 letzter Satz B‑VG liegt hier vor.
2.4.2.2. Die ÖSG VO 2018 idF der ÖSG VO 2019 wurde durch §6 Abs2 der ÖSG VO 2020 (RIS‑Kundmachungen [Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit], Nr 2/2021) mit Ablauf des 18. Februar 2021 aufgehoben. Es ist daher auszusprechen, dass die ÖSG VO 2018 und die ÖSG VO 2018 idF der ÖSG VO 2019 – soweit sie als Bundesverordnungen in Geltung standen – zur Gänze gesetzwidrig waren.
2.4.3. Der Verfassungsgerichtshof hat gegen die in Prüfung gezogenen Bestimmungen der ÖSG VO 2018 bzw der ÖSG VO 2018 idF der ÖSG VO 2019 ferner das Bedenken gehegt, dass sie insofern in Widerspruch zu ihren gesetzlichen Grundlagen stünden, als §23 Abs4 und Abs5 G‑ZG (und entsprechend die landesgesetzlichen Ausführungsbestimmungen zu §23 Abs5 G‑ZG) vor dem Hintergrund der Trennung der Vollzugsbereiche des Bundes und der Länder die gesonderte Erlassung von Verordnungen einerseits für Angelegenheiten iSd Art10 B‑VG und anderseits für Angelegenheiten iSd Art12 Abs1 Z1 B‑VG vorsehe. Demgegenüber würden sich die angefochtenen Verordnungsbestimmungen als "gemischte Verordnungen" sowohl auf Angelegenheiten iSd Art10 B‑VG als auch auf Angelegenheiten iSd Art12 Abs1 Z1 B‑VG beziehen.
2.4.3.1. Die Niederösterreichische Landesregierung geht in ihrer Stellungnahme davon aus, dass §23 Abs4 und 5 G‑ZG die Erlassung einer kompetenzübergreifenden Verordnung vorsehe. Die ÖSG‑Verordnung lasse erkennen, welche Teile dem Gesundheitswesen und welche Teile dem Krankenanstaltenrecht zuzurechnen seien. Die Erlassung kompetenzbereichsübergreifender hoheitlicher Rechtsakte sei zulässig, etwa die Zusammenfassung von Bescheiden mehrerer Behörden in einer Ausfertigung (Hinweis auf VfSlg 8304/1978 und 9380/1982). Dies gelte umso mehr für Verordnungen, die sich an einen unbestimmten Adressatenkreis richten. Selbst wenn einzelne Bestimmungen der in Prüfung gezogenen Verordnung nicht eindeutig einem Vollzugsbereich zugeordnet werden könnten und somit "janusköpfigen Charakter" aufweisen sollten, würde dies Jabloner (Gliedstaatsverträge in der österreichischen Rechtsordnung, ZÖR 1989, 225 [242 f.]) auf "untergesetzlicher Ebene" als zulässig erachten.
2.4.3.2. Die Wiener Landesregierung hält eine gesonderte Erlassung von Verordnungen für Angelegenheiten des Gesundheitswesens einerseits, des Krankenanstaltenrechtes anderseits nicht für geboten, weil "eine eindeutige Zuordnung des Inhaltes der Verordnung zu den jeweiligen Kompetenztatbeständen möglich ist".
2.4.3.3. Die Bedenken des Verfassungsgerichtshofes erweisen sich als nicht zutreffend:
Zunächst ist festzuhalten, dass im Prüfungsverfahren nicht bestritten worden ist, dass die in Prüfung gezogenen Verordnungsbestimmungen Regelungen enthalten, die sowohl dem Gesundheitswesen (Art10 Abs1 Z12 B‑VG) als auch dem Krankenanstaltenrecht (Art12 Abs1 Z1 B‑VG) zuzurechnen sind. Aus §4 Abs2 ÖSG VO 2018 ergibt sich, dass die großgerätebezogenen Festlegungen der Anlage 2 zu dieser Verordnung sowohl auf Krankenanstalten als auch auf den "niedergelassenen Bereich" bezogen sind.
Die Texte der den ÖSG- und RSG‑Verordnungen zugrunde liegenden gesetzlichen Verordnungsermächtigungen des Bundes bzw der Länder schließen es nicht explizit aus, dass auf ihrer Grundlage gemeinsame, verschiedene kompetenzrechtliche Angelegenheiten in einem behandelnde Verordnungen erlassen werden. Weiters sprechen die Gesetzesmaterialien (vgl Erläut zur RV 1333 BlgNR 25. GP , 10) durchaus dafür, dass der Gesetzgeber mit seinem "umfassenden und integrativen" Ansatz die Erlassung kompetenzübergreifender Verordnungen im Sinn hatte.
Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (vgl zB VfSlg 4052/1961, 13.311/1992, 17.353/2004) ist es auch nicht erforderlich, dass eine Verordnung ihre gesetzliche Grundlage (richtig) angibt; auch ist es verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn sich eine Verordnung auf verschiedene gesetzliche Grundlagen stützt; es ist nur erforderlich, dass sich eine Durchführungsverordnung überhaupt auf eine gesetzliche Grundlage zurückführen lässt.
Da mit der Gesundheitsplanungs GmbH dieselbe Behörde ermächtigt ist, Verbindlicherklärungen von Strukturplänen sowohl auf dem Gebiet des Gesundheitswesens (Art10 Abs1 Z10 B‑VG) als auch auf dem Gebiet des Krankenanstaltenrechts (Art12 Abs1 Z1 B‑VG) vorzunehmen, verlangt auch das Erfordernis der klaren Zuordnung von Verordnungsbestimmungen zu ihrem behördlichen Urheber keine inhaltliche Trennung nach der Zugehörigkeit zu Kompetenzangelegenheiten. In diesem Punkt – eine oder mehrere Behörden als Urheber (und wegen der daran geknüpften, nach Umständen unterschiedlichen Rechtsschutzwege gegen Bescheide) – unterscheidet sich die vorliegende Konstellation von jenen Fällen, in denen der Verfassungsgerichtshof bei der Erlassung von Bescheiden "unter einem" eine klare Trennung im Spruch des Bescheides nach vollzogenen Materien verlangt hat (zB VfSlg 2932/1955, 4774/1964, 5546/1967, 7878/1976, 8304/1978, 9380/1982). Infolge einheitlicher Kundmachungsvorschriften (§23 Abs6 G‑ZG, §17 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013) verlangen auch diese nicht, dass inhaltlich nach Kompetenzbereichen getrennte Verordnungen erlassen werden.
Entscheidend ist letztlich, ob ein Verständnis der gesetzlichen Grundlagen der in Prüfung gezogenen Verordnungen als Ermächtigung zur Erlassung von materienübergreifenden Verordnungen mit der Bundesverfassung im Einklang steht. Dies ist der Fall:
Weder steht der Erlassung einer kompetenzübergreifenden Verordnung eine ausdrückliche Verfassungsvorschrift entgegen, noch gebieten sonstige Grundsätze der Bundesverfassung in der vorliegenden Konstellation eine inhaltliche Trennung:
Der Verfassungsgerichtshof vermag nicht zu erkennen, dass die Ermächtigung zur Erlassung kompetenzübergreifender "gemischter" Verordnungen die Weisungsbefugnisse oberster Organe der Vollziehung oder die parlamentarische Verantwortlichkeit dieser Organe beeinträchtigen würde. Im Fall von inhaltlich nicht kompatiblen Weisungen der jeweiligen, für verschiedene Kompetenzangelegenheiten zuständigen obersten Organe der Vollziehung wird die Gesundheitsplanungs GmbH eine nach Inhalten getrennte Verbindlicherklärung vornehmen müssen; das einfache Gesundheits‑Zielsteuerungsrecht steht dem nicht entgegen. Da für den Rechtsschutz gegen Verordnungen unabhängig von ihrer kompetenzrechtlichen Zuordnung allein der Verfassungsgerichtshof zuständig ist, ist eine Trennung der Verordnungsinhalte auch nicht aus Gründen des Rechtsschutzes erforderlich.
§17 Abs1 NÖGUS‑G 2006 und §17a Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013 schließen daher – im Einklang mit der Bundesverfassung – die Erlassung von Verordnungen, die Angelegenheiten des Gesundheitswesens einerseits und Angelegenheiten des Krankenanstaltenrechtes anderseits in inhaltlicher Einheit regeln, nicht aus.
Das Bedenken, die in Prüfung gezogenen Verordnungen stünden in Widerspruch zu ihren gesetzlichen Grundlagen, weil diese die Erlassung "gemischter" Verordnungen ausschließen würden, erweist sich damit als unzutreffend.
Die in Prüfung gezogenen Bestimmungen der ÖSG VO 2018 bzw der ÖSG VO 2018 idF der ÖSG VO 2019 waren daher, soweit sie als Verordnungen der Länder Niederösterreich bzw Oberösterreich in Geltung standen, nicht gesetzwidrig.
IV. Ergebnis
1. §23 Abs1 zweiter, dritter und vierter Satz, Abs2 zweiter, dritter, vierter und fünfter Satz und Abs4 bis 8 G‑ZG, BGBl I 26/2017, ist als verfassungswidrig aufzuheben.
1.1. Die Bestimmung einer Frist für das Außerkrafttreten der aufgehobenen Gesetzesstellen gründet sich auf Art140 Abs5 dritter und vierter Satz B‑VG.
1.2. Der Ausspruch, dass frühere gesetzliche Bestimmungen nicht wieder in Kraft treten, beruht auf Art140 Abs6 erster Satz B‑VG.
1.3. Die Verpflichtung des Bundeskanzlers zur unverzüglichen Kundmachung der Aufhebung und der damit im Zusammenhang stehenden sonstigen Aussprüche erfließt aus Art140 Abs5 erster Satz B‑VG und §64 Abs2 VfGG iVm §3 Z3 BGBlG.
2. Die §§18, 19 und 20 Abs1 und 2 G‑ZG, BGBl I 26/2017, §3a Abs3a KAKuG, BGBl 1/1957, idF BGBl I 26/2017, §17 NÖGUS‑G 2006, LGBl 134/2005 (LGSlg 9450), idF LGBl 92/2017, §10c Abs3 NÖ KAG, LGBl 170/1974 (LGSlg 9440), idF LGBl 93/2017, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, LGBl 83/2013, idF LGBl 96/2017, §6a Abs6a Oö. KAG 1997, LGBl 132/1997 (WV), idF LGBl 97/2017 und §10 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017, LGBl 10/2018, werden nicht als verfassungswidrig aufgehoben.
3. Im Übrigen, nämlich hinsichtlich des §4 SKAG, ist das Gesetzesprüfungsverfahren einzustellen.
4. Die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), und die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), in der Fassung der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019), kundgemacht am 5. November 2019 unter Nr 6/2019 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), waren, soweit sie als Verordnungen des Bundes in Geltung standen, gesetzwidrig.
Die Verpflichtung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zur unverzüglichen Kundmachung der Feststellung der Gesetzwidrigkeit erfließt aus Art139 Abs5 erster Satz B‑VG und §59 Abs2 VfGG iVm §4 Abs1 Z4 BGBlG. Diese Feststellung bezieht sich nicht auf diese Verordnungen, soweit sie als Landesverordnungen in Geltung standen (siehe oben III.2.4.3.3 und unten IV.5. und IV.6.).
5. §4 und Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), waren, soweit sie als Verordnung des Landes Oberösterreich in Geltung standen, nicht gesetzwidrig.
6. §4 und Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), in der Fassung der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019), kundgemacht am 5. November 2019 unter Nr 6/2019 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), waren, soweit sie als Verordnung des Landes Niederösterreich in Geltung standen, nicht gesetzwidrig.
7. Diese Entscheidung konnte gemäß §19 Abs4 VfGG ohne mündliche Verhandlung in nichtöffentlicher Sitzung getroffen werden.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)