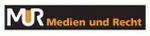I. Einführung: Die adäquate Erfassung der Verwertung durch KI
Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt – in vielen Bereichen so, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Das betrifft auch das Urheberrecht. Hier wirft vor allem die generative KI vielfältige Fragen auf. Das betrifft einerseits den sogenannten Input: Ohne die Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke und Leistungen gibt es keine Künstliche Intelligenz, jedenfalls keine, die den jeweiligen aktuellen intellektuellen, gesellschaftlichen und kulturellen Anforderungen genügen könnte. Die Werke und Leistungen werden für das Training benötigt.1) Dabei ist im Grundsatz geklärt, dass das Trai ning (nach dem gegenwärtigen Stand der Technik) Vervielfältigungen (§ 16 UrhG; § 15 öUrhG) erfordert.2) Diese können – nach wohl herrschender, aber aus guten Gründen umstrittener Meinung – im Grundsatz von § 44b UrhG, § 42h Abs 6 öUrhG gedeckt sein. Doch trägt die Schranke nicht, soweit die Rechteinhaber von dem Rechtevorbehalt Gebrauch gemacht haben. Zum ande ren betrifft das den sogenannten Output: Die werkähnlichen KI-Produkte sind zwar selbst nicht urheberrechtlich schutzfähig, da es sich nicht um persönliche geistige Schöpfungen handelt. Da sie aber auf der Ausnutzung urheberrechtlich geschützter Werke beruhen und zu solchen in Konkurrenz treten, begehren Urheber eine Beteiligung an ihrer wirtschaftlichen Verwertung. So weit KI-Modelle geschützte Werke ausgeben, kann ihr Angebot als öffentliche Zugänglichmachung/Zurverfügungstellung iSv § 19a UrhG, § 18b öUrhG anzusehen sein.