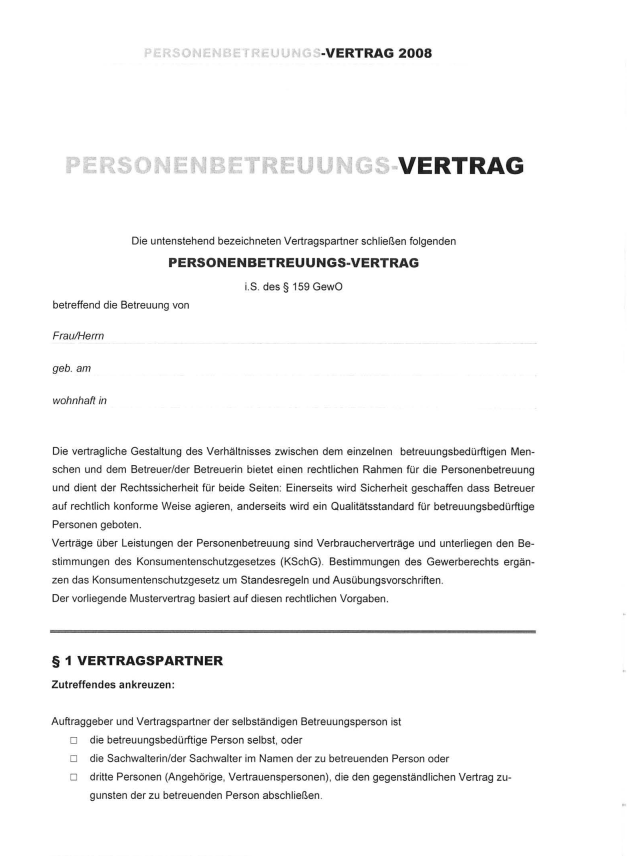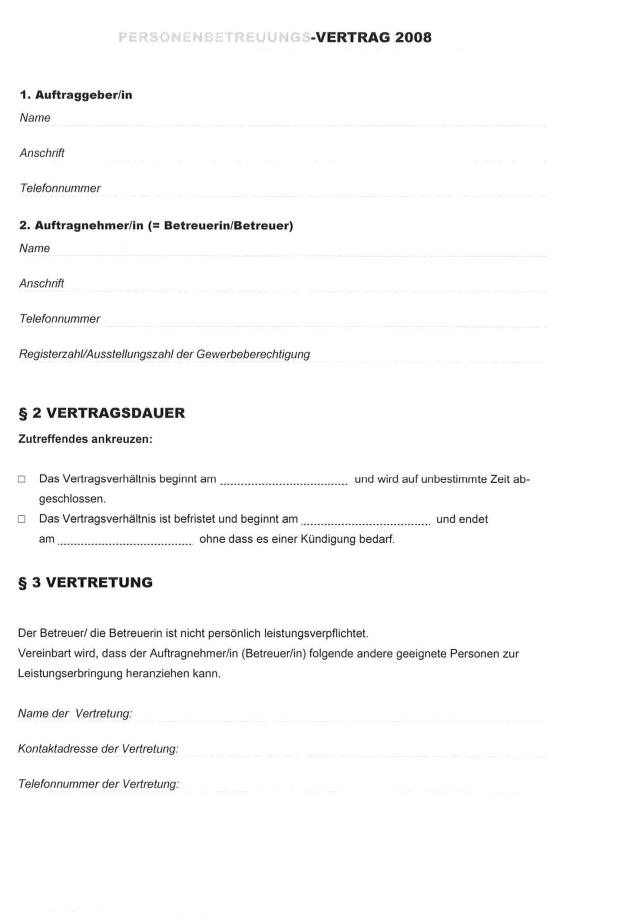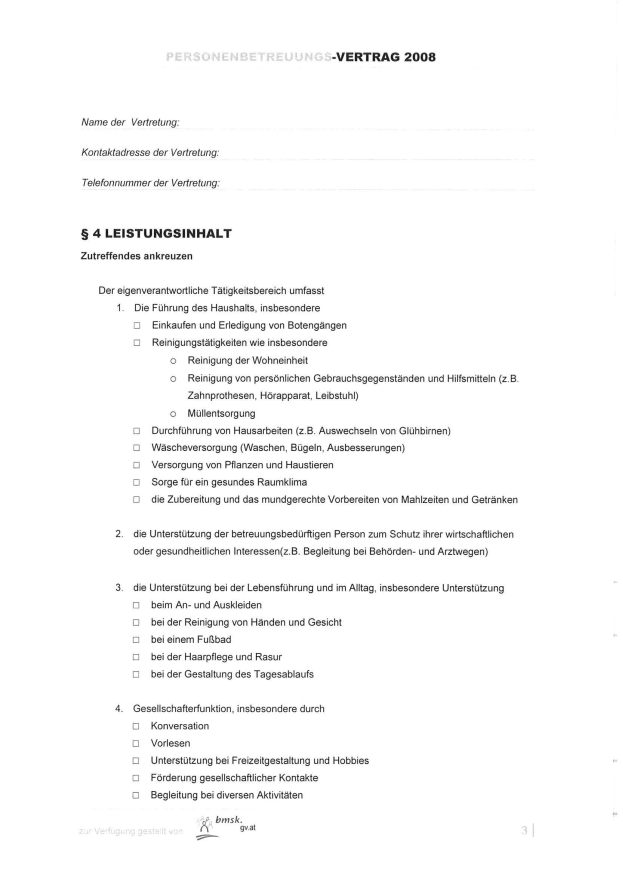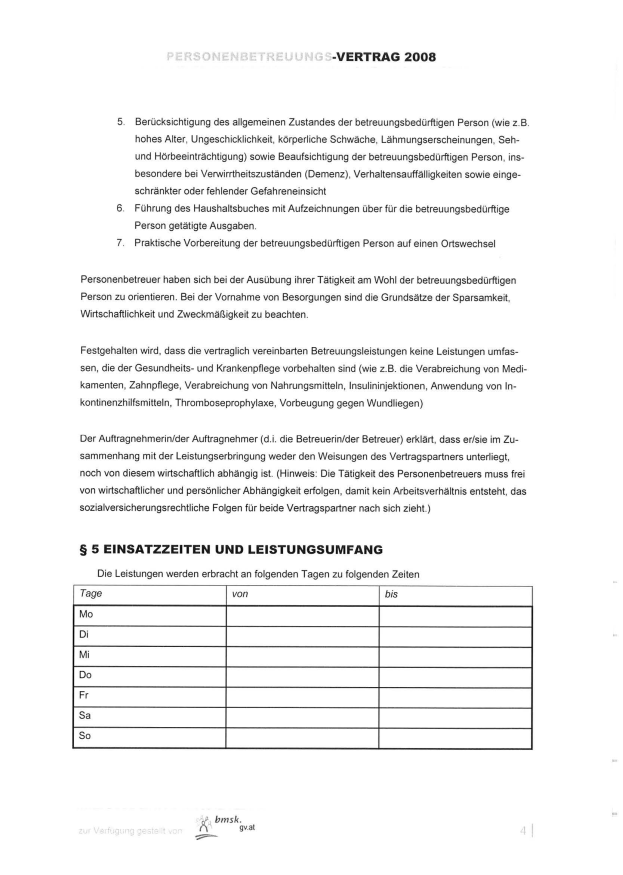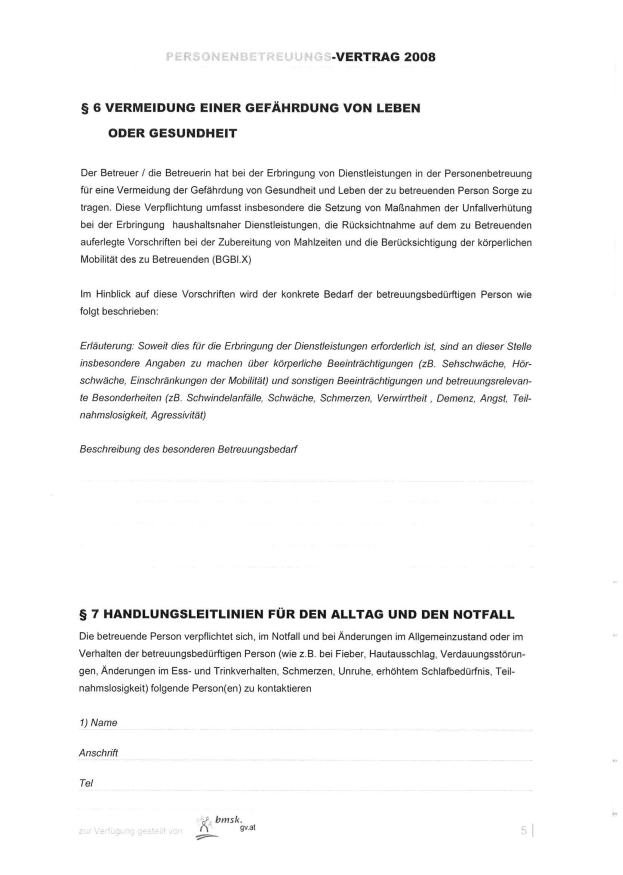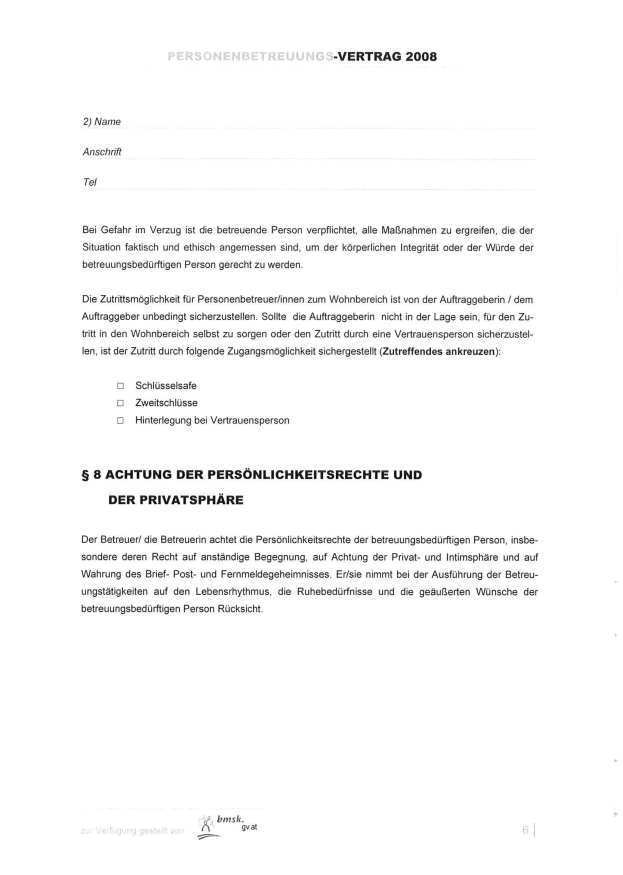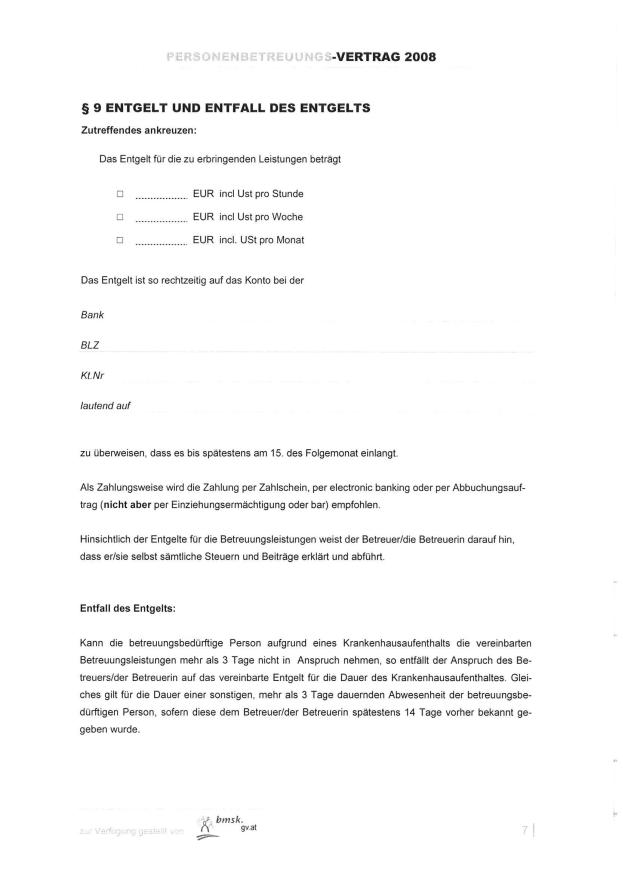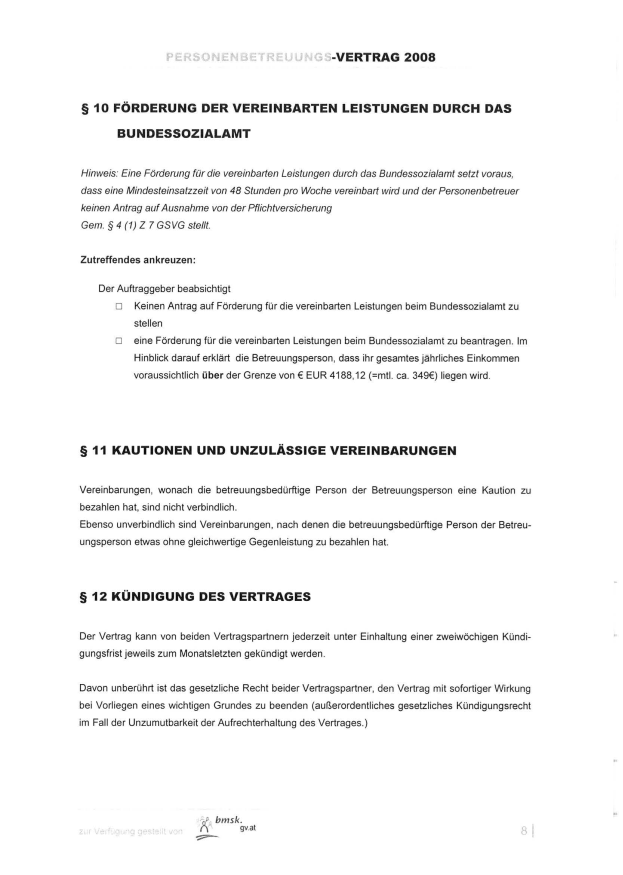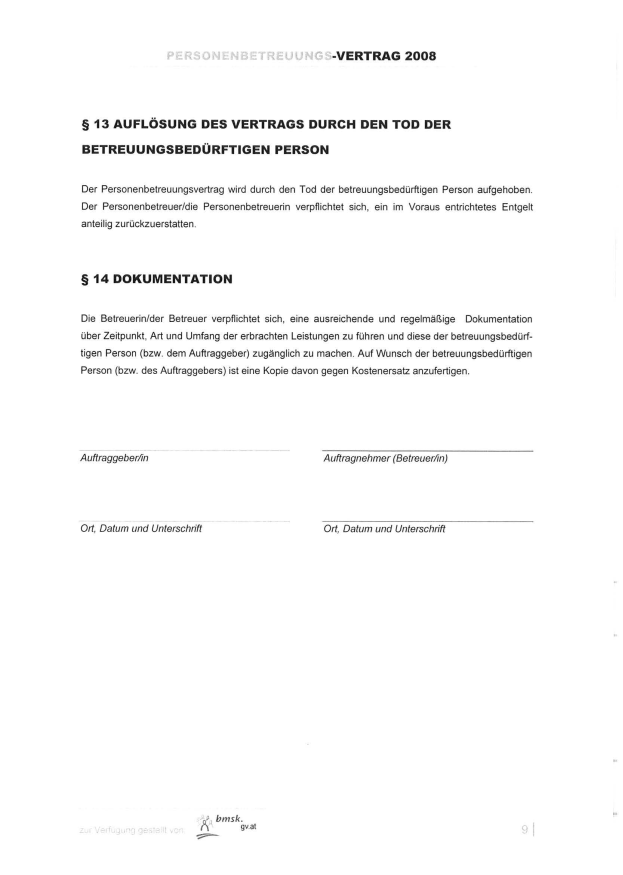European Case Law Identifier: ECLI:AT:LVWGVO:2018:LVwG.455.1.2017.R10
ImNamenderRepublik!
Erkenntnis
Das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg hat durch sein Mitglied Dr. Wischenbart über die Beschwerde der B GmbH, D, vertreten durch dieKleinbrod Steuerberatungs GmbH, Dornbirn, gegen den Beschlussder Abgabenkommission der Stadt Fvom 05.07.2017, ausgefertigt mit Bescheid vom 06.07.2017, mit welchem die Kommunalsteuer für die Jahre 2007 bis 2012 in Höhe von 10.905,74 Euro festgesetzt worden ist, zu Recht erkannt:
Gemäß § 279 Abs 1 Bundesabgabenordnung (BAO) wird der BeschwerdeFolge gegeben und der angefochtene Bescheid behoben.
Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG) eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof unzulässig.
Begründung
1. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde die Berufung gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Stadt F vom 02.08.2013 als unbegründet abgewiesen. In diesem Bescheid vom 02.08.2013 wurde die Kommunalsteuer für die Jahre 2007 bis 2012 in Höhe von 10.905,74 Euro festgesetzt.
2. Gegen den Bescheid der Abgabenkommission vom 06.07.2017 hat die Beschwerdeführerin rechtzeitig, Beschwerde eingebracht. In dieser bringt sie im Wesentlichen vor, der Bescheid der Abgabenkommission der Stadt F werde angefochten hinsichtlich der Nichtanerkennung der Tätigkeit der B GmbH im Bereich der Kranken-, Alten- und Behindertenfürsorge als unmittelbare Tätigkeit. Sie würden die Anerkennung der Tätigkeit des B als unmittelbare Tätigkeit im Rahmen der Kranken-, Alten- und Behindertenfürsorge und die Befreiung von der Kommunalabgabe gemäß § 8 Z 2 Kommunalsteuergesetz beantragen. Der Bescheid sei des Weiteren aus dem Grunde rechtswidrig und werde daher zusätzlich angefochten, weil für das Jahr 2007 der Tatbestand der Verjährung gegeben sei. Es werde somit beantragt das Jahr 2007 aus diesem Verfahren auszuschalten. In der Berufung vom 04.09.2013 gegen den Kommunalsteuerbescheid des Bürgermeisters der Stadt F vom 02.08.2013 sei folgende Begründung angeführt worden die auch für diese Beschwerde gelte:
Der B sei eine gemeinnützige Körperschaft, eingetragen beim Landesgericht F unter der Firmenbuchnummer XXX. Die Gesellschaft sei der Verein A MVorarlberg mit 51 % und der Verein L H Vorarlberg mit 49 %. Die beiden Träger seien jeweils für sich gemeinnützige juristische Personen. Die Gemeinnützigkeitdes B sei vom Finanzamt F überprüft und anerkannt worden. Laut § 2 des Gesellschaftsvertrages sei Gegenstand des Unternehmens die Vermittlung und Erbringung von Dienstleistungen im Betreuungsbereich im Land Vorarlberg, insbesondere in Zusammenarbeit mit den bestehenden Betreuungseinrichtungen der Krankenpflegevereine und des mobilen Hilfsdienstes. Der Begründung der Behörde, dass die unmittelbare Förderung der vom Gesetzgeber genannten Zwecke nicht mehr gegeben sei, könne von ihrer Seite nicht gefolgt werden.
Die V B GmbH sei im Vorarlberger Betreuungs- und Pflegenetz im Rahmen der ambulanten Dienstleister neben der Hauskrankenpflege und dem mobilen Hilfsdienst ein eigenständiger zentraler Dienstleister. Die Hauskrankenpflege versorge durch diplomierte Kräfte Patienten punktuell. Der mobile Hilfsdienst unterstütze stundenweise im Haushaltsbereich. Der B komme ausschließlich bei umfangreichen Betreuungen ab 20 Wochenstunden bis hin zur 24h Betreuung zum Einsatz. Die Klienten hätten vorwiegend einen Betreuungsbedarf von Pflegestufe 3 bis 7. Der B ermögliche in vielen Fällen, dass es nicht zu einem Heimaufenthalt komme, sondern die Betreuung ambulant möglich sei und somit der eigene Haushalt nicht aufgegeben werden müsse. Dadurch sei eine angemessene Betreuung bis hin zum Tode zu Hause möglich, auch wenn keine Angehörigen vor Ort seien bzw diese beruflich gebunden seien. Aufgrund des gehobenen Betreuungsbedarfes in einer ambulanten Situation komme dem B hinsichtlich Gewährleistung einer angemessenen und kontinuierlichen Betreuung besondere Herausforderung zu. Die Tätigkeit des B auf die Vermittlung von Personenbetreuerrinnen zu reduzieren entspreche nicht den gegebenen Tatsachen. Seitens des B bei umfangreichen ambulanten Betreuungen sich nur auf mittelbare Tätigkeiten einzuschränken wäre in der Praxis grob fahrlässig. Das Gelingen von umfangreicher Betreuung hänge von vielen Ebenen ab: wie medizinisch, pflegerisch, finanziell und sozial der Betreuungsvorsorge sich vor Ort beim Klienten mit einer präsenten Haltung für alle diese Aspekte um eine qualitätsvolle Betreuung durchgehend zu gewährleisten. Darüber hinaus mache er auch konkrete Interventionen. Dies seien ua diverse allgemeine Einführungen sowohl für Klienten als auch Betreuer, Klärungen für die Delegationen von pflegerischen und ärztlichen Tätigkeiten, Klärungen wie Betreuungsleistungen verrichtet werden könnten, frühzeitiges Intervenieren bei körperlichen und wirtschaftlichen Gefährdungen. Er helfe auch bei der Lösung von Betreuungsproblemen und deshalb komme ihm vor Ort eine maßgebliche fürsorgliche Tätigkeit zu. Oft seien es einfach die Sorgen der Angehörigen, dass ihre Eltern gut betreut seien, ihnen aber das fürsorgliche Kümmern aus verschiedenen Gründen nicht möglich sei. Hier sei der B gefragt, bedarfsorientiert, fürsorglich mit regelmäßigen Hausbesuchen für die Klienten da zu sein.
Der Aufgabenbereich der Mitarbeiter gestalte sich so, dass mindestens die Hälfte der Arbeitszeit vor Ort beim Klienten geschehe. Mittlerweile sei beim B pflegerisch ausgebildetes Personal eingestellt, um die Aufgaben beim Klienten verantwortungsvoll übernehmen zu können. Bedarfsgerechte Qualitätsanforderungen der zu betreuenden Klienten und zunehmend ein Mangel an Angehörigen vor Ort würden den B veranlassen vor Ort tätig zu sein. Die Vermittlungsarbeit im engeren Sinne nehme den kleineren Anteil ein. Der B nehme somit beim Klienten maßgeblich und unmittelbar fürsorgliche Aufgaben wahr. Seine Gemeinnützigkeit sei in den Unternehmensdokumenten verankert und durch das Finanzamt bestätigt.
Der Fürsorgebegriff sei aus ihrer Sicht weiter zu verstehen, als nur die Hilfestellung zur Förderung des körperlichen Wohlbefindens, wie Hilfe bei der Körperreinigung, die Hilfestellung im hauswirtschaftlichen Bereich, wie Unterstützung bei der Zubereitung von Mahlzeiten etc. Die Behörde verkenne, dass auch Fürsorgetätigkeiten in der sozialen Betreuung, der Organisation und Mithilfe, der Aufrechterhaltung der häuslichen Wohngegebenheiten vom B durchgeführt würden und diese Tätigkeiten sehr wohl von den Dienstnehmern des B ausgeführt würden und somit eine unmittelbare Tätigkeit für den betroffenen Personenkreis ausüben würden. Wenn der B diesem Personenkreis behilflich sei in der Suche nach der geeigneten Betreuungsperson und deren Einführung in den Pflegehaushalt, stelle dies ihres Erachtens sehr wohl eine unmittelbare Tätigkeit dar. Der B erkläre die Betreuungssituation, berate, plane, implementiere und koordiniere gemeinsam mit dem betroffenen Personenkreis ein individuelles und bedarfsorientiertes Versorgungspaket. Des Weiteren gehöre der B zum Betreuungs- und Pflegenetz Vorarlberg und sei Anlaufstelle für Aufgaben und Fragen, Beratungen und Hilfestellungen die sich aus einem Betreuungsverhältnis ergeben würden. Das Betreuungs- und Pflegenetz Vorarlberg habe nachfolgende Mitglieder: A H, A M H, B B, C - G f G u P, H V, L H Vorarlberg, L H- u P Vorarlbergs, B Vorarlberg. Die Stadt F verweise in ihrer Bescheidbegründung auf die Homepage des B. Da sich das Aufgabengebiet des B mittlerweile geändert habe, habe die Homepage überarbeitet werden müssen. Die Aufgabe des B ändere sich rasch aufgrund der Erfordernisse. In der Tätigkeitsbeschreibung des Geschäftsführers sei der veränderte Tätigkeitsbereich aufgelistet. Die Finanzierung der Mittel erfolge überwiegend durch Subventionen des Sozialfonds der Vorarlberger Landesregierung. In einem geringen Maß werde seit dem Jahr 2009 eine Aufwandsentschädigung von den Leistungsbeziehern erhoben.
Der Vorarlberger B sei im Jahre 2007 auf Intention der Vorarlberger Landesregierung gegründet worden. Anlass sei die Legalisierung der 24h Betreuung in Österreich gewesen. Man habe schon damals erkannt, dass dieses heute sehr wichtige Standbein der ambulanten Betreuung zu Hause nicht nur den Kräften der freien Marktwirtschaft überlassen werden dürfe. Schon damals sei es den Verantwortlichen ein großes Anliegen gewesen, diese Form der Betreuung möglichst schnell in das bestehende Betreuungs- und Pflegenetz zu integrieren. Man habe darum auch die wohl ambitioniertesten und erfahrensten Partner als Gesellschafter für den Aufbau dieser neuen Institution beauftragt. Der Vorarlberger B sei mit der Aufgabe betraut Menschen/Familien die in einem größeren Umfang zu Hause Betreuung brauchen würden bei der Klärung, Organisation und Begleitung zu unterstützen. Mit der Gemeinnützigkeit sei schon von vornherein klar, dass die Qualität der Betreuung und das Wohl der zu betreuenden Personen im Mittelpunkt stehe und nicht die Gewinnoptimierung. Der B sei vor allem dann als Partner gefragt, wenn es um umfangreiche herausfordernde Betreuungssettings gehe bzw dann, wenn die Angehörigen nicht greifbar oder überhaupt nicht vorhanden seien. Dh, wenn zum Beispiel die Zusammenarbeit verschiedener Netzwerkpartner wie zum Beispiel Case Management, Krankenpflegeverein, geronto-psychiatrischer Dienst, Ärzte, MOHI, IFS… um nur einige zu nennen, notwendig seien, damit die Betreuung überhaupt zu Hause stattfinden könne. Diese Art der Tätigkeit gehe weit über die Vermittlung hinaus und erfordere vor allem fachlich kompetente Mitarbeiter in den Büros. Es komme nicht von ungefähr, dass sie derzeit schon fünf ausgebildete Diplomsozialbetreuer angestellt hätten, die Anstellung eines weiteren Diplomsozialarbeiters im September sei am Laufen.
Faktum sei, dass die Installation einer umfangreichen Betreuung fast in jeder Familie zu einem Ausnahmezustand führe. Die wenigsten Menschen könnten es annehmen, dass sie plötzlich den Alltag nicht mehr alleine bewältigen können. Dies zu akzeptieren sei für die meisten Menschen eine Herausforderung und brauche Zeit. Dies sei ein Prozess der gut begleitet werden müsse. Hier gehe es nicht nur um die zu betreuenden Personen, sondern auch um die Familienmitglieder und in weiterer Folge auch um die Betreuungskraft. Verstärkt werde diese Situation mit der Tatsache, dass es sich bei den 24h Betreuerrinnen ausschließlich um Frauen und Männer aus dem Osten handle. Hier würden unterschiedlichste Kulturen aufeinandertreffen und die Anfangszeit sei oft geprägt von Unsicherheit und Ängsten - es sei nicht einfach die Tür für einen fremden Menschen zu öffnen. In dieser sehr sensiblen Zeit brauche es Menschen mit einem guten Gespür und viel Empathie, die diesen Prozess begleiten könnten. Vor Beginn einer jeden Betreuung werde bei einem Hausbesuch die Betreuungssituation ganzheitlich abgeklärt und offene Fragen geklärt:
- „Welche Form der Betreuung braucht es, wie umfangreich muss die Betreuung sein? Reicht eine stundenweise Betreuung oder braucht es doch schon eine Rundumbetreuung?
- Wie kann die Betreuung finanziert werden?
- Wie groß sind die familiären Ressourcen, gibt es überhaupt Familienangehörige die in der Lage sind die Betreuung zu unterstützen?
- Welche Betreuungskraft passt zur betreuenden Person, welche Ausbildung braucht die Betreuungskraft - reicht eine Art Heimhelferkurs oder sollte die Betreuungskraft doch eine medizinische Ausbildung haben. Wenn ja, ist die Zusammenarbeit mit der Hauskrankenpflege gut abzustimmen. Die Betreuungskraft muss vom Fachpersonal eingeschult werden und Delegationen müssen vorbereitet werden.
- Gute, sinnvolle Dokumentationen müssen mit den Angehörigen und Netzwerkpartnern besprochen werden. Was ist hilfreich für die Betreuungssituation, welche Informationen brauchen die Mitarbeiter der Hauskrankenpflege, welche der Hausarzt, die Angehörigen. In vielen Fällen sind alle 3 bis 6 Wochen Fallbesprechungen mit allen involvierten Netzwerkpartnern notwendig.
- Zu Beginn jeder Betreuung sind verschiedene Formalitäten zu erledigen, wie zB der Werkvertrag, Förderansuchen, Gewerbekontrolle, Kontakt zur Bezirkshauptmannschaft bei Mindestsicherungsanträgen und vieles mehr. Alle diese Formalitäten werden von den Mitarbeitern des B erledigt und nachbearbeitet.
- Die Mitarbeiter des B werden in regelmäßigen Abständen in Kontakt mit den Klientinnen bleiben, machen Hausbesuche und stehen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Der B ist Anlaufpool und Servicestelle für Personenbetreuer/innen und setzt sich für eine wertschätzende Behandlung und Bezahlung der Betreuer/innen ein.“
Wo Menschen zusammen leben würden, könne es auch zu Reibungen kommen, dies sei ganz natürlich. Auch hier seien die Mitarbeiter des B vor Ort und würden versuchen durch klärende Gespräche, das Herausarbeiten von Bedürfnissen, oder durch das Einführen von Strukturen wieder ein gutes Miteinander herbeizuführen. Nur durch eine ständige Präsenz vor Ort, bei den Klientinnen, den Betreuungskräften/Angehörigen und der guten Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern könne ambulante Betreuung auch langfristig gut funktionieren. Der Vorarlberger B sei seit Jahren bemüht die Qualität der 24h Betreuung wegweisend weiterzuentwickeln. Die Wichtigkeit dieses so wichtigen Standbeines der ambulanten Betreuung finde sich auch in der Strategie des Sozialfonds 2020 des Landes Vorarlberg. Die Strategie mit qualifiziertem Fachpersonal beratend und begleitend für die Klientinnen da zu sein habe sich bewährt und ermögliche beste Qualität in der ambulanten Betreuung.
Das Amt der Stadt F, die Abgabenkommission, habe die Berufung vom 02.08.2013 mit Bescheid vom 06.07.2017 als unbegründet abgewiesen. Gegen die Begründung aus diesem Bescheid wird Folgendes eingewendet:
Die Stadt F versuche die Gemeinnützigkeit des B in Abrede zu stellen. Diese sei jedoch einzig und alleine durch das Finanzamt F festzustellen. Das Finanzamt F habe den Gesellschaftsvertrag des B geprüft und die Tätigkeit in abgabenrechtlicher Hinsicht mit Schreiben vom 24.10.2007 als gemeinnützig anerkannt.
Den Argumenten der Abgabenkommission sei entgegenzuhalten, dass sich die beiden Säulen der Alten-, Fürsorge- und Pflege-Betreuung, MOHI und Krankenpflegeverein sich nicht in der Lage gesehen hätten, die dritte erforderliche Säule in „umfangreiche Betreuung zu Hause“ aufzubauen und zwar konkret anhand der 24h Betreuung. Aus diesem Grund sei der B gegründet worden. Wenn man die Anforderungen und die Komplexität dieser dritten Säule kenne, dann sei klar, dass vor, während und nach dem möglichen Einsatz von 24h von den Personenbetreuungskräften umfangreiche Tätigkeiten gemacht werden müssten, sollte es zu einer gelingenden, nachhaltigen und qualitativ guten gesamtheitlichen Alten- und Krankenbetreuung kommen. Diesen Aufgabenbereich decke der B mit seinen Mitarbeitern ab und zwar mit großen jährlichen Zuwachsraten an Fällen und Anforderungen. Dieses Idealziel der qualitativ hochwertigen Personenbetreuung im gewohnten häuslichen Bereich werde einerseits direkt und unmittelbar vom B vorbereitet und begleitet und andererseits seien auch die 24h Personenbetreuerinnen ein wichtiges Glied in dieser Kette. Dieses System könne aber nur über ein starkes Netzwerk funktionieren. Und in diesem Netzwerk würden alle Beteiligten entsprechend ihrer Ausrichtung wichtige und essenzielle Tätigkeiten erbringen, damit das System funktioniere. In der Argumentation der Stadt F, den B im Wesentlichen in die Richtung einer Vermittlungsagentur mit idealen Zielen darzustellen, treffe den tatsächlichen Sachverhalt nicht. Es treffe zu, dass die Ersthomepage und auch die ersten Mitarbeiter sehr bescheidene Anfänge gewesen seien. Die jährliche Dynamik dieser unmittelbar tätigen gemeinnützigen Organisation sei jedoch sehr beachtlich. Dem sei nur hinzuzufügen, dass sich diese Organisation auch aus der Stunde null heraus entwickeln müssen habe. Mit der Legalisation der Pflege durch überwiegend Frauen aus den osteuropäischen Ländern über die politisch vorgegebene und faktisch einzig mögliche Schiene „selbständige Personenbetreuerinnen mit Gewerbeschein“ habe im Jahre 2007 ein Paradigmenwechsel stattgefunden in der Pflege, der mehr bedürfen habe, als nur Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. Für diese Tätigkeit hätte sich die öffentliche Hand, das Land Vorarlberg auch nicht mit solchem Engagement und finanziellem Einsatz engagiert, wäre es nur um die Vermittlung von Personenbetreuerrinnen gegangen.
Der Fürsorgebegriff im Kommunalsteuerrecht sei weiter zu verstehen, wenn auch nicht jede angebotene soziale Leistung als Fürsorge gewertet werden könne. Hinsichtlich der Unmittelbarkeit betreffend § 40 BAO würden sie auf das VwGH-Erkenntnis vom 29.09.2004, Zl 2000/13/0014, verweisen. Dieses Judikat bringe sehr anschaulich zum Ausdruck, was das Höchstgericht unter unmittelbarer Fürsorge verstehe. Dies seien in Summe alle jene Handlungen und Maßnahmen, die direkt der Fürsorge und dem Wohl des betreffenden Personenkreises dienen würden. Die erstmalige Einführung einer 24h Betreuung in einem zu betreuenden Haushalt sei ein entscheidendes und konfliktträchtiges Ereignis, das sowohl die zu betreuende Person als auch deren Angehörige ganz massiv treffe. Da sowohl der Krankenpflegeverein in dieser besonderen Situation als auch der MOHI nicht über jene professionellen Kräfte verfügen würde, sei gemeinsam mit finanzieller Hilfe des Landes Vorarlberg der B gegründet worden. Zusammenfassend dürfe festgestellt werden, dass der B einen unentbehrlichen Hilfsbetrieb im Sinne des § 45 Abs 2 betreibe und die Tätigkeit als steuerbefreite Tätigkeit im Sinne der alten Fürsorge zu werten sei.
3. Folgender Sachverhalt steht fest:
Die B GmbH mit Sitz in D, ist eine Gesellschaft, die gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Vermittlung und Erbringung von Dienstleistungen im Betreuungsbereich im Land Vorarlberg, insbesondere in Zusammenarbeit mit den bestehenden Betreuungseinrichtungen der Krankenpflegevereine und der mobilen Hilfsdienste bezweckt. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist nicht auf Gewinn gerichtet.
Die Gesellschaft wird beim Finanzamt F als gemeinnützige Gesellschaft geführt (Schreiben des Finanzamtes F vom 11.03.2009), und somit entfällt die Steuerpflicht für diese Gesellschaft.
Das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft erstreckt sich darauf, dass die Mitarbeiter des B zu den zu betreuenden Personen persönlich hingehen und mit diesen zusammen ein Betreuungskonzept entwerfen, aus dem hervorgeht, welche Art der Betreuung und in welchem Umfang der jeweils zu Betreuende diese individuell benötigt. Dazu wird zwischen dem B und der zu betreuenden Person ein Vermittlungsauftrag abgeschlossen, in dem festgelegt wird welche Art und welchen Umfang eine Pflege und Betreuung haben soll.
Die finanziellen Mittel wurden in den Jahren 2007 bis 2012, sowie heute noch, fast ausschließlich (zwischen 69,22 % und 96,74 %) aus Landessubventionen durch den Sozialfonds geschöpft. Die überwiegende Tätigkeit der Mitarbeiter des B liegt in der aktiven Begleitung des Pflegepersonals und der Hilfe bei den Abrechnungen der Pflegeleistungen, die von den Pflegerinnen erbracht werden. Auch Interventionen und Mediationen bei Konflikten werden durch den B wahrgenommen, was die überwiegende Arbeitszeit der Mitarbeiter in Anspruch nimmt. Auch ist je ein Mitarbeiter einer Pflegerin während ihrer Tätigkeit bei pflegebedürftigen Menschen als dauernder Ansprechpartner für die Dauer der Pflege zugeteilt.
In den Jahren 2007 bis 2012 wurde der B fast ausschließlich durch Subventionen aus dem Sozialfonds der Vorarlberger Landesregierung finanziert:
Jahr | Budget/ Aufwendungen | Subventionen | Einkünfte aus Vermittlung | Förderung Sozialfond in % | ||
Stammkapital € 35.000 | € 35.000 |
| ||||
2007 € 42.500 | € 36.000 |
| ||||
2008 €107.800 | € 95.800 |
| ||||
2009 | € 149.362 | € 144.500 | € 4.862 | 96,74 % | ||
2010 | € 152.581 | € 147.000 | € 5.581 | 96,34 % | ||
2011 | € 204.587 | € 155.000 | € 49.587 | 75,76 % | ||
2012 | € 242.690 | € 168.000 | € 74.690 | 69,22 % | ||
Für die Anbahnung der Betreuung und der Betreuung selbst sind folgende Verträge anzuschließen:
„Der Vermittlungsauftrag, der zwischen dem B und der zu betreuenden Person abgeschlossen wird, legt fest, in welchem Umfang eine Betreuung oder Pflege stattfinden soll. Auch sind hier die Kosten geregelt, die von den zu Betreuenden an die Betreuer geleistet werden.
V e r m i t t l u n g s a u f t r a g
I. Präambel
Der B V GmbH
- im weiteren kurz als B bezeichnet –
ist eine gemeinnützige Gesellschaft, deren Betriebsgegenstand unter anderem darin besteht, Betreuungsaufträge zwischen hilfsbedürftigen Personen und deren Angehörigen einerseits und solchen Personen zu vermitteln, die derartige Leistungen erbringen.
II. Vertragsparteien
1. Der Auftraggeber:
Name:
Geburtsdatum:
Anschrift:
Telefonnummer/E-Mail:
Der Auftraggeber und Vertragspartner ist (zutreffendes bitte ankreuzen):
○ die betreuungsbedürftige Person selbst
○ der Sachwalter/in im Namen der zu betreuenden Person (Bestellungsbeschluss des Gerichtes beilegen)
○ rechtsgeschäftlicher Vertreter/in im Namen der zu betreuenden Person (Vollmacht beilegen)
○ Angehörige/r
○ Vertrauensperson, die den gegenständlichen Vertrag im Vollmachtsnamen zu
Gunsten der zu betreuenden Person abschließt
2. Auftragnehmer:
B GmbH, Sgasse, F
3. Zu betreuende Person: (nur auszufüllen, falls Auftraggeber/in nicht die zu betreuende Person selbst ist)
Name: Geburtsdatum: Anschrift: Telefonnummer/E-Mail:
III.
Hiermit beauftragt der Auftraggeber/in den B für die Organisation einer kontinuierlichen und angemessen Personenbetreuung der zu betreuenden Person (Leistungsbeschreibung laut aktuellem Folder).
Name der zu betreuenden Person:
Einsatzort:
Alter:
Pflegestufe: 2. Name der zu betreuenden Person:
Alter:
Pflegestufe:und nimmt der B diesen Auftrag ausdrücklich an.
IV.
Die Vermittlungskosten belaufen sich für
○ 24 Stunden unbefristet im ersten Jahr auf € 550,00, in den Folgejahren auf € 275,00
○ 24 Stunden befristet, maximal 4 Wochen einmalig € 150,00
○ stundenweise im ersten Jahr € 290,00, im Folgejahr € 75,00
bei Auftragserteilung, wenn es zu keinem Betreuungseinsatz kommt vermindert € 80,00
(zutreffendes ankreuzen, Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer)
Der/die Auftraggeber/in wählt den Betreuungszeitraum:
o befristest bis
o unbefristet
und bestätigt dies mit seiner Unterschrift.
V. Vertragsdauer
1. Dieser Vertrag tritt mit dem Datum der Unterfertigung in Kraft und wird auf die unter Punkt IV. abgeschlossene Vertragsdauer abgeschlossen. Beide Vertragsteile habe das Recht diesen Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen zum 15. oder zum letzten eines jeden Monats mittels eingeschriebenem Brief zu kündigen. Für die Fristwahrung ist das Datum des Poststempels maßgeblich.
2. Der Auftrag endet automatisch bei nachhaltiger Veränderung des Betreuungsbedarfes, wenn selbständige Personenbetreuung nicht mehr erforderlich ist, wenn selbständige Personenbetreuung nicht mehr möglich ist und durch Tod des Klienten.
Eine einvernehmliche Beendigung des Vertrages ist jederzeit möglich, wobei das Einvernehmen zwischen Auftraggeber und/oder zu betreuender Person und Auftragsnehmer und betreuender Person gegeben sein muss.
3. Der Vertrag kann vom B mit sofortiger Wirkung bei Vorliegen auch von nur einem der nachstehenden Gründe schriftlich mittels eingeschriebenen Brief aufgelöst werden:
a. bei tätlichen Angriffen der zu betreuenden Person oder deren nahen Angehörigen/Bezugspersonen oder sonstiger mit ihr in einem Naheverhältnis stehenden Personen gegen die Betreuungsperson;
b bei Verletzung der Privat- und/oder Intimsphäre der Betreuungsperson durch die zu betreuende Person oder deren nahen Angehörigen/Bezugspersonen oder sonstiger mit ihr in einem Naheverhältnis stehenden Personen;
c. wenn Umstände eintreten, durch die die Betreuungsperson im Zuge ihrer Leistungserbringung sich gesundheitlich oder in sonstiger Weise gefährden würde;
d. wenn der/die Auftraggeber/in oder die zu betreuende Person von der Betreuungsperson Leistungen verlangt, zu deren Erbringung die Betreuungsperson nicht berechtigt ist;
e. wenn die zu betreuende Person bei gegebenem Bedarf medizinischer oder pflegerischer Leistungen, diese Leistungen trotz Hinweis auf die schädlichen Folgen in Anspruch zu nehmen verweigert.
VI. Qualitätssicherung
Der B stellt fest, ob der Personenbetreuer die notwendigen Voraussetzungen und Qualifikationen für die vermittelte Tätigkeit besitzt. Dem Personenbetreuer sind die Vorgaben des B bekannt. Sie entsprechen dem Gewerbeumfang der selbständigen Personenbetreuung laut Anhang. Der B verpflichtet sich regelmäßige Qualitätskontrollen durchzuführen, wobei er sich ein Bild von der Pflege und Betreuungssituation zu verschaffen hat und falls notwendig geeignete verkehrsverbessernde Maßnahmen einzuleiten.
Zum Zwecke des Qualitätsmanagement ist es dem B erlaubt Klientendaten zu speichern und mit anderen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen darüber zu kommunizieren.
Auftraggeber und oder zu betreuender Klient: Datum und Unterschrift
Der Auftragnehmer: Datum und Unterschrift
…“
Die zu Betreuenden werden vom Personal des B insofern begleitet, als das es ihnen durch persönliche Gespräche ermöglicht wird einen Betreuer oder eine Betreuerin kennenzulernen und zu akzeptieren und die Leistungen der Betreuer anzunehmen. Es werden auch die Betreuer von den Mitarbeitern des B begleitet. Die Pflegepersonen werden nicht über Agenturen an den B vermittelt, sondern treten mit diesem selbständig und direkt in Kontakt und schließen mit dem B einen Vermittlungsvertrag ab.
Der Vermittlungsvertrag, der zwischen dem B und den Betreuungspersonen abgeschlossen wird, besitzt folgenden Inhalt:
„…
1. Allgemeine Bestimmungen
1.1. Der B ist eine gemeinnützige Gesellschaft, deren Betriebsgegenstand unter anderem darin besteht, Betreuungsaufträge zwischen hilfsbedürftigen Personen und deren Angehörigen - im Folgenden kurz als Klienten bezeichnet - einerseits und solchen Personen zu vermitteln, die derartige Leistungen erbringen. Vermittelt werden in diesem Zusammenhang ausschließlich nicht pflegerisch/medizinische Dienstleistungen.
1.2. Die Vermittlungstätigkeit beschränkt sich auf die Herstellung des notwendigen Kontaktes zwischen dem Klienten und dem Betreuer.
1.3. Der Betreuer hat keinen Rechtsanspruch auf Vermittlung. Der Betreuer nimmt ausdrücklich zur Kenntnis dass der B keine Beschäftigungsgarantie übernimmt.
1.4. Der B stellt fest, ob der Betreuer die notwendigen Voraussetzungen und Qualifikationen für die vermittelte Tätigkeit besitzt. Dem Betreuer sind die Vorgaben des B bekannt. Im Wesentlichen entsprechen sie dem Gewerbeumfang der Selbständigen Personenbetreuer/-in (siehe Anhang) und der ergänzenden Punkte in diesem Vermittlungsvertrag. Er nimmt zur Kenntnis, dass die dort genannten Kriterien Voraussetzung für die Vermittlung sind. Der B ist berechtigt, eine Vermittlung ohne Angabenvon Gründen abzulehnen.
2. Pflichten des Betreuers
2.1. Der Betreuer verpflichtet sich, dem B Informationen über schulische Ausbildungen, berufliche Tätigkeiten und Erfahrungen nachzuweisen.
2.2. Der B bietet seinem Betreuer den Abschluss eine auf seine Tätigkeit abgestimmte Haftpflichtversicherung an. Der Abschluss dieser Versicherung ist für den Betreuer verpflichtend. Die Kosten übernimmt der B.
3. Pflichten im Falle der Vermittlung
3.1. Der B leitet Anfragen von Klienten betreffend nicht pflegerisch/medizinische Dienstleistungen an den Betreuer weiter, sofern auf Einschätzung des B eine Eignung des Betreuers für die betreffende Aufgabe gegeben ist.
3.2. Der Betreuer teilt dem B umgehend mit, ob er bereit ist, die vermittelte Aufgabe zu übernehmen und diesbezüglich in Kontakt mit dem Klientin zu treten.
3.3. Der Betreuer wird verpflichtet sich den B unverzüglich zu informieren, falls das Auftragsverhältnis zwischen dem Betreuer und dem Klienten zustande kommt oder - aus welchen Gründen immer - endet. Der Betreuer erklärt sich damit einverstanden dass über den Einsatzort die jeweilige örtliche Einsatzleitung der Mobilen Hilfsdienst oder der Hauskrankenpflege informiert wird.
4. Vergütung
4.1. Für die Aufwendungen des B verpflichtet sich der Betreuer halb-jährlich einen Unkostenbeitrag zu bezahlen, welcher nur dann fällig wird, wenn der Betreuer im entsprechenden Halbjahr auch einen, vom B vermittelten Auftrag hat. Dieser ist jeweils am Halbjahresbeginn einzuzahlen und beträgt halbjährlich 50.- Euro.
5. Datenschutzbestimmungen
5.1. Der Betreuer erklärt sich damit einverstanden, dass der B die personenbezogenen Daten des Betreuers speichert, verarbeitet und zum Zweck seiner Vermittlungstätigkeit nutzt und verwendet.
5.2. Der B verpflichtet sich zur Wahrung der Vertraulichkeit hinsichtlich aller personenbezogenen Daten des Betreuers.
5.3. Der Betreuer erteilt ihre Zustimmung, dass der B die personenbezogenen Daten des Betreuers im Rahmen der Vermittlungstätigkeit an interessierte Klienten weitergibt. Darüber hinaus erteilt er die Zustimmung seine Daten (Name, Anschrift, fachliche Qualifikation, Geburtsdatum, Einsatzmöglichkeiten) an die örtlichen Einsatzleitungen der Mobilen Hilfsdienste und der Krankenpflegevereine weiterzugeben.Er ermächtigt auch die genannten Einrichtungen die personenbezogenen Daten an einem Betreuungsauftrag interessierten Klienten weiterzugeben.
6. Vertragsdauer / Kündigung
6.1. Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Vertragsteile in Kraft. Er gilt auf unbestimmte Zeit.
6.2. Der Vertrag kann von jedem der beiden Vertragsteile schriftlich ohne Angabe von Gründen jederzeit durch einseitige Erklärung beendet werden.
7. Schlussbestimmungen
7.1. Der B nimmt keinen Einfluss darauf, in welcher Rechtsform das Auftragsverhältnis zwischen dem Klienten und dem Betreuer zustande kommt. Über die Bestimmungen des ASVG und des GSVG über die Versicherungspflicht, insbesondere über die Bedingungen für die Tätigkeit als „selbstständiger Personenbetreuer" im Auftrag des Klienten, ist der Betreuer informiert. Der B erklärt seine Bereitschaft, dem Betreuer in Bezug auf die vorgenannten Bestimmungen zu beraten und ihm ergänzende Informationen zu erteilen.…“
Dazu wirdparallel zu den vorigen Verträgen noch zwischen dem B und den zu betreuenden Personen ein Personenbetreuungsvertragmit folgendem Inhalt abgeschlossen:
Daneben wird von Seiten des B darauf geachtet, dass die Betreuungsleistung ausreichend ist, und ob von Seiten des Mobilen Hilfsdienstes oder der Hauskrankenpflege, die Teilbereiche des B Vorarlberg darstellen, Unterstützung benötigt wird.
Sämtliche Abrechnungen, welche Betreuungsleistungen betreffen, die zwischen den Betreuern und den zu Bereuenden stattfinden, und von den zu Betreuenden an die Betreuer bezahlt werden müssen, werden vom B im Namen der zu Betreuenden vorgenommen, um den zu betreuenden Personen, die oft nicht in der Lage sind, die Betreuungsleistung selbst abzurechnen, das Prozedere der Abrechnung zu erleichtern. Dazu gehen die Mitarbeiter oft zu den zu Betreuenden Personen nach Hause und rechnen vor Ort ab.
Der B hält auch während der Betreuungsleistung oder Pflegeleistung Kontakt zu den Betreuern und den zu Betreuenden, um die Qualität der Betreuung zu sichern.
4.1. Dieser Sachverhalt wird auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens, insbesondere auf Grund der Ergebnisse der mündlichen Verhandlung und der vorgelegten Unterlagen als erwiesen angenommen.
Als Beweise wurden die Aussagen der Geschäftsführerin des B sowie eines Mitarbeiters gewertet sowie die Aussage des informierten Vertreters des Amtes der Vorarlberger Landesregierung. Weiters wurden dem Landesverwaltungsgericht der Gesellschaftsvertrag vorgelegt, dessen § 2 den Gegenstand des Unternehmens festlegt. Demnach ist die Tätigkeit der Gesellschaft nicht auf Gewinn gerichtet und bezweckt die Vermittlung und Erbringung von Dienstleistungen im Betreuungsbereich im Land Vorarlberg, insbesondere in Zusammenarbeit mit den bestehenden Betreuungseinrichtungen der Krankenpflegevereine und der mobilen Hilfsdienste.Die Gesellschaft ist zur Durchführung von allen Geschäften und Maßnahmen, die zur Erreichung des genannten gemeinnützigen Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, berechtigt. In § 4 des Gesellschaftsvertrages wird der Tätigkeitsbereich unter Punkt 4.1. nocheinmal mit der ausschließlichen Vermittlung und Organisation von Betreuungsleistungen umschrieben. Weiters wurden am 02.11.2018 Fragen des Landesverwaltungsgerichtes im Rahmen einer schriftlichen Stellungnahme durch die Beschwerdeführerin beantwortet.
4.2. In der mündlichen Verhandlung wurden dazu folgende Aussagen getätigt:
Der Vertreter der Beschwerdeführerin gibt an:
„Es ist definitiv so, dass uns das Finanzamt auf eine Anfrage von Oktober 2007 die Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit unserer GmbH erläutert hat. Wir sind umsatzsteuerrechtlich in die Umsatzsteuer optiert und bekommen jährlich einen Umsatzsteuerbescheid vom Finanzamt mit zehn Prozent, da wir aus der Liebhabereivermutung herauswollten.“
Es wird ein Schriftstück vom Finanzamt F vom 11.03.2009 vorgelegt, aus dem zu entnehmen ist, dass der B Vorarlberg als gemeinnützige GmbH die steuerlichen Begünstigungen für gemeinnützige Rechtsträger in Anspruch nehmen kann. Weiteres ist diesem Schreiben zu entnehmen, dass die Steuerpflicht hinsichtlich dieses Betriebes entfällt und die Liebhabereivermutung widerlegt wird. Die Umsätze dieses wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes werden gemäß § 10 Abs 2 Z 7 UStG mit dem begünstigten Steuersatz von zehn Prozent versteuert. (Dieses Schriftstück wird als Anlage A zum Protokoll genommen).
Der Vertreter der Abgabenkommission der Stadt F gibt an:
„Die Dienstleistung der Pflege wird von diesen selbstständigen Pflegerinnen erbracht. Die Beschwerdeführerin hat de facto keinen Einfluss auf das Wirken dieser vermeintlichen Gehilfen. Es ist für Dritte auch nicht erkennbar, dass sie der Beschwerdeführerin zugeordnet wären.
Ich kann nicht sagen, ob wir die Lohnunterlagen, aus denen hervorgeht, dass die Mitarbeiter der B GmbH angestellt sind und einen normalen Lohn mitsamt Abzug der Lohnnebenkosten enthalten, dass wir dies in Kenntnis gehabt hätten. Die Zahlen waren an und für sich aber nicht strittig.“
Der Vertreter der Beschwerdeführerin gibt dazu an:
„Es hat eine GPLA Prüfung durch die Sozialversicherung stattgefunden und dies war damals im Auftrag der Stadt F. Daraus entnehmen wir, dass auch die Zahlen der Stadt F bekannt gewesen sind.“
Die Geschäftsführerin des B Frau Mag. J gibt an:
„Ich denke, dass man einmal genau hinschauen muss, wie und in welcher Form Betreuung stattfinden kann. Betreuung ist ein vielschichtiges Thema, zum einen, weil es hier verschiedene Aspekte gibt, wie den körperlichen Kontakt, die körperliche Betreuung, die soziale Betreuung, die medizinische Betreuung und Betreuung muss auch immer ganzheitlich gesehen werden. Es braucht zunächst mit dem Betreuungsbedürftigen Gespräche. Hier wird dann abgeklärt, in welcher Form diese Person die Unterstützung braucht. Es muss in die Menschen sich hineinversetzt werden, was zugelassen werden kann und in welcher Form diese Betreuung stattfinden kann. Es braucht dann auch von unserer Seite eine Unterstützung. Unsere Leute machen dann eine Einführung. Unsere Leute sind die Begleiter von Hilfsbedürftigen.“
Die informierte Auskunftsperson der Vorarlberger Landesregierung gibt dazu an:
„Wir müssen nun aufpassen, dass die Begriffe richtig verstanden werden. Einmal gibt es hier die Betreuungsperson, welche vor Ort bei den Klienten ist. Und dann gibt es die Mitarbeiter des B, welche die Betreuungspersonen begleitet. Eine Betreuungsperson braucht nämlich mehr Unterstützung vom B, als eine Pflegeperson, welche selbstständig arbeitet.“
Dazu gibt Frau Mag. J an:
„die Betreuungspersonen arbeiten zwar selbstständig und haben mit uns einen Vermittlungsvertrag. In diesem sind Rahmenbedingungen von unserer Seite festgelegt worden.“
Die informierte Auskunftsperson Herr H gibt dazu ergänzend an:
„--- Und dabei der B im Auftrag der zu betreuenden Klienten.“
Frau Mag. J sagt dazu:
„Und hier gibt es noch einen dritten Vertrag, wo die KlientInnen, die zu betreuen sind, mit uns einen Vertrag haben, wo sie den Auftrag geben, dass sie betreut werden können.“
Herr H gibt dazu an:
„Daraus ist zu entnehmen, dass der betreuende Mitarbeiter des B ganz nah bei den zu betreuenden Personen ist.“
Der Vertreter der Beschwerdeführerin gibt dazu an auf Frage des Landesverwaltungsgerichtes:
„Die fünf Mitarbeiter des B in den Jahren 2007 bis 2012 waren alle Angestellte.“
Die Geschäftsführerin Frau Mag. J gibt an:
„2007 ist der B ins Leben gerufen worden und hat sich dann erst entwickeln müssen.“
Der informierte Vertreter M H gibt an:
„Von Anfang an war es beim B so, dass die Mitarbeiter des B eine Abklärung bei Klienten gemacht haben, was benötigt wird an Betreuungsleistung und wie Betreuerinnen und Betreuer richtig eingesetzt werden, sprich, auch welche Personen für die zu betreuenden Menschen richtig qualifiziert sind, und es war auch Aufgabe, darauf zu achten, dass es für die Patienten keine Über- oder Unterversorgung gibt. Dies war so, dass zB jemand im häuslichen Bereich mehr Unterstützung gebraucht hat, ein anderer hat vielleicht mehr psychosoziale Betreuung gebraucht oder auch eine medizinische Betreuung.“
Frau Mag. J gibt dazu an:
„Das Ganze ist über die Jahre gewachsen und man hat dazu auch Erfahrungen sammeln müssen.“
Herr H gibt dazu an:
„Es wurde von der öffentlichen Hand auch so gesehen, dass Pflege von allen geleistet werden kann und erst mit der Zeit kam die Erkenntnis, dass diese sozialbetreuerischen Aspekte im Vordergrund stehen. Zunächst waren es nicht direkt Sozialarbeiter, die dort tätig waren, aber das hat sich jetzt mit der Zeit verstärkt. Nunmehr sind ausschließlich Sozialarbeiter tätig. Auch in den Jahren 2007 bis 2012 haben die Angestellten vom B diese sozialarbeiterische Leistung vollbracht. Mit der Zeit mit zunehmender Erfahrung ist man dann draufgekommen, dass mehr und mehr sozialarbeiterische Fachkräfte dazu benötigt wurden. Die Tätigkeit ist jedoch dieselbe geblieben.“
Mag. S gibt dazu an:
„Es wäre für uns auch für die rechtliche Beurteilung einer allfälligen Gemeinnützigkeit interessant, die entsprechenden Verträge vorgelegt zu bekommen.“
(Es wird mit den Vertretern des B ausgemacht, dass die entsprechenden Verträge noch vorgelegt werden. Dies ist einmal der Vertrag, der zwischen den zu pflegenden Klienten und dem B abgeschlossen wird und der Vertrag, der mit den Betreuungspersonen abgeschlossen wird.
Es wird dem Landesverwaltungsgericht die Neufassung des Gesellschaftsvertrages von 2014 vorgelegt und diese wird als Anlage B zum Protokoll genommen. Es wird mit Mag. S vereinbart, dass dieser Gesellschaftsvertrag mitsamt dem Protokoll an die Abgabenkommission zugeleitet wird.)
Der Zeuge Mag. H P gab in der mündlichen Verhandlung an:
„Ich habe 2007 den Auftrag bekommen, für langfristige Betreuungsverhältnisse ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln. Ausgehend von den bestehenden Hauskrankenpflegediensten, wie Mobile Hilfsdienste und Hauskrankenpflege, ist es darum gegangen, ein entsprechendes funktionierendes Modell zu entwickeln. Dieses Modell haben wir damals mit dieser bereits gegründeten gemeinnützigen GmbH aufgebaut. Ich war damals der erste Geschäftsführer. Das war damals sozusagen auf der grünen Wiese. Wir hatten damals noch nicht einmal ein Büro. Zunächst haben wir einmal eine Einrichtung gesucht, sprich einen Arbeitsplatz. Im Jahr 2008 wurde das Gewerbe der selbstständig betreuenden Personen entwickelt. Es war jedoch noch nicht anerkannt. Erst am 01.06.2008 ist dazu dann die politische Klarheit gekommen. Es war für uns ein wichtiger Schritt herauszuarbeiten, in welcher Rechtsform diese Leute ihre Arbeit machen. Dann war es auch wichtig zu entwickeln, welche Rolle der B im Zusammenhang mit den anderen Einrichtungen hat. Diese Phase war einfach die Entwicklungsphase für ein nachhaltiges System. Wichtig ist auch, dass wir damals gleich parallel mit Betreuungsdienstleistungen begonnen haben. Ich war ganz am Anfang im Jahr 2007 alleine. Auf Frage des Landesverwaltungsgerichtes, ob wir im Sekretariat arbeitenden auch Leute betreut haben, gebe ich an, ja wir sind auch hinausgegangen und haben Leute betreut. Es waren halt dann die ersten drei-vier Jahre wirklich Entwicklungsjahre. Im Rahmen unserer Arbeit haben wir dann gemerkt, dass es eine richtige Betreuung für die Leute braucht und dass auch die richtigen Betreuungspersonen zu den richtigen Klienten oder Patienten kommen müssen.“
Dazu gibt Herr H an:
„Herr Mag. P war immer in der Vermittlungstätigkeitrolle tätig. Er hat immer geschaut, dass die richtigen Pflegepersonen zu den richtigen Patienten kommen. Er hat die Leute selbst nicht wirklich gepflegt. Er hat eine Betreuungsleistung in dieser Richtung vorgenommen, dass er den Leuten die richtigen Pflegepersonen oder Betreuungspersonen vermittelt hat.“
Dazu gibt Mag. P an:
„Wichtig war jedoch, dass es vor Ort war. Ich war sehr wohl vor Ort bei den zu pflegenden Leuten oder zu betreuenden Leuten und habe die Situation abgeklärt und eruiert, welche Form der Betreuung diese Personen benötigen.“
Dazu gibt Frau Mag. J an:
„Es war auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass unsere Leute aus dem B auch die zu pflegenden oder zu betreuenden Personen begleitet haben, um abzuklären, dass auch die Betreuung angenommen werden kann.“
Die informierte Auskunftsperson Herr H gibt dazu an:
„Es darf hier nicht auf dem Vermittlungsvertrag wortwörtlich beharrt werden. Es war schon eine Vermittlung, aber hier muss es ganzheitlich gesehen werden, weil es hier ja eigentlich um die Betreuung von diesen Personen gegangen ist.“
Herr Mag. P gibt dazu an:
„Eigentlich war es nicht wirklich so, wie eine wortwörtliche Vermittlung, sondern mehr ein Clearing.“
Der Vertreter der Beschwerdeführerin gibt an:
„Daher sehen wir uns nicht in der Rolle einer traditionell gewerblichen Vermittlung, sondern mehr in der Rolle einer ganzheitlichen Fürsorge.“
Dazu gibt Herr P an:
„Es werden jene Leute betreut, die ab Pflegestufe 3 eingestuft sind.“
Frau Mag. J gibt dazu an:
„Ich möchte betonen, dass sich aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen es sich so ergeben hat, dass viele zu betreuende Personen, welche noch in alten Familienstrukturen gelebt haben, plötzlich nicht mehr im Familienverband versorgt und gepflegt werden konnten, weil eben die gesellschaftlichen Strukturen durch andere Berufstätigkeiten sich geändert haben. Und es war unsere Aufgabe hier ein neues System einzuführen, dass diese Leute doch noch im Rahmen ihrer gewohnten Umgebung betreut und gepflegt werden können und diese neue Art der Betreuung aber auch annehmen. Hier haben wir sehr viel Feingefühl benötigt und Begleitungsarbeit, auch Sozialarbeit leisten müssen.“
Herr H gibt dazu an:
„Der B hat diese Einnahmen aus dieser Vermittlungstätigkeit, was aber ein ganz kleiner Anteil ist. Bis zur Kostendeckung wird der Rest vom Land Vorarlberg finanziert. Dies vor allem auch von den Gemeinden, sprich eigentlich vom Sozialfonds. Der B muss regelmäßig Anträge stellen, dann wird auch diesbezüglich vom Sozialfonds beschlossen, diesem Antrag Folge zu geben und inwiefern Folge gegeben wird. Es ist sogar so, dass der B für gewisse Feiern, wie zB Jubiläen oder so ähnliches oder auch Büroumbauten beim Sozialfonds einen Antrag stellen muss.“
5.1. Gemäß § 34 Abs 1 der Bundesabgabenordnung (BAO)sinddie Begünstigungen, die bei Betätigung für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke auf abgabenrechtlichem Gebiet in einzelnen Abgabenvorschriften gewährt werden, an die Voraussetzungen geknüpft, dass die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, der die Begünstigung zukommen soll, nach Gesetz, Satzung, Stiftungsbrief oder ihrer sonstigen Rechtsgrundlage und nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar der Förderung der genannten Zwecke dient. Auf Verlangen der Abgabenbehörde haben Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die im Inland weder ihren Sitz noch ihre Geschäftsleitung (§ 27) haben, nachzuweisen, dass sie die Voraussetzungen des ersten Satzes erfüllen.
Nach Abs 2 leg. cit.gelten die in den §§ 35 bis 47 für Körperschaften getroffenen Anordnungen auch für Personenvereinigungen, Vermögensmassen und für Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechtes.
Gemäß § 35 Abs 1 BAOsind solche Zwecke gemeinnützig, durch deren Erfüllung die Allgemeinheit gefördert wird.
Nach Abs 2 leg. cit. liegteine Förderung der Allgemeinheit nur vor, wenn die Tätigkeit dem Gemeinwohl auf geistigem, kulturellem, sittlichem oder materiellem Gebiet nützt. Dies gilt insbesondere für die Förderung der Kunst und Wissenschaft, der Gesundheitspflege, der Kinder-, Jugend- und Familienfürsorge, der Fürsorge für alte, kranke oder mit körperlichen Gebrechen behaftete Personen, des Körpersports, des Volkswohnungswesens, der Schulbildung, der Erziehung, der Volksbildung, der Berufsausbildung, der Denkmalpflege, des Natur-, Tier- und Höhlenschutzes, der Heimatkunde, der Heimatpflege und der Bekämpfung von Elementarschäden.
Gemäß § 39 BAO liegt ausschließliche Förderung vor, wenn folgende fünf Voraussetzungen zutreffen:
1. Die Körperschaft darf, abgesehen von völlig untergeordneten
Nebenzwecken, keine anderen als gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen.
2. Die Körperschaft darf keinen Gewinn erstreben. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten.
3. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer Sacheinlagen zurückerhalten, der nach dem Zeitpunkt der Leistung der Einlagen zu berechnen ist.
4. Die Körperschaft darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen (Vorstandsgehälter oder Aufsichtsratsvergütungen) begünstigen.
5. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zweckes darf das Vermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, nur für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verwendet werden.
Gemäß § 40 Abs 1 BAOliegtunmittelbare Förderung vor, wenn eine Körperschaft den gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck selbst erfüllt. Dies kann auch durch einen Dritten geschehen, wenn dessen Wirken wie eigenes Wirken der Körperschaft anzusehen ist.
Nach Abs 2 Z 1 leg. cit.dient eine Körperschaft, die sich auf die Zusammenfassung, insbesondere Leitung ihrer Unterverbände beschränkt, gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken, wenn alle Unterverbände gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen.
5.2. Gemäß § 1 KommStG 1993 unterliegen der Kommunalsteuer die Arbeitslöhne, die jeweils in einem Kalendermonat an die Dienstnehmer einer im Inland gelegenen Betriebsstätte des Unternehmens gewährt worden sind. Gemäß § 3 Abs. 1 KommStG 1993 umfasst das Unternehmen die gesamte gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Unternehmers. Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn (Überschuss) zu erzielen, fehlt oder eine Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mitgliedern tätig wird. Gemäß § 3 Abs. 2 KommStG 1993 ist Unternehmer, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt. Das Kommunalsteuergesetz bedient sich zur Begriffsdefinition des Unternehmers im § 3 Abs. 2 und zur Umschreibung des Umfanges des Unternehmens im § 3 Abs. 1 erster und zweiter Satz der Formulierungen des § 2 UStG. Daraus lässt sich ableiten, dass die Begriffe in beiden Rechtsbereichen den gleichen Inhalt haben (vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 17. März 1999, 97/13/0089, m.w.N. und VwGH 24.11.1999, 95/13/0185).
Gemäß § 8 Z 2 KommStG sind Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, soweit sie mildtätigen Zwecken und/oder gemeinnützigen Zwecken auf dem Gebiet der Gesundheitspflege, Kinder-, Jugend-, Familien-, Kranken-, Behinderten-, Blinden- und Altenfürsorge dienen (§§ 34 bis 37, §§ 39 bis 47 der Bundesabgabenordnung) von der Kommunalsteuer befreit. § 5 Abs. 3 letzter Satz ist sinngemäß anzuwenden.
5.3. Die Steuerbefreiung ist demnach von drei Kriterien abhängig und zwar:
o Der Rechtsträger muss eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse sein
o Der Rechtsträger muss bestimmten Zwecken dienen und zwar
Mildtätigen Zwecken ohne bestimmte gesetzlich determinierte Aufgabenbereiche oder
Gemeinnützigen Zwecken auf dem Gebiet der gesetzlich taxativ aufgezählten Aufgabenbereiche oder
Sowohl mildtätigen als auch gemeinnützigen Zwecken auf dem Gebiet der gesetzlich taxativ aufgezählten Aufgabenbereiche oder
Mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken ohne bestimmte Aufgabenbereiche.
o Der Rechtsträger beschäftigt entgeltlich Dienstnehmer in einer inländischen Betriebsstätte.
Zur Frage der Gemeinnützigkeit wird im § 8 Z 2 KommStG 1993 auf die §§ 34 ff BAO verwiesen. Gemäß § 35 Abs 1 BAO sind gemeinnützig solche Zwecke, durch deren Erfüllung die Allgemeinheit und damit gemäß § 36 Abs 1 BAO ein unbeschränkt großer Personenkreis gefördert wird. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt gemäß § 35 Abs 2 BAO vor, wenn die Tätigkeit auf geistigem, kulturellem, sittlichem, oder materiellem Gebiet nützt, was auf jeden Fall für die Förderung der Allgemeinheit im Bereich der Gesundheitspflege bzw. Krankenfürsorge gilt. Jedoch sind die abgabenrechtlichen Begünstigungen aus dem Rechtsgrund der Gemeinnützigkeit an die Voraussetzung ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar der Förderung der genannten Zwecke geknüpft. Die Kriterien für die Ausschließlichkeit sind in § 39 BAO aufgezählt. Die gemeinnützigen Zwecke sind auch dann selbst erfüllt, wenn die Erfüllung durch einen Dritten geschieht, wenn dessen Wirken als eigenes Wirken des Rechtsträgers anzusehen ist. Wesentlich ist im Zusammenhang mit der Unmittelbarkeit, dass die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse die gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecke selbst realisiert und nicht bloß Sachleistungen zur Verfügung stellt.
Neben den beschriebenen begünstigungswürdigen Zwecken existieren weiters gesetzliche Bedingungen und Bindungen gemeinnütziger Zweckverfolgung, welche erfüllt werden müssen, um als Organisation diverse abgabenrechtlicheBegünstigungen auch tatsächlich zu erhalten. Dazu zählen die ‚Ausschließlichkeit‘und ‚Unmittelbarkeit‘ in der Zweckverfolgung und die damit verbundene Mittel- und Vermögensbindung. In der kumulativ zu sehenden Aufzählung in § 39 BAO wird gleich im Abs 1 zum Ausdruck gebracht, dass die in § 35 aufgezählten gemeinnützigen Zwecke bindend sind und andere Zwecke nur in völlig untergeordnetem Ausmaß verfolgt werden dürfen. Mit völlig untergeordneten Nebenzwecken sind Tätigkeiten der Organisation gemeint, welche nicht der ausschließlichen Zweckerfüllung dienen und daher maximal 10 Prozent der Gesamttätigkeiten ausmachen dürfen (so die VereinsR Rz 114). Die Verwaltungspraxis richtet sich bei Überprüfung dieser Bestimmung an Parameter wie Ausgaben oder Zeiteinsatz und bedient sich bei geringfügigen Überschreitungen eines mehrjährigen Beobachtungszeitraumes. Ein bloßes ‚Überwiegen‘ des gemeinnützigen Zwecks reicht also nicht aus – der durchgängige gemeinnützige Zweck muss belegt und nachgeprüft werden können, um den Gemeinnützigkeitsstatus und die damit verbundenen Begünstigungen nicht zu gefährden.
Bereits bei der Bedingung ‚Ausschließlichkeit‘ in der Zweckverfolgung wird ersichtlich, dass das bloße Lesen und Kennen der fünf Absätze des § 39 BAO für gemeinnützige Organisationen nicht ausreicht. Neben der Bedingung ‚Ausschließlichkeit‘ gibt es noch eine weitere wichtige Voraussetzung, die Organisationen in ihrer Satzung, ihrem Gesellschaftsvertrag und somit in ihrer Geschäftsführung konsequent beachten müssen. Der Begriff ‚unmittelbar‘ will zum Ausdruck bringen, dass die Tätigkeiten und die damit verbundenen, angestrebten Wirkungen von gemeinnützigen Organisationen selbst verwirklicht werden müssen. Daher gibt es auch eine Reihe von Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs die aussagen, dass die Förderung einzelner Wirtschaftstreibender oder bestimmter Wirtschaftszweige wie zB des Fremdenverkehrs die Allgemeinheit nur mittelbar erfolgt. (VwGH 27.01.1998, 07/14/0022).
Wenn ein Dritter für die Erfüllung der Gemeinnützigkeit der Körperschaft herangezogen wird muss dessen Wirken allerdings wie ein eigenes Wirken der Organisation anzusehen sein, dh der Erfüllungsgehilfe muss dabei in einem direkten Weisungs- oder Abhängigkeitsverhältnis zur Organisation stehen. Allerdings darf das Einschalten des Erfüllungsgehilfen nicht dazu führen, dass das Erwerbsstreben einer Profit-Organisation gefördert wird. Ist also der Erfüllungsgehilfe nicht weisungsgebunden und wird er in seinem Gewinnstreben irgendwie gefördert, so wird dieses Wirken als begünstigungsschädlich eingestuft und der Organisation der Gemeinnützigkeitsstatus aberkannt – so die Rechtsprechung. (VwGH 26.06.2000, 95/17/0003).
6.1. Die Abgabenkommission der Stadt F stützt sich auf ein Erkenntnis des UFS-Linz vom 18.10.2012, GZ RV/0133-L/09.Dazu ist Folgendes zu bemerken:
Die Tätigkeit des dortigen Vereins war laut Gesellschaftsvertrag in § 2 auch nicht auf Gewinn gerichtet. Der Vereinszweck war die Unterstützung bei Pflegemaßnahmen zu Hause, die Erstellung von Standards für häusliche Pflegemaßnahmen, Maßnahmen zur Qualitätskontrolle (Qualitätsmanagement) für die Pflege zu Hause, Schulung für die Pflege zu Hause.
Wenn die Abgabenkommission der Stadt Fsich auf das Erkenntnis des UFS aus dem Jahr 2009, GZ RV/0133-L/09, stützt, ist dem entgegenzuhalten, dass im gegenständlichen Fall gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages der Gegenstand des Unternehmens „die Vermittlung und die Erbringung von Dienstleistungen im Betreuungsbereich im Land Vorarlberg insbesondere in Zusammenarbeit mit den bestehenden Betreuungseinrichtungen der Krankenpflegevereine und der mobilen Hilfsdienste ist. Im Gegensatz dazu hat der dortige Verein lediglich Vermittlungsleistungen gegen Entgelt erbracht.
Gegenstand im vorliegenden Fall istdie Gemeinnützigkeit der B GmbH gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages, der ebenfalls nicht auf Gewinn gerichtet ist, die Vermittlung und Erbringung von Dienstleistungen im Betreuungsbereich im Land Vorarlberg, insbesondere in Zusammenarbeit mit den bestehenden Betreuungseinrichtungen der Krankenpflegevereine und der mobilen Hilfsdienste.Die Gesellschaft ist zur Durchführung von allen Geschäften und Maßnahmen, die zur Erreichung des genannten gemeinnützigen Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, berechtigt. Diese Leistung erbringen die Mitarbeiter nach dem oben Gesagten sehr wohl ausschließlich und unmittelbar.
Der Gesellschaftszweck ist somit wesentlich weiter gefasst als jener des Vereines, welcher Gegenstand der Entscheidung des UFS aus dem Jahr 2012, GZ RV/0133-L/09 war. Es sind auch hier ausländische Pflegekräfte vorhanden, die vermittelt werden, und die auch selbstständig und weisungsfrei ihre Leistungen erbringen. Jedoch werden diese ebenfalls durch die Mitarbeiter des B begleitet und aktiv unterstützt, und ist daher die Leistung der GmbH selbst wesentlich vielfältiger und mit anderen gemeinnützigen Organisationen verknüpft, sodass ein Vergleich mit dem Verein aus dem zitierten UFS – Erkenntnis nach Ansicht des Landesverwaltungsgericht nicht vorgenommen werden kann. Die verfahrensgegenständliche GmbH nimmt aktiv an der Vermittlung der Betreuungskräfte teil, indem sie beratend tätig ist und auch die Betreuung und insbesondere die zu betreuenden Personen begleitet, indem immer wieder vor Ort bei den zu betreuenden Personen Gespräche geführt werden und eruiert wird, was diese benötigen und ob die Qualität der Pflege passt. Auch werden die Abrechnungen der Leistungen von den Betreuungskräften an die zu betreuenden Personen von den Mitarbeitern des B vorgenommen, sodass nicht von einer reinen Qualitätskontrolle oder Vermittlungstätigkeit gesprochen werden kann. Im Gegensatz zum zitierten Erkenntnis des UFS mit dem die Festsetzungen der Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer bestätigt worden sind, wird die Beschwerdeführerin auch beim zuständigen Finanzamt als gemeinnützige GmbH anerkannt.
6.2. Mit Schreiben des Landesverwaltungsgerichtes vom 01.10.2018 wurde die Beschwerdeführerin zur Stellungnahme zu den folgenden Fragen aufgefordert:
„Bitte berücksichtigen Sie insbesondere den Zeitabschnitt 2007 bis 2012
• Die Leistungen, die die Betreuer/Innen bei den zu betreuenden Personen erbringen müssen abgerechnet werden.
Wie erfolgt diese Abrechnung? Wer nimmt diese vor? Wer kontrolliert den Geldfluss? Werden diese Abrechnungen direkt bei den zu betreuenden Personen im Haushalt erstellt, oder im Büro? Wie war das in den Jahren 2007 bis 2012 und wie ist das heute?
• Die Vermittlung der Betreuer geschieht über persönlichen Kontakt der Mitarbeiter des B mit den Betreuern und den zu betreuenden Personen.
Wie erfolgt dieser Kontakt konkret? Wird da ein Mitarbeiter des B wie in einem Projekt der jeweiligen Vermittlung zugeteilt? Wie viel Arbeitszeit hat diese Leistung in Anspruch genommen? Mehr als die Hälfte der Arbeitszeit des Mitarbeiters des B? Wie war das in den Jahren 2007 bis 2012 und wie ist das heute?
• Die Mitarbeiter des B halten während der Betreuungszeit auch Kontakt zu den Betreuern.
Wie läuft dieser Kontakt ab? Wird da ein Mitarbeiter des B direkt einem Betreuer zugeteilt? Wieviel Arbeitszeit des B-Mitarbeiters nimmt das in Anspruch? Mehr als die Hälfte der Arbeitszeit? Wie war das in den Jahren 2007 bis 2012 und wie ist das heute?
• Gab es in den Jahren 2007 bis 2012 Vermittlungsgebühren? Wie hoch waren diese und wie hoch sind diese heute im Verhältnis zu den Förderungen, die vom Land Vorarlberg ausbezahlt werden?
• Wie treten die Mitarbeiter des B bei den persönlichen Kontakten zu den betreuenden und den Betreuern auf? Stehen der persönliche Kontakt im Vordergrund oder die Vermittlung und die Qualitätssicherung? Wird überwiegend vermittelt und Qualitätssicherung betrieben oder Kontakte und Begleitung durch die Mitarbeiter des B gepflegt?“
In ihrer Stellungnahme vom 02.11.2018 führte die Beschwerdeführerin zu diesen Fragen aus:
„1. Abrechnung der Leistungen, die die Betreuer/innen bei den zu betreuenden Personen
erbringen müssen.
a. Abgerechnet wird zwischen KlientInnen und Betreuungskraft. Die MitarbeiterInnen des B unterstützen bei der Rechnungslegung vor Ort, da sowohl Klient/innen wie Betreuungskräfte in vielen Fällen mit dieser Aufgabe überfordert sind. In den Anfangsjahren gab es keine Erfahrungen, da war auch noch sehr viel Misstrauen da – dies auf beiden Seiten.
b. Die Abrechnung des Tageshonorars der Betreuungskräfte erfolgt auch heute noch direkt zwischen KlientInnen und Betreuungskräften. Die MitarbeiterInnen sind auch heute noch unterstützend zur Stelle, da beide Seiten immer noch mit dieser Aufgabe überfordert sind. Rechnungsformulare werden vom B zur Verfügung gestellt.
c. Bei Zahlungsverzug bzw. bei Nichtbezahlung der Honorare werden die MitarbeiterInnen intervenierend aktiv.
d. Die Betreuungskräfte werden bei der Erstellung der Einkommensteuererklärung, beim Ansuchen der Familienbeihilfe und bei Fragen zur Sozialversicherung unterstützt.
2. Die Vermittlung der Betreuungskräfte geschieht über persönlichen Kontakt der Mitarbeiter des B mit den zu betreuenden Personen.
a. Das Erstgespräch/Beratungsgespräch mit den KlientInnen u/o deren Angehörigen wird im Büro oder direkt vor Ort bei den KlientInnen durchgeführt. Dabei werden alle relevanten Themen, der Betreuung betreffend, besprochen: Leistungen, Finanzierung, welche Formalitäten sind zu erledigen, Anreise und Einführung der Betreuungskräfte, was ist wenn es Probleme gibt, was ist wenn die Chemie nicht stimmt u.v.m. Hohe fachliche und soziale Kompetenzen sind hier gefragt.
b. Die Auswahl der Betreuungskräfte ist ein besonders sensibler Bereich. Die ganzheitliche Abklärung der Betreuungssituation ist Grundvorsausetzung für das spätere Funktionieren. Charaktereigenschaften, Erfahrung und Kompetenz der Betreuungskraft müssen zur betreuenden Person passen. Empathie ist der Schlüssel.
c. Je ein Mitarbeiter wird einer zu betreuenden Person/Familie zugewiesen.
d. Die Beratung und Begleitung der Familien nahm zwischen 2007 und 2012 sicher mehr als die Hälfte der Arbeitszeit in Anspruch.
e. Heute sind es rund 5/8 der Arbeitszeit
3. Die Mitarbeiter halten während der Betreuungszeit auch Kontakt zu den Betreuungskräften
a. Die MitarbeiterInnen des B halten während der gesamten Betreuungszeit Kontakt zu den Betreuungskräften. Grundsätzlich sieht sich der B als „Brückenbauer“ zwischen KlientInnen und den Betreuungskräften.
b. Es werden persönliche Gespräche mit den Betreuungskräften direkt beim Klienten und im Büro geführt. Dazu gehört beispielsweise die Einführung der Betreuungskraft, Besprechung des Leistungsumfanges, Umgang mit Haushaltsgeld – Führung eines Haushaltstagebuches, Dokumentation, Delegation von medizinischen Tätigkeiten u.v.m.
c. Delegation von medizinischen Tätigkeiten: Hier braucht es die Vernetzung mit der Hauskrankenpflege bzw. mit dem Hausarzt. Dies wird auch von den MitarbeiterInnen des B veranlasst.
d. Auch (Weiter)-qualifizierungsmaßnahmen werden durchgeführt.
e. 2 Nachmittage/Woche sind fix für die Betreuerkräfte reserviert.
f. Zwischen 2007 und 2012 wurden viele Beratungsgespräche zu Gewerbe- und Steuerrechtlichen Fragen durchgeführt und auch Informationsveranstaltungen organisiert.
g. Die MitarbeiterInnen übernehmen die Vermittlerrolle bei Problemen und Konflikten zwischen KlientInnen und Betreuungskräften.
h. Dies nahm gut ¼ der Zeit ein.
i. Stand 2018: ähnlich wie in den Jahren 2007 bis 2012, also gut ¼ der Zeit.
4. Finanzierung und Förderung
In den Jahren 2007 bis 2010 wurde die V B GmbH fast ausschließlich aus Mitteln aus dem Sozialfonds finanziert. Es wurden keine Vermittlungsgebühren von KlientInnen eingehoben. PersonenbetreuerInnen bezahlten ab 2009 einen Beitrag von 50 Euro jährlich. 2011 und 2012 wurden dann Vermittlungsgebühren für KlientInnen eingehoben.
Jahr | Budget/ Aufwendungen | Subventionen | Einkünfte aus Vermittlung | Förderung Sozialfond in % | ||
Stammkapital € 35.000 | € 35.000 |
| ||||
2007 € 42.500 | € 36.000 |
| ||||
2008 €107.800 | € 95.800 |
| ||||
2009 | € 149.362 | € 144.500 | € 4.862 | 96,74 % | ||
2010 | € 152.581 | € 147.000 | € 5.581 | 96,34 % | ||
2011 | € 204.587 | € 155.000 | € 49.587 | 75,76 % | ||
2012 | € 242.690 | € 168.000 | € 74.690 | 69,22 % | ||
Heute liegt die Förderung aus dem Sozialfond bei rund 60 Prozent.
Vermittlungsgebühren 2011 und 2012
o 240 Euro für die Beratung – Vermittlung und Begleitung bei einem 24h Auftrag
o 120 Euro für die Organisation einer Urlaubsvertretung oder einer stundenwiesen Betreuung.
2013 Einführung des Vertragsservices für alle Aufträge
Stand 31.10.2018
o 580 Euro bei Organisation einer unbefristeten 24h Betreuung,
o 300 Euro für die Organisation einer stundenweisen Betreuung
o 170 Euro für befristete Aufträge bis 4 Wochen
5. Wie treten die Mitarbeiter des B bei den persönlichen Kontakten zu den betreuenden und den Betreuern auf?
a. Die Kernaufgaben der MitarbeiterInnen des B kann man mit den 3 Begriffen: BERATUNG - VERMITTLUNG – BEGLEITUNG – festmachen.
b. Im Mittelpunkt stehen die KlientInnen mit Ihren Bedürfnissen und Anliegen. Damit 24h Betreuung zu Hause funktioniert braucht es ein gutes Vertrauensverhältnis. Dies sowohl zu den MitarbeiterInnen des B, wie auch später zur Betreuungskraft. Es fällt vielen Menschen schwer die Tür einer fremden Person, aus einer fremden Kultur, zu öffnen. Umso wichtiger ist es, dass die MitarbeiterInnen des B während der gesamten Betreuungszeit als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Dies geht weit über die Vermittlung und Qualitätssicherung heraus. Die Begleitung war und ist eines der 3 Kerngeschäfte.
c. Ein wesentlicher Punkt in der Begleitung ist auch die Definition des Leistungsbereiches der Betreuungskräfte. Die Koordination der Wünsche und des Bedarfs von Seiten der KlientInnen und deren Angehörigen und den Möglichkeiten der Betreuungskräfte braucht immer wieder die Unterunterstützung der MitarbeiterInnen des B und kann nur vor Ort, das heißt direkt beim Klienten, erfolgen.
d. Die Finanzierungsberatung und die Unterstützung bei Förderanträgen war vor allem in den Aufbaujahren ein zentraler Punkt in der Arbeit der MitarbeiterInnen und bedurfte natürlich des direkten Kontakts mit den KlientInnen.
e. In den Jahren 2007 bis 2012 wurde Aufbauarbeit geleistet. Die Legalisierung dieser neuen Form der Betreuung brachte viele Herausforderungen mit sich mit denen im Alltag umgegangen werden musste. Es ging um die Implementierung dieser neuen Betreuungsform ins vorhandene Betreuungs- und Pflegenetz. Es ging und geht auch heute noch um die Akzeptanz der zu betreuenden Personen, dass Familienmitglieder die Betreuung nicht mehr in der Form wie früher, auf Grund der veränderten Familienverhältnisse, leisten können. Dies führt immer wieder zu Reibungen innerhalb der Familien die dann häufig auf die Betreuungssituation in Form von vorgeschobenen Konflikten, übergehen. Die MitarbeiterInnen des B übernehmen hier häufig eine „Mediatorfunktion“.
Mit dieser Stellungnahme möchte ich einen noch detaillierteren Einblick in die Arbeit der V B GmbH geben. Bin mir aber bewusst, dass ich wohl immer noch viele Tätigkeitsbereiche nicht zur Gänze beschrieben habe. Bei Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Zur „Lesevereinfachung“, bei der Beschreibung der Tätigkeitsbereiche habe ich, wenn nicht anders notwendig war, die Gegenwart verwendet. Zeitlich betrifft es natürlich die Jahre zwischen 2007 und 2012.“
6.3. Die detailreiche Stellungnahme der Beschwerdeführerin zeigt nochmals auf, dass die Aufgaben der Mitarbeiter des B sehr viel weitreichender sind, als im Bescheid der Abgabenkommission der Stadt F ausgeführt worden ist. In diesem geht die Abgabenkommission davon aus, dass die Pflegeleistung weisungsfrei und unabhängig von externen Pflegekräften erbracht wird und die Beschwerdeführerin lediglich eine Vermittlung und Organisation von diesen Pflegeleistungen vornimmt. Es ist aber im gegenständlichen Fall hervorgekommen, dass die Leistungen der Beschwerdeführerin über die bloße Vermittlung und Organisation von Pflegekräften hinausgehend ist und auch im Beschwerdezeitraum war. So ist es für das Landesverwaltungsgericht durchaus nachvollziehbar, dass die Mitarbeiter des B bei den Abrechnungen der Pflegeleistungen und der Erstellung der Honorare unmittelbar Hilfestellung bieten, da die Beteiligten oft damit überfordert sind. Ebenso ist es nachvollziehbar, dass für jeden Pflegefall ein Mitarbeiter der Beschwerdeführerin als Ansprechperson ständig zur Verfügung stand und steht um bei Problemen Hilfestellung, Mediation etc. bieten zu können. Dass anfänglich kein qualifiziertes Personal für die Beschwerdeführerin gearbeitet hat, liegt nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens offenbar daran, dass zunächst das Projekt „B“ aufgebaut und entwickelt und Erfahrungen gesammelt werden mussten. Es ist somit deutlich hervorgekommen, dass ein großer Anteil der Arbeitszeit der Mitarbeiter der Beschwerdeführerin in der aktiven Unterstützung und Begleitung der Pflegeleistung, Anbahnung derselben und deren Abrechnung liegt.Es liegt daher durch die Beschwerdeführerin bei ihrer gemeinnützigen Tätigkeit Ausschließlichkeit und Unmittelbarkeit vor.
Es kann daher der Meinung der Abgabenkommission der Stadt F nicht gefolgt werden, welche die Beschwerdeführerin als Dritte darstellt, für die in wirtschaftlicher Abhängigkeit von gemeinnützigen Organisationen Dienstleistungen im Kranken-, Pflege und Betreuungsbereich erbracht werden, so wie die Stadt F dies ausgeführt hat. Vielmehr erbringt nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichtes der B selbst unmittelbar gemeinnützige Leistungen, indem er die Abrechnungen für die Pflegeleistungen vornimmt und die Personen, die vom Pflegepersonal betreut werden, durch seine Mitarbeiter persönlich begleiten lässt.Dadurch wird vom Standpunkt des Landesverwaltungsgerichtes in gegenständlichen Fall durch den Beschwerdeführer eine direkte gemeinnützige Fürsorgeleistung erbracht.
Der B erbringt somit ebenso unmittelbare gemeinnützige Dienstleistungen an den zu betreuenden Personen, indem die Mitarbeiter aktiv Gespräche mit den Beteiligten führen und diese persönlich begleiten, in dem sie den persönlichen Kontakt mit den zu betreuenden Menschen halten, und dies durch Zuteilung eines bestimmten Mitarbeiters zu einer bestimmten Betreuungsperson als ständiger Ansprechpartner, und diese auch die Abrechnungen vornehmen für die Pflegeleistungen des Pflegepersonals. Die daneben stattfindende Vermittlungstätigkeit durch den B sowie das Qualitätsmanagement sind lediglich Teilbereiche der Tätigkeit des B. Wenn die Stadt F sich darauf festlegt, dass die gemeinnützige Leistung im gegenständlichen Fall aus der bloßen Vermittlung besteht, so kann dem nicht gefolgt werden, da diese Rechtsauffassung aufgrund der obigen Ausführungen als zu eng gesehen wird.
7. Zusammenfassend ist zu sagen, dass nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichtes im gegenständlichen Fall aufgrund des festgestellten Sachverhaltes und der Ermittlungsergebnisse eine Gemeinnützigkeit im Sinne des § 8 Z 2 KommStG 1993 vorliegend ist. Die Unterstützung des Pflegepersonales, die Mithilfe bei den Abrechnungen als auch die mediativen und moralischen Beistände, die durch die Mitarbeiter des B geleistet werden und einen wesentlichen Teil der Arbeitszeit in Anspruch nehmen, weisen klar darauf hin, dass die gemeinnützige Leistung unmittelbar durch die Beschwerdeführerin selbst erbracht wird. Das Pflegepersonal, welches die zu betreuenden Personen selbständig pflegt, wird während seiner Tätigkeit, die durchaus selbständig erfolgt, von den Mitarbeitern des B ständig begleitet, indem ein Mitarbeiter diesen für die Pflegezeit als ständiger Ansprechpartner zur Verfügung steht und allenfalls regulierend und konfliktlösend eingreifen kann. Der B wurde im Jahr 2007 auf Intention der Landesregierung gegründet, da aufgrund der Legalisierung der 24 Stunden-Betreuung eben der Bedarf gesehen wurde, dass hier Menschen zur Verfügung stehen, die die Betreuungsleistung aktiv unterstützen und begleiten.Die Finanzierung des B erfolgt zum überwiegenden Teil aus Leistungen des Sozialfonds der Vorarlberger Landesregierung. Zudem wurde die Gemeinnützigkeit der Beschwerdeführerin beim Finanzamt anerkannt und wird diese dort als gemeinnützige GmbH geführt. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
8. Zum Vorbringen der Verjährung in der Beschwerde musste im Hinblick auf die Ausführungen und die Stattgabe der Beschwerde nicht mehr näher eingegangen werden.
9. Die Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art 133 Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)