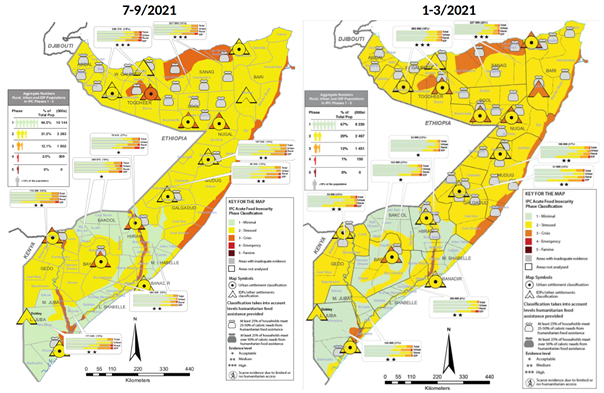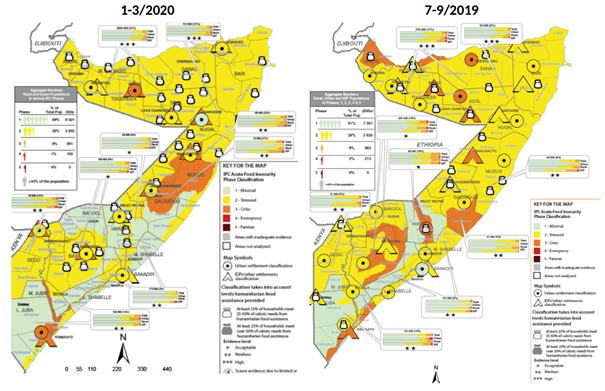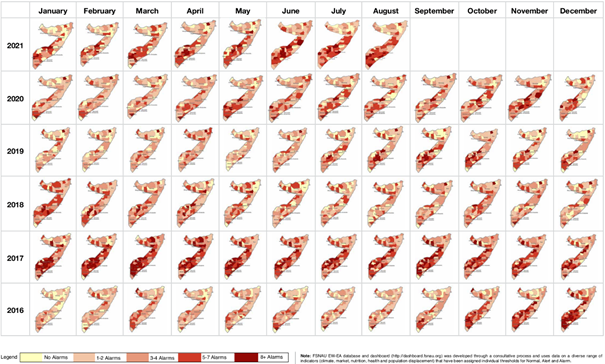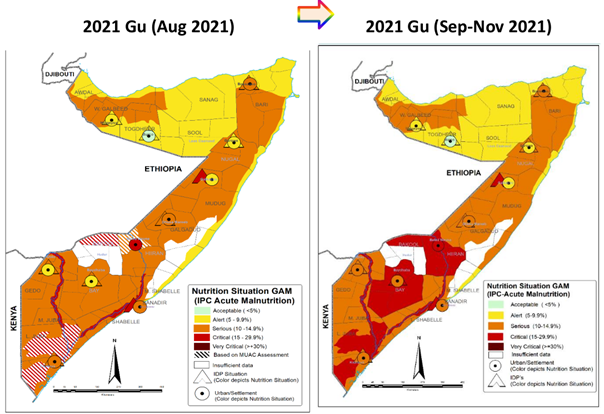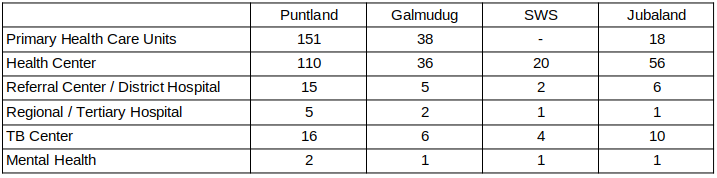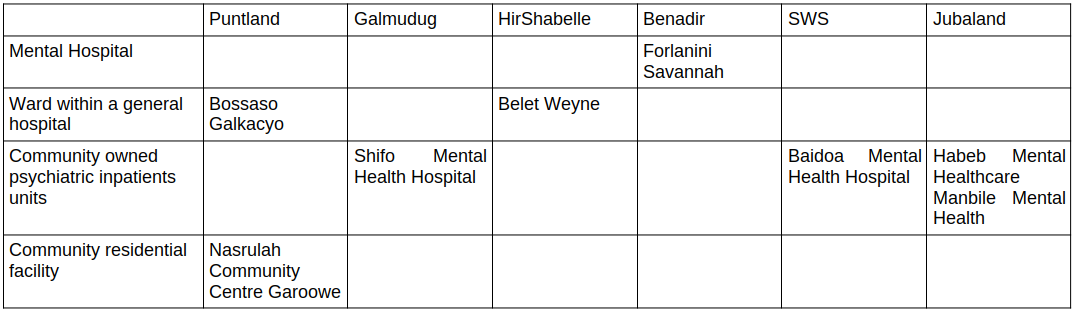AsylG 2005 §2 Abs1 Z13
AsylG 2005 §3 Abs1
AsylG 2005 §57
AsylG 2005 §8 Abs1 Z2
AVG §68 Abs1
BFA-VG §9
B-VG Art133 Abs4
FPG §46
FPG §52 Abs2 Z2
FPG §52 Abs9
FPG §55 Abs1
FPG §55 Abs1a
FPG §55 Abs2
FPG §55 Abs3
VwGVG §28 Abs2
European Case Law Identifier: ECLI:AT:BVWG:2022:W205.2211717.3.00
Spruch:
IM NAMEN DER REPUBLIK!
Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. Schnizer-Blaschka über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Somalia, vertreten durch BBU GmbH, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 24.09.2021, Zl. 1106747703-211042674, zu Recht erkannt:
A)
I. Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 68 AVG als unbegründet abgewiesen.
II. Der Beschwerde wird hinsichtlich der Spruchpunkte II. und III. des angefochtenen Bescheides stattgegeben und diese ersatzlos behoben.
B)
Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.
Entscheidungsgründe:
I. Verfahrensgang:
1. Zum Erstantrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz:
Der Beschwerdeführer, ein männlicher Staatsangehöriger Somalias, stellte am 26.02.2016 seinen ersten Antrag auf internationalen Schutz in Österreich.
Am nächsten Tag fand die niederschriftliche Erstbefragung des Beschwerdeführers statt. Dabei gab er zu seinen Fluchtgründen befragt an, dass Somalia nicht sicher sei. Al Shabaab würde das Land nicht sicher machen und wolle junge Männer rekrutieren. Daher habe er das Land verlassen. Sonst habe er keine Fluchtgründe.
Der Beschwerdeführer wurde in der Folge am 08.06.2018 vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) niederschriftlich einvernommen, wobei die Einvernahme wegen des Gesundheitszustandes und, weil der Beschwerdeführer für den Einvernahmeleiter einen verwirrten Eindruck machte, vorzeitig beendet und ein fachärztliches Gutachten zum psychischen Zustand des Beschwerdeführers eingeholt wurde.
Im psychiatrischen Gutachten vom 27.08.2018 wurde ausgeführt, dass die auslösende Problematik somatische Störungen (insbesondere die starke Psoriasis) sei. Durch den für den Beschwerdeführer schwierigen Zugang zum österreichischen Gesundheitssystem habe dieser das Gefühl, ausgeliefert zu sein, was zu einer massiven Fixierung geführt habe. Aus der Gesamtproblematik sei als Folgeerscheinung ein depressives Zustandsbild entstanden. Der Beschwerdeführer wirke jedoch in seinem Aussageverhalten unauffällig und nicht beeinträchtigt. Wegen seiner körperlichen und psychischen Befindlichkeit sei der Beschwerdeführer auf Behandlung angewiesen. Sei diese Behandlung sichergestellt, bestehe für den Beschwerdeführer bei normaler Lebensführung keine massive Bedrohung, in einen lebensbedrohlichen Zustand zu geraten.
Der Beschwerdeführer wurde am 13.11.2018 neuerlich vom BFA einvernommen. Dabei brachte er im Wesentlichen vor, dass es ihm gut gehe und er keine Medikamente einnehmen müsse. Er habe in XXXX versucht, Kinder von Dorfbewohnern ehrenamtlich zu unterrichten. In Somalia habe er eine Freundin, die er gerne heiraten würde. Er sei nie wegen seiner Clanzugehörigkeit diskriminiert worden. Zuletzt habe er in Mogadischu mit seiner Mutter und seinen zwei Schwestern gewohnt. In Mogadischu habe er sonst keine Verwandten, seine Onkel und Cousins väterlicherseits würden in Middle Shabelle leben, ein Onkel in Lower Shabelle. Seine Eltern und seine Schwestern würden aktuell wieder in XXXX leben.
Zu seinen Fluchtgründen brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, dass in Somalia Personen zu Unrecht inhaftiert und beschuldigt würden und dass man beispielsweise zwangsrekrutiert werden würde. Diese Probleme seien immer noch aktuell. Der Beschwerdeführer sei mitten in der Nacht mitgenommen und verhört worden. Nachgefragt gab der Beschwerdeführer an, dass er Anfang 2014 in einem Dorf namens XXXX eine Schule habe eröffnen wollen. Al-Shabaab hätte dies nicht zugelassen und ihn geschlagen und ihm die Augen verbunden. Gegen eine Bürgschaft sei der Beschwerdeführer freigelassen worden. Im Jahr 2015 hätte Al-Shabaab von seiner Ausreise erfahren und ihn daraufhin telefonisch bedroht. Ihm sei gesagt worden, dass er mit ihnen zusammenarbeiten solle, ansonsten würden sie ihn töten. Bei einer Rückkehr hätte er Angst davor, von Al-Shabaab getötet zu werden.
Mit dem daraufhin erlassenen Bescheid des BFA vom 23.11.2018 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Ziffer 13 AsylG hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Somalia abgewiesen (Spruchpunkt II.). Gemäß § 57 AsylG wurde dem Beschwerdeführer ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt, gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen, sowie gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass seine Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Somalia zulässig sei (Spruchpunkt III., IV., V) und ausgesprochen, dass die Frist für die freiwillige Ausreise gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt VI.).
Die gegen diesen Bescheid fristgerecht erhobene Beschwerde wurde sodann mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 10.07.2019, W234 2211717-1/11E, (im Folgenden: „Vergleichserkenntnis“), zugestellt am selben Tag, als unbegründet abgewiesen.
Begründend wurde iW ausgeführt, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelang, die behauptete Verfolgungs- oder Bedrohungslage in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Somalia ausreichend glaubhaft erscheinen zu lassen. Außerdem konnte nicht angenommen werden, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in seine Heimatstadt XXXX die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre. Er genoss in Somalia eine mehrjährige Schulbildung, verfügte über Englischkenntnisse zumindest auf gutem Konversationsniveau, arbeitete auch vor seiner Ausreise ehrenamtlich als Lehrer und wurde schon damals durch seine Familienangehörigen versorgt. Seine Kernfamilie war in XXXX und weitere Verwandte im Umland dieser Stadt aufhältig, sodass er von diesen – vor allem anfangs – notfalls die notwendige Unterstützung erhalten konnte. Seine Mutter, zu welcher der Beschwerdeführer regelmäßig in telefonischem Kontakt stand, betrieb mit Unterstützung seiner Schwestern ein Teelokal in XXXX . Der Beschwerdeführer war – von schwerer körperlicher Arbeit abgesehen – arbeitsfähig und werde seine erlangte Bildung dazu einsetzen können, sich seinen Lebensunterhalt – sei es als Lehrer oder in anderen Branchen wie bspw. dem Handel oder auch im Teelokal seiner Mutter – zu erwirtschaften. Es war somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Fall der Rückkehr seinen notdürftigsten Lebensunterhalt erwirtschaften und auf familiäre Unterstützung zurückgreifen könnte, weshalb er vor einer Obdachlosigkeit und existentiellen Notlage bewahrt wäre. Auch gehörte der Beschwerdeführer einem der in Somalia leistungsfähigen Hauptclans an, sodass davon ausgegangen werden konnte, dass er auch seitens des Clans Unterstützungsleistungen erfahren würde, zumal XXXX das hauptsächliche Siedlungsgebiet des Sub-sub-Clans XXXX war, dem der Beschwerdeführer angehörte. Im Übrigen ließ auch die Versorgung von XXXX mit Lebensmitteln nicht erwarten, dass der Beschwerdeführer dort wegen Nahrungsmittelknappheit in eine aussichtslose Lage geraten könnte. Auch die Sicherheitslage in der Heimatstadt des Beschwerdeführers stellte sich als ausreichend stabil dar und war hinreichend sicher erreichbar. Es war nicht erkennbar, dass ihm im Zusammenhang mit seinen gesundheitlichen Beschwerden dringend benötigte ärztliche Versorgung oder Medikamente im Herkunftsstaat nicht zugänglich wären. Der Beschwerdeführer stand nicht mehr in ärztlicher Behandlung und nahm nur hin und wieder Medikamente gegen psychische Leiden. Es bestand kein Hinweis darauf, dass sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers in einer die Schwelle des Art. 3 EMRK erreichenden Intensität verschlechtern würde, selbst wenn ihm diese Medikamente im Herkunftsstaat nur eingeschränkt zugänglich sein sollten. Zur Lage in Somalia wurde unter anderem festgestellt, dass nach den überdurchschnittlichen Gu-Regenfällen 2018 die Getreideernte die größten Erträge seit 2010 einbringen werde und sich die Lage bei der Nahrungsversorgung weiter verbesserte, dies galt auch für Einkommensmöglichkeiten und Marktbedingungen. Die Preise für unterschiedliche Grundnahrungsmittel verbilligten sich in Mogadischu gegenüber dem Vorjahr drastisch und lagen unter dem Fünfjahresmittel. Für die Deyr-Regenzeit 2018 (Oktober-Dezember) war auch eine überdurchschnittliche Niederschlagsmenge prognostiziert, womit auch eine weitere Verbesserung bei den Weideflächen und bei der Wasserverfügbarkeit und i.d.F. Verbesserungen bei der Viehzucht und in der Landwirtschaft einhergehen werde.
2. Verfahren über den ersten Folgeantrag:
Am 16.10.2019 stellte der Beschwerdeführer seinen zweiten Antrag auf internationalen Schutz (erster Folgeantrag).
Im Rahmen der Erstbefragung am folgenden Tag gab er auf die Frage, warum er neuerlich einen Asylantrag stelle, an, dass er bereits in Österreich einen Asylantrag gestellt habe und alle seine Fluchtgründe angegeben habe. Er halte seine bisherigen Fluchtgründe aufrecht. Nach Ablehnung seines Asylantrages habe er Österreich verlassen und wäre nach Deutschland weitergereist. In Deutschland habe er in Bayern einen Asylantrag gestellt. Dieser sei abgelehnt worden. Es sei ihm erklärt worden, dass Österreich für sein Asylverfahren zuständig sei. Er habe eine Hautkrankheit und leide an starken Schmerzen an Händen, der Lippe und den Füßen. Österreich habe nichts für ihn gemacht. Er habe in Österreich keine medizinische Behandlung bekommen. In Deutschland sei es ihm gutgegangen, dort habe er eine medizinische Behandlung bekommen. Er habe dort Medikamente bekommen und sei es ihm nach Einnahme der Medikamente besser gegangen. Er leide nun an einer psychischen Erkrankung, konkret an einer schweren Depression.
Befragt, was er bei einer Rückkehr in seine Heimat fürchte, gab er an, dass er im Falle einer Rückkehr nach Somalia befürchte, dass er getötet würde oder an mangelnder medizinischer Behandlung sterbe. Die Frage, ob es konkrete Hinweise gebe, dass ihm bei seiner Rückkehr unmenschliche Behandlung, unmenschliche Strafe, die Todesstrafe drohe oder er mit Sanktionen zu rechnen hätte, verneinte er.
Am 24.10.2019 wurde der Beschwerdeführer vor dem BFA einvernommen. Hierbei gab er auf die Frage nach den Gründen für seine neuerliche Asylantragstellung an, dass er knapp vier Jahre in Österreich gewesen sei. In dieser Zeit habe er weder Asyl bekommen, noch gesundheitliche Fortschritte gemacht. Er habe auch zwei negative Entscheidungen bekommen. Da er dann die Grundversorgung und keine Hilfe mehr bekommen habe, habe er sich entschlossen, nach Deutschland weiterzureisen, wo er einen Asylantrag gestellt und auch Unterkunft bekommen habe sowie medizinisch versorgt worden sei. Dann habe ihn Österreich zurückgeholt. Es gehe ihm derzeit psychisch auch nicht gut. Außerdem verschlechtere sich der Zustand seiner Haut. Man verlange immer Papiere, wenn er zum Arzt gehen wolle. Befragt, ob sich bezüglich seiner Ausreisegründe etwas geändert habe, gab er an, dass die Probleme, die er im ersten Verfahren geschildert habe, immer noch bestehen würden. Zusätzlich habe er diese gesundheitlichen Probleme, die in Somalia nicht behandelbar seien. Nachdem die Probleme mit seiner Haut nicht besser geworden seien, habe er auch psychische Probleme bekommen, er sei sogar kurz davor gewesen, sich etwas anzutun.
Mit dem Bescheid des BFA vom 04.11.2019 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 16.10.2019 gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache sowohl hinsichtlich des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) als auch bezüglich des Status des subsidiär Schutzberechtigten zurückgewiesen (Spruchpunkt II.), ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt III.). Gemäß § 10 Abs. 1 Z. 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z. 2 FPG 2005 erlassen (Spruchpunkt IV.). Gemäß § 52 Abs. 9 FPG wurde festgestellt, dass die Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Somalia zulässig sei (Spruchpunkt V.) und gemäß § 55 Ab. 1a FPG keine Frist für die freiwillige Ausreise gewährt (Spruchpunkt VI.). Gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 2 Z 6 FPG wurde gegen den Beschwerdeführer ein auf die Dauer von 2 Jahren befristetes Einreiseverbot erlassen (Spruchpunkt VII.) Weiters wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 15b Abs. 1 AsylG 2005 aufgetragen, ab 17.10.2019 in einem namentlich genannten Quartier Unterkunft zu nehmen (Spruchpunkt VIII.).
Mit hg. Erkenntnis vom 06.07.2020, W105 2211717-2/8E, wurde die dagegen erhobene Beschwerde betreffend die Spruchpunkte I., II., III., IV., V., VI. sowie VIII. als unbegründet abgewiesen und hinsichtlich des Spruchpunktes VII. des angefochtenen Bescheides insoweit stattgegeben, als das Einreiseverbot auf 1 Jahr herabgesetzt wird.
Dies wurde zusammengefasst damit begründet, dass der Beschwerdeführer bloß ein "Fortbestehen und Weiterwirken" des schon im ersten Asylverfahren erstatteten und für unglaubwürdig erkannten Vorbringens behauptete und im Ergebnis die erneute sachliche Behandlung seines mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 10.07.2019 bereits rechtskräftig entschiedenen Antrags auf internationalen Schutz beabsichtigte. Auch im Hinblick auf Art. 3 EMRK war nicht erkennbar, dass die Rückführung des Beschwerdeführers nach Somalia, hier in die Stadt Mogadischu, zu einem unzulässigen Eingriff führen würde und er bei seiner Rückkehr in eine Situation geraten würden, die eine Verletzung von Art. 2 und 3 EMRK mit sich brächte oder ihm jedwede Lebensgrundlage fehlen würde. Der Beschwerdeführer war der Landessprache Somali mächtig, mit den kulturellen und religiösen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates hinreichend vertraut jung sowie grundsätzlich arbeitsfähig, sodass ihm die Aufnahme von Gelegenheitsarbeiten und damit die Sicherung seines Lebensunterhaltes möglich und zumutbar war. Hinzu kam, dass die Eltern und Geschwister des Beschwerdeführers sowie ein Onkel und eine Tante nach wie vor in Somalia lebten, sodass er zumindest übergangsmäßig mit einer gewissen Unterstützung durch seine Angehörigen im Falle einer Rückkehr nach Somalia rechnen könnte. Hinsichtlich des Vorbringens, dass sich seine Hauterkrankung verschlechtert habe und er nach wie vor an psychischen Problemen leide, hat der Beschwerdeführer keine medizinischen Unterlagen zum Beleg einer etwaigen Verschlechterung seines – bereits im Vorverfahren berücksichtigten Gesundheitszustandes – vorgelegt.
3. Verfahren über den vorliegenden Folgeantrag:
Der Beschwerdeführer stellte am 29.07.2021 einen weiteren, nämlich den hier verfahrensgegenständlichen, Antrag auf internationalen Schutz.
Bei seiner Erstbefragung am selben Tag gab er an, sunnitischer Moslem zu sein und der Volksgruppe der XXXX anzugehören. Er sei zweimal in Deutschland gewesen und habe sich bis 29.07.2021 in Frankreich aufgehalten.
Darauf hingewiesen, dass er in Österreich bereits einen Asylantrag gestellt habe, über den rechtskräftig entschieden worden sei, und befragt, warum er einen (neuerlichen) Antrag auf internationalen Schutz stellte, was sich seit der Rechtskraft konkret gegenüber seinem bereits entschiedenen Verfahren verändert habe, gab der Beschwerdeführer zu Protokoll:
„Meine früheren Fluchtgründe halte ich aufrecht. Außerdem geht es mir psychisch seit einigen Monaten nicht gut. Ich bin mental schwer krank. Da ich keine e-card mithatte, konnte ich nicht zum Arzt gehen, da ich nicht versichert bin.
In Somalia herrscht seit neuestem Dürre und ich habe Angst vor Hunger und Existenz. Ich benötige medizinische Betreuung.“
Bei einer Rückkehr in die Heimat habe er Angst vor Hunger und Nichtbehandlung seiner Erkrankungen sowie Existenzängste. Sein Zustand sowie die Situation in Somalia habe sich in den letzten 2 Monaten stark verschlechtert.
Am 07.09.2021 wurde der Beschwerdeführer vor dem BFA niederschriftlich einvernommen. Hierbei gab er im Wesentlichen folgendes an:
„[…]
LA: Verstehen Sie den Dolmetscher einwandfrei?
VP: Ja.
[…]
LA: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage, an der Einvernahme mitzuwirken?
VP: Ja.
[…]
LA: Befinden Sie sich derzeit in ärztlicher Behandlung, leiden Sie an irgendwelchen schwerwiegenden Krankheiten?
VP: Ich hatte eine chronische Hauterkrankung, die ich immer noch habe. In der letzten Unterkunft habe ich vom Arzt eine Salbe bekommen, die aber nicht wirklich geholfen hat.
LA: Seit wann leiden Sie an dieser Krankheit?
VP: Diese chronische Erkrankung habe ich schon etwa 10 Jahren, diese Probleme hatte ich schon in Somalia. Seitdem ich in Österreich bin, hat sich der Zustand verschlechtert. Dadurch bin ich auch ganz schwach geworden, ich habe Probleme beim Gehen.
LA: Können Sie ärztliche Unterlagen vorlegen?
VP: Nein, ich habe bis jetzt auch keine richtige Untersuchung bekommen. Wenn ich zum Arzt oder ins Krankenhaus gehe, bekomme ich nur Salben.
[…]
LA: Können Sie in der Zwischenzeit Dokumente vorlegen, die Ihre Identität bestätigen?
VP: Nein.
LA: Sie haben am 26.02.2016 und 16.10.2019 Anträge auf internationalen Schutz gestellt, die rechtskräftig ab- bzw. zurückgewiesen wurden.
Warum stellen Sie einen neuerlichen Antrag?
VP: Ich bin jahrelang hier in Österreich und war nie auffällig. Ich bin nie straffällig geworden. Ich lebe hier in Österreich friedlich – ich führe ein friedliches Leben. Außerdem bin ich krank und mein Hautzustand verschlechtert sich fortwährend.
Ich habe hier in Österreich auch keine Familie und möchte auch deswegen einen Asylantrag stellen.
LA: Hat sich bezüglich der Ausreisegründe, die Sie im ersten Verfahren angeführt haben, Probleme mit Al Shabaab, etwas geändert?
VP: Nein, die gibt es immer noch. Außerdem muss auch meine Familie vor Al Shabaab flüchten.
LA: Haben Sie seit der letzten Entscheidung Österreich verlassen?
VP: Ich war in Frankreich.
Befragt gebe ich an, dass ich von März 2021 bis 28. Juli 2021 in Frankreich war.
LA: Haben Sie seit der letzten Entscheidung Europa bzw. das Hoheitsgebiet der Europäischen Union verlassen?
VP: Nein.
LA: Möchten Sie zu den Ihnen am 25.08.2021 ausgefolgten aktuellen Feststellungen zur Lage in Somalia eine Stellungnahme abgeben?
VP: Nein, ich habe das zwar gesehen und gelesen, aber dieses Schriftstück entspricht nicht meiner Lage.
LA: Ihnen wird nun mitgeteilt, dass weiterhin beabsichtigt ist, Ihren Antrag auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache zurückzuweisen.
Möchten Sie dazu Stellung nehmen?
VP: Ich bin nur ein Asylwerber hier in Österreich. Ich möchte hier friedlich leben, mehr brauche ich nicht.
LA: Wollen Sie noch etwas vorbringen, was nicht zur Sprache gekommen ist und Ihnen wichtig erscheint?
VP: Ich hatte Kontakt mit einigen Leuten, die nach Somalia zurückgekehrt sind. Diese haben mir gesagt, dass die Lage in Somalia katastrophal ist. Deswegen kann und will ich auch nicht zurück nach Somalia. Ich möchte gerne hierbleiben.
Außerdem bin ich ein junger Mann. Ich darf hier in Österreich nicht arbeiten, ich habe keine Bildung und auch keine medizinische Versorgung. Ich verstehe das nicht. Ich möchte einen Beitrag hier in Österreich leisten, darf aber weder arbeiten noch eine Ausbildung machen. Ich war nie straffällig, ich verstehe das alles nicht.
[…]“
Mit dem gegenständlich angefochtenen Bescheid des BFA wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 68 Abs. 1 AVG sowohl hinsichtlich des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) als auch hinsichtlich des Status des subsidiär Schutzberechtigten (Spruchpunkt II.) wegen entschiedener Sache zurückgewiesen sowie ein „Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen“ gemäß § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt III.).
Begründend wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer im neuerlichen Asylverfahren nicht glaubwürdig weitere asylrelevante Gründe vorgebracht bzw. sich kein neuer objektiver Sachverhalt ergeben habe und sich die ihn betreffende allgemeine Lage im Herkunftsland seit Rechtskraft des Vorverfahrens (07.07.2020) nicht geändert habe. Betreffend seine Hautprobleme sei nicht ersichtlich, dass diese lebensbedrohliche wären. In diesem Fall hätte der Arzt dementsprechend reagiert bzw. reagieren müssen und den Beschwerdeführer nicht in häusliche Pflege entlassen; der Beschwerdeführer habe aber bloß eine Salbe erhalten. Auch sei dies bereits im Vorverfahren berücksichtigt worden. Es lägen im Vergleich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Erkenntnisses vom 10.07.2019 keine neuen Umstände vor, die relevant seien, weshalb die Rechtskraft dieser früheren Entscheidung einer neuerlichen inhaltlichen Prüfung des Folgeantrags entgegenstehe, sodass dieser zurückzuweisen sei.
Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde und begründete diese zusammengefasst damit, dass ihm eine Rückkehr nach Somalia aus mehreren Gründen nicht möglich sei. Einerseits sei die derzeitige Sicherheitslage sehr schlecht und sein Onkel vor kurzem bei einer Explosion in Somalia ums Leben gekommen. Als der Beschwerdeführer dies erfahren habe, sei er derart geschockt gewesen, dass er einen Zusammenbruch gehabt und ärztlich Behandlung benötigt habe. Außerdem sei seine Familie vor Al-Shabaab geflohen und befürchte er Diskriminierungen aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einem Minderheitenclan. Ferner müsse er sich bei einer Rückkehr entweder für die Seite der Regierung oder der Al-Shabaab entscheiden, er wolle sich jedoch für keine davon entscheiden und fürchte um sein Leben, egal welche er wähle. Außerdem würde der Beschwerdeführer aufgrund seiner fast 7-jährigen Abwesenheit von seinen Nachbarn und Freunden nicht mehr als zu ihnen gehörig angesehen, eventuell sogar als Verräter wahrgenommen werden. Die Behörde habe den Beschwerdeführer in der Einvernahme nicht näher zu seinem Vorbringen, wonach seine Familie vor Al-Shabaab geflohen sei, befragt und nicht ausreichend betreffend eine Unterstützungsmöglichkeit durch seine Familie ermittelt. Des Weiteren fürchte der Beschwerdeführer aufgrund der derzeitigen Versorgungslage in Somalia in eine ausweglose Situation zu geraten.
Mit hg. Beschluss vom 18.10.2021 wurde der vorliegenden Beschwerde gemäß § 17 BFA-VG die aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Mit Parteiengehör vom 28.03.2022 wurde dem Beschwerdeführer das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Somalia vom 21.10.2021 übermittelt und ermöglicht dazu innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung dieses Schreibens eine schriftliche Stellungnahme einzubringen. Weiters wurde ihm binnen obiger Frist die Gelegenheit eingeräumt, allfällige Änderungen in seiner persönlichen Situation vorzubringen, die sich seit Beschwerdeeinbringung ergeben haben sowie allfällige damit im Zusammenhang stehende Beweismittel vorzulegen.
In dem daraufhin eingebrachten Schriftsatz vom 11.04.2022 wurde zusammengefasst ausgeführt, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Somalia aufgrund der derzeitigen Sicherheitslage eine Lebensgefahr befürchte. Er wolle nochmals darauf hinweisen, dass er sich seit ca. 7 Jahren in Österreich aufhalte, Deutsch spreche und gerne einen Deutschkurs bzw. –prüfung absolvieren wolle, dies jedoch aufgrund des Verfahrensstandes nicht könne. Er sei regelmäßig als Dolmetscher in seiner Flüchtlingsunterkunft tätig. Aufgrund seiner Situation sei er psychisch sehr angeschlagen. Er leide immer noch an einer in Österreich nicht ausreichend behandelten Hauterkrankung, gegen die er in Deutschland bessere medizinische Behandlung in Form von Medikamenten erhalten habe. Ihm sei nicht ermöglich worden, diese von einem Hautarzt in Österreich untersuchen zu lassen, was für ihn unverständlich sei.
II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:
1. Feststellungen:
Der Beschwerdeführer ist somalischer Staatsangehöriger, sunnitischer Moslem und gehört dem Clan Hawiye, dessen Sub-Clan Gugundhabe, dessen Sub-Sub-Clan XXXX , dessen Sub-Sub-Sub-Clan XXXX , dessen Sub-Sub-Sub-Sub-Clan XXXX und dessen Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Clan XXXX an. Er wurde in XXXX geboren und hat dort mehrere Jahre lang die Schule besucht. In Somalia war er als Lehrer für das Fach Englisch tätig. Vor seiner Ausreise hielt er sich in Mogadischu auf.
Der erste Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 26.02.2016 wurde inhaltlich mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 23.11.2018 abgewiesen sowie eine Rückkehrentscheidung samt Nebenaussprüchen erlassen. Die dagegen erhobene Beschwerde wurde mit hg. Erkenntnis vom 10.07.2019, zugestellt am selben Tag, als unbegründet abgewiesen, im Wesentlichen weil die behauptete Verfolgungs- oder Bedrohungslage nicht glaubhaft war und nicht angenommen werden konnte, dass dem Beschwerdeführer, der eine mehrjährige Schulbildung genoss, über Englischkenntnisse zumindest auf gutem Konversationsniveau verfügte, vor seiner Ausreise ehrenamtlich als Lehrer arbeitete und schon damals durch seine Familienangehörigen versorgt wurde, im Falle einer Rückkehr in seine Heimatstadt XXXX die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre. Seine Kernfamilie war in XXXX und weitere Verwandte im Umland dieser Stadt aufhältig, sodass er von diesen – vor allem anfangs – notfalls die notwendige Unterstützung erhalten konnte. Der Beschwerdeführer war im Wesentlichen arbeitsfähig und in der Lage, sich seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Auch konnte davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer seitens seines leistungsfähigen Hauptclans Unterstützungsleistungen erfahren würde. Im Übrigen ließ auch die Versorgung von XXXX mit Lebensmitteln nicht erwarten, dass der Beschwerdeführer dort wegen Nahrungsmittelknappheit in eine aussichtslose Lage geraten könnte. Auch die Sicherheitslage in der Heimatstadt des Beschwerdeführers stellte sich als ausreichend stabil dar und war hinreichend sicher erreichbar. Es war nicht erkennbar, dass dem Beschwerdeführer, der in keiner ärztlichen Behandlung stand und nur hin und wieder Medikamente wegen psychischer Leiden nahm, dringend benötigte ärztliche Versorgung oder Medikamente im Herkunftsstaat nicht zugänglich wären oder sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers in einer die Schwelle des Art. 3 EMRK erreichenden Intensität verschlechtern würde, selbst wenn ihm diese Medikamente im Herkunftsstaat nur eingeschränkt zugänglich sein sollten. Zur Lage in Somalia wurde unter anderem festgestellt, dass nach den überdurchschnittlichen Gu-Regenfällen 2018 die Getreideernte die größten Erträge seit 2010 einbringen werde und sich die Lage bei der Nahrungsversorgung weiter verbesserte. Für die Deyr-Regenzeit 2018 (Oktober-Dezember) war auch eine überdurchschnittliche Niederschlagsmenge prognostiziert, womit auch eine weitere Verbesserung bei den Weideflächen und bei der Wasserverfügbarkeit und i.d.F. Verbesserungen bei der Viehzucht und in der Landwirtschaft einhergehen werde.
Nach einem weiteren Verfahren zu einem Folgeantrag stellte der Beschwerdeführer am 29.07.2021 den verfahrensgegenständlichen Folgeantrag auf internationalen Schutz, welchen er insbesondere damit begründete, dass sich sein Gesundheitszustand sowie die Lage in Somalia verschlechtert habe und seine Familie vor Al-Shabaab geflohen sei.
Es ist seit dem Vergleichserkenntnis keine entscheidungswesentliche Änderung hinsichtlich der Fluchtgründe des Beschwerdeführers eingetreten.
Es ist aber seither zu einer Änderung der Versorgungslage in Somalia gekommen, die eine andere rechtliche Beurteilung nicht von vornherein ausschließt.
Zur Situation im Herkunftsstaat wird Folgendes festgestellt:
Länderinformation der Staatendokumentation Somalia Version 3 vom 21.10.2021:
COVID-19
Letzte Änderung: 20.10.2021
Im ersten Quartal 2021 entwickelte sich eine neue Welle. Im Zeitraum 16.3.-7.5.2021 wurden 11.504 Infektionen bestätigt, 537 Personen starben an oder mit Covid-19 (UNSC 19.5.2021, Abs. 61). Mit Stand 27.6.2021 waren in Somalia 7.235 aktive Fälle registriert, insgesamt 775 Personen waren verstorben (ACDC 27.6.2021). Insgesamt gibt es laut offiziellen Angaben Ende August 2021 knapp 1.000 Todesopfer bei nur rund 18.000 bestätigten Infektionen. Seit Beginn der Pandemie waren bis dahin nur rund 284.000 Tests durchgeführt worden (WB 6.2021, S. 26).
Mitte März 2021 trafen die ersten Impfstoffe in Somalia ein. Mit Stand 29.4.2021 waren 121.700 Personen immunisiert (UNSC 19.5.2021, Abs. 61). Bis Mitte August 2021 wurden an Somalia zwei Arten von Covid-19-Impfstoff gespendet: mehr als 400.000 Impfdosen von Oxford/AstraZeneca und 200.000 von Sinopharm. Das allein würde nur ausreichen, um 3 % der Bevölkerung zu impfen (AI 18.8.2021, S. 18). Allerdings zögern viele Menschen, sich impfen zu lassen (AI 18.8.2021, S. 18; vgl. WB 6.2021, S. 20). Viele der gespendeten Oxford/AstraZeneca-Dosen sind bereits abgelaufen und können nicht mehr verwendet werden (AI 18.8.2021, S. 18). Mitte August 2021 empfing Somalia offenbar weitere ca. 410.000 durch die COVAX-Initiative gespendete Covid-19-Impfdosen (BAMF 16.8.2021).
Nach Angabe des somalischen Gesundheitsministeriums waren bis Ende Juli 2021 1,8 % der Menschen voll immunisiert (UNOCHA 7.2021). Nach anderen Angaben waren am 14.10.2021 insgesamt 477.075 Impfdosen verabreicht worden und zu diesem Zeitpunkt 1,5 % der Bevölkerung voll immunisiert (PTC 14.10.2021). Laut Schätzungen werden bis Ende des Jahres 2021 rund 500.000 Menschen voll immunisiert sein, bis Ende 2022 weitere 700.000. Jedenfalls ist die Bevölkerung dadurch möglichen neuen - und gefährlicheren - COVID-19-Varianten ungeschützt ausgesetzt, und die Krankheit droht im Land endemisch zu werden (WB 6.2021).
Im August 2020 wurde der internationale Flugverkehr wieder aufgenommen (PGN 10.2020, S. 9).
Regeln zum social distancing oder auch Präventionsmaßnahmen wurden kaum berücksichtigt (HIPS 2021, S. 24). Trotz Warnungen wurden Moscheen durchgehend – ohne Besucherbeschränkung – offengehalten (DEVEX 13.8.2020). Mitte Feber 2021 warnte die Gesundheitsministerin vor einer Rückkehr der Pandemie. Die Zahl an Neuinfektionen und Toten stieg an (Sahan 16.2.2021b). Ende Feber 2021 wurden alle Demonstrationen in Mogadischu verboten, da eine neue Welle von Covid-19 eingetreten war. Zwischen 1. und 24. Feber verzeichnete Somalia mehr als ein Drittel aller Covid-19-Todesopfer der gesamten Pandemie (PGN 2.2021, S. 16).
Der Umgang der somalischen Regierung mit der Covid-19-Pandemie war und ist völlig inadäquat. Die tatsächliche Zahl an Covid-19-Fällen und -Toten ist vermutlich höher als die offiziellen Zahlen darstellen (AI 18.8.2021, S. 5; vgl. UNFPA 12.2020, S. 1). Dies liegt u.a. an den wenig verfügbaren bzw. erreichbaren Testmöglichkeiten, am Stigma, an wenig Vertrauen in Gesundheitseinrichtungen sowie teilweise an der Leugnung von COVID-19 (UC 13.6.2021, S. 9; vgl. UNFPA 12.2020, S. 1). Testungen sind v.a. auf Städte beschränkt (UC 13.6.2021, S. 2) und generell so gut wie inexistent. Die offiziellen Todeszahlen sind niedrig, das wahre Ausmaß wird aber wohl nie wirklich bekannt werden (STC 4.2.2021). Es sind nur jene Fälle registriert worden, wo es Erkrankte überhaupt bis zu einer Gesundheitseinrichtung geschafft haben und dort dann auch tatsächlich getestet wurden. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs – viele mehr sind zu Hause gestorben (AI 18.8.2021, S. 14). Auch, dass es in Spitälern kaum Kapazitäten für Covid-19-Patienten gibt, ist ein Grund dafür, warum viele sich gar nicht erst testen lassen wollen – ein Test birgt für die Menschen keinen Vorteil (DEVEX 13.8.2020).
Die informellen Zahlen zur Verbreitung von Covid-19 in Somalia und Somaliland sind also um ein Vielfaches höher als die offiziellen. Einerseits sind die Regierungen nicht in der Lage, breitflächig Tests (es gibt insgesamt nur 14 Labore) oder gar ein Contact-Tracing durchzuführen. Gleichzeitig behindern Stigma und Desinformation die Bekämpfung von Covid-19 in Somalia und Somaliland. Mit dem Virus geht eine Stigmatisierung jener einher, die infiziert sind, als infiziert gelten oder aber infiziert waren. Mancherorts werden selbst Menschen, die Masken tragen, als infiziert gebrandmarkt. Die Angst vor einer Stigmatisierung und die damit verbundene Angst vor ökonomischen Folgen sind der Hauptgrund, warum so wenige Menschen getestet werden. Es wird berichtet, dass z.B. Menschen bei (vormals) Infizierten nicht mehr einkaufen würden. IDPs werden vielerorts von der Gastgemeinde gemieden – aus Angst vor Ansteckung. Dies hat auch zum Verlust von Arbeitsplätzen – z. B. als Haushaltshilfen – geführt. Dabei fällt es gerade auch IDPs schwer, Präventionsmaßnahmen umzusetzen. Sie leben oft in Armut und in dicht bevölkerten Lagern, und es mangelt an Wasser (DEVEX 13.8.2020).
Somalia ist eines jener Länder, dass hinsichtlich des Umgangs mit der Pandemie die geringsten Kapazitäten aufweist (UNFPA 12.2020, S. 1). Humanitäre Partner haben schon im April 2020 für einen Plan zur Eindämmung von Covid-19 insgesamt 256 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt (UNSC 13.11.2020, Abs. 51). UNSOS unterstützt medizinische Einrichtungen, stellt Ausrüstung zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung. Bis Anfang Juni konnten die UN und AMISOM eine substanzielle Zahl an Behandlungsplätzen schaffen (darunter auch Betten zur Intensivpflege) (UNSC 13.8.2020, Abs. 69). Trotzdem gibt es nur ein speziell für Covid-19-Patienten zugewiesenes Spital, das Martini Hospital in Mogadischu. Dieses ist unterbesetzt und schlecht ausgerüstet; von 150 Betten verfügen nur 11 über ein Beatmungsgerät und Sauerstoffversorgung (Sahan 25.2.2021c). In ganz Somalia und Somaliland gab es im August 2020 für Covid-Patienten nur 24 Intensivbetten (DEVEX 13.8.2020). Viele Covid-19-Patienten sind in Spitälern aus Mangel an Sauerstoffversorgung oder wegen eines Stromausfalls gestorben (AI 18.8.2021, S. 13f). Es gibt so gut wie keine präventiven Maßnahmen und Einrichtungen. Menschen, die an Covid-19 erkranken, bleibt der Ausweg in ein Privatspital – wenn sie sich das leisten können (Sahan 25.2.2021c). Die Situation war derart ernst, dass sich Akteure aus dem privaten Sektor engagiert und zusätzliche Covid-19-Kapazitäten geschaffen haben (AI 18.8.2021, S. 14). Der türkische Rote Halbmond hat Somalia im Feber 2021 weitere zehn Beatmungsgeräte zukommen lassen (AAG 26.2.2021). Im März 2021 spendete die Dahabshil Group dem Staat Sauerstoffverdichter, mit denen insgesamt 250 Patienten versorgt werden können. Die Firma übernimmt auch die technische Instandhaltung (Sahan 11.3.2021). Ende September 2021 wurde in Mogadischu die erste öffentliche Anlage zur Produktion von medizinischem Sauerstoff eröffnet. Diese wurde von der Hormuud Salaam Stiftung angekauft und gespendet. Der Sauerstoff wird an öffentlichen Spitälern in Mogadischu kostenlos zur Verfügung gestellt (Reuters 30.9.2021).
Nachdem die Bildungsinstitutionen ihre Arbeit wieder aufgenommen hatten, sind nicht alle Kinder zurück in die Schule gekommen. Dies liegt an finanziellen Hürden, an der Angst vor einer Infektion, aber auch daran, dass Kinder zur Arbeit eingesetzt werden. Außerdem zeigt eine Studie aus Puntland, dass die Zahl an Frühehen zugenommen hat. Gleichzeitig wurden Immunisierungskampagnen und auch Ernährungsprogramme unterbrochen. Manche Gesundheitseinrichtungen sind teilweise nur eingeschränkt aktiv – nicht zuletzt, weil viele Menschen diese aufgrund von Ängsten nicht in Anspruch nehmen; der Patientenzustrom hat sich in der Pandemie verringert (UNFPA 12.2020, V-VI).
Nach Angaben von Quellen sind Remissen im Zuge der Covid-19-Pandemie zurückgegangen (IPC 3.2021, S. 2; vgl. UNFPA 12.2020). Eine Erhebung im November und Dezember 2020 hat gezeigt, dass 22% der städtischen, 12% der ländlichen und 6% der IDP-Haushalte Remissen beziehen. Die Mehrheit der Empfänger berichtete von Rückgängen von über 10% (IPC 3.2021, S. 2). Nach anderen Angaben erwies sich der Remissenfluss als resilient. Demnach haben sich die Überweisungen von 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 2,8 Milliarden im Jahr 2020 erhöht. Die Überweisungen an Privathaushalte erhöhten sich von 1,3 auf 1,6 Milliarden (WB 6.2021, S. 11f).
Der Export von Vieh – der wichtigste Wirtschaftszweig – ist wegen der Pandemie zurückgegangen (UNFPA 12.2020, S. 1). 45 % der Kleinstunternehmen mussten schließen (UNSC 10.8.2021, Abs. 17). Die Arbeitslosigkeit - und damit auch die Armut - haben sich verstärkt. Schätzungen zufolge mussten beim Ausbruch von COVID-19 21 % der Somali ihre Arbeit niederlegen; und das, obwohl nur 55 % der Bevölkerung überhaupt am Arbeitsmarkt teilnimmt. 78 % der Haushalte berichteten über einen Rückgang des Einkommens (WB 6.2021, S. 23).
Internationale und nationale Flüge operieren uneingeschränkt. Ankommende müssen am Aden Adde International Airport in Mogadischu und auch am Egal International Airport in Hargeysa einen negativen Covid-19-Test vorweisen, der nicht älter als drei Tage ist. Wie in Mogadischu mit Personen umgegangen wird, welche diese Vorgabe nicht erfüllen, ist unbekannt. In Hargeysa werden Personen ohne Test auf eigene Kosten in eine von der Regierung benannte Unterkunft zur zweiwöchigen Selbstisolation geschickt. Die Landverbindungen zwischen Dschibuti und Somaliland wurden wieder geöffnet, der Hafen in Berbera ist in Betrieb (GW 11.6.2021).
Restaurants, Hotels, Bars und Geschäfte sind offen, es gelten Hygienemaßnahmen und solche zum Social Distancing. Die Maßnahmen außerhalb Mogadischus können variieren. Es kann jederzeit geschehen, dass Behörden Covid-Maßnahmen kurzfristig verschärfen (GW 11.6.2021).
Quellen:
AAG - Anadolu Agency [Türkei] (26.2.2021): Turkish Red Crescent donates 10 ventilators to Somalia, https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-red-crescent-donates-10-ventilators-to-somalia/2158421 , Zugriff 1.3.2021
ACDC - African Union Center for Disease Control and Prevention (27.6.2021): Africa CDC Dashbord Covid-19, https://africacdc.org/covid-19/ , Zugriff 1.7.2021
AI - Amnesty International (18.8.2021): "We just watched COVID-19 patients die": COVID-19 exposed Somalia's weak healthcare system but debt relief can transform it [AFR 52/4602/2021], https://www.ecoi.net/en/file/local/2058478/AFR5246022021ENGLISH.pdf , Zugriff 27.8.2021
BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (16.8.2021): Briefing Notes, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw33-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=4 , Zugriff 27.8.2021
DEVEX / Sara Jerving (13.8.2020): Stigma and weak systems hamper the Somali COVID-19 response, https://www.devex.com/news/stigma-and-weak-systems-hamper-the-somali-covid-19-response-97895 , Zugriff 12.10.2020
GW - GardaWorld (11.6.2021): Somalia: Somalia: Authorities maintaining COVID-19 restrictions largely unchanged as of June 11 /update 13, https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/489466/somalia-authorities-maintaining-covid-19-restrictions-largely-unchanged-as-of-june-11-update-13 , Zugriff 1.7.2021
HIPS - The Heritage Institute for Policy Studies (2021): State of Somalia Report 2020, Year in Review, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SOS-REPORT-2020-Final-2.pdf , Zugriff 12.2.2021
IPC - Integrated Food Security Phase (3.2021): Somalia – IPC Acute Food Insecurity and Acute Malnutrition Analysis January-June 2021, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-ipc-acute-food-insecurity-and-acute-malnutrition-analysis-january-june , Zugriff 9.3.2021
PGN - Political Geography Now (2.2021): Somalia Control Map & Timeline - February 2021, per e-Mail, mit Zugriffsberechtigung verfügbar auf: https://www.polgeonow.com/2021/02/somalia-control-map-2021.html
PGN - Political Geography Now (10.2020): Somalia Control Map & Timeline - October 2020, per e-Mail, mit Zugriffsberechtigung verfügbar auf: https://www.polgeonow.com/2020/10/somalia-map-of-al-shabaab-control.html
PTC - Pharmaceutical Technology.com (14.10.2021): Covid-19 Vaccination Tracker, Latest news, statistics, daily rates and updates, https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/ , Zugriff 15.10.2021
RE - Radio Ergo (25.2.2021): No masks, gloves or oxygen in Mogadishu hospital, says grieving husband who lost pregnant wife to COVID19, https://radioergo.org/en/2021/02/25/no-masks-gloves-or-oxygen-in-mogadishu-hospital-says-grieving-husband-who-lost-pregnant-wife-to-covid19/ , Zugriff 10.3.2021
Reuters (30.9.2021): Somalia opens first public oxygen plant to help treat COVID-19 amid severe shortage, https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/somalia-opens-first-public-oxygen-plant-help-treat-covid-19-amid-severe-shortage-2021-09-30/ , Zugriff 11.10.2021
Sahan - Sahan / Mogadishu Times (11.3.2021): The Somali Wire Issue No. 100, per e-Mail, Originallink auf Somali: http://mogtimes.com/articles/41259/Sawirro-Dahabshiil-Group-oo-ka-jawaabtay-baaqii-DF-kuna-wareejisay-Oxygen
Sahan - Sahan / Somali Wire Team (25.2.2021c): Editor’s Pick – COVID-19 has not been prevented, it is used as a political weapon, in: The Somali Wire Issue No. 87, per e-Mail
Sahan - Sahan / Hiiraan Online (16.2.2021b): The Somali Wire Issue No. 83, per e-Mail, Originallink auf Somali: https://www.hiiraan.com/news/2021/Feb/wararka_maanta15-176705.htm
STC - Safe the Children (4.2.2021): 840,000 children going hungry as Somalia declares state of emergency over locust invasion, https://www.savethechildren.net/news/840000-children-going-hungry-somalia-declares-state-emergency-over-locust-invasion , Zugriff 3.3.2021
UC - University of Cambridge (13.6.2021): Lockdowns, lives and livelihoods: the impact of COVID-19 and public health responses to conflict affected populations - a remote qualitative study in Baidoa and Mogadishu, Somalia, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/s13031-021-00382-5.pdf , Zugriff 30.6.2021
UNFPA - UN Population Fund (12.2020): COVID-19 Socio-Economic Impact Assessment for Puntland, https://somalia.unfpa.org/en/publications/covid-19-socio-economic-impact-assessment-puntland , Zugriff 11.3.2021
UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (7.2021): Somalia Humanitarian Bulletin, July 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2058109/Somalia_+Humanitarian+Bulletin_July+2021_Final.pdf , Zugriff 27.8.2021
UNSC - UN Security Council (10.8.2021): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2021/723], https://www.ecoi.net/en/file/local/2058501/S_2021_723_E.pdf , Zugriff 27.8.2021
UNSC - UN Security Council (19.5.2021): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2021/485], https://www.ecoi.net/en/file/local/2052226/S_2021_485_E.pdf , Zugriff 21.6.2021
UNSC - UN Security Council (13.11.2020): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2020/1113], https://www.ecoi.net/en/file/local/2041334/S_2020_1113_E.pdf , Zugriff 2.12.2020
UNSC - UN Security Council (13.8.2020): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2020/798], https://www.ecoi.net/en/file/local/2036555/S_2020_798_E.pdf , Zugriff 9.10.2020
WB - Weltbank (6.2021): Somalia Economic Update. Investing in Health to Anchor Growth, http://documents1.worldbank.org/curated/en/926051631552941734/pdf/Somalia-Economic-Update-Investing-in-Health-to-Anchor-Growth.pdf , Zugriff 15.9.2021
Binnenflüchtlinge (IDPs) und Flüchtlinge
Süd-/Zentralsomalia, Puntland
Letzte Änderung: 21.10.2021
Die somalische Regierung arbeitet mit dem UNHCR und IOM zusammen, um Flüchtlinge, zurückkehrende Flüchtlinge, Asylwerber, Staatenlose und andere relevante Personengruppen zu unterstützen. Der UNHCR setzt sich für den Schutz von IDPs ein und gewährt etwas an finanzieller Unterstützung (USDOS 30.3.2021, S. 21f).
IDP-Zahlen: Schon vor dem Jahr 2016 gab es – v.a. in Süd-/Zentralsomalia – mehr als 1,1 Millionen IDPs. Viele davon waren im Zuge der Hungersnot 2011 geflüchtet und danach nicht mehr in ihre Heimat zurückgekehrt. Weitere 1,6 Millionen sind ab 2016 hinzugekommen, auch sie sind in erster Linie wegen der Dürre geflohen (OXFAM 6.2018, S. 5). Die Gesamtzahl an IDPs belief sich 2020 auf rund 2,7 Millionen Menschen, die Zahl an im Jahr 2020 neu Vertriebenen betrug mehr als 893.000 Personen. Die meisten davon waren wegen Überflutungen vertrieben worden (716.000) (USDOS 30.3.2021, S. 21; vgl. IPC 3.2021, S. 3). Im Zeitraum Juli-Dezember 2020 betrug der Anteil jener, die wegen eines Mangels an Lebensgrundlage oder wegen Unsicherheit und Konflikt vertrieben wurden, jeweils 14 % (IPC 3.2021, S. 3). Im ersten Halbjahr 2021 sind 359.000 Menschen durch Unsicherheit vertrieben worden (Vergleichszeitraum 2020: 134.000); durch Dürre 68.000 (45.000); durch Überflutungen 56.500 (453.200) (UNHCR 14.7.2021). Von Überflutungen waren v.a. Jowhar und Belet Weyne betroffen. 207.000 der im Jahr 2021 durch Unsicherheit Vertriebenen flohen temporär aus und innerhalb von Mogadischu, als es dort im April 2021 zu Zusammenstößen in Zusammenhang mit den Wahlen gekommen war (UNSC 10.8.2021, Abs. 51ff). Rund 1,7 der 2,7 Millionen IDPs sind Kinder (USDOS 30.3.2021, S. 34).
Es gibt ca. 2.300 IDP-Lager und -Siedlungen (UNSC 13.11.2020, Abs. 52), nach anderen Angaben sogar knapp 3.000 (UNOCHA 1.2021, S. 4). Alleine aus Baidoa werden 483 IDP-Ansiedlungen berichtet (UNOCHA 31.3.2020, S. 3). Die Migration vom Land in die Stadt hat zu einem ernormen und unregulierten Städtewachstum geführt. Hinsichtlich der IDP-Zahlen müssen zwei Faktoren berücksichtigt werden: Einerseits gibt es für Somalia keine Zahlen zur "normalen" Urbanisierung. Andererseits werden in der Regel nur jene IDPs gezählt, die in Lagern wohnen. Mitglieder großer Clans kommen aber üblicherweise bei Verwandten unter und leben daher nicht in Lagern (ACCORD 31.5.2021, S. 16/26f).
Zwangsräumungen, die IDPs und die arme Stadtbevölkerung betrafen, bleiben ein großes Problem. Im Jahr 2020 waren davon 150.000 Menschen betroffen, zwei Drittel davon im Großraum Mogadischu und außerdem v.a. auch in Baidoa und Kismayo (AA 18.4.2021, S. 21). Bewohner von Lagern leben daher in ständiger Ungewissheit, da sie immer eine Zwangsräumung befürchten müssen (FIS 7.8.2020, S. 37). Die Mehrheit der IDPs zog in der Folge in entlegene und unsichere Außenbezirke der Städte, wo es lediglich eine rudimentäre bzw. gar keine soziale Grundversorgung gibt (AA 18.4.2021, S. 21).
Organisationen wie IOM versuchen, durch eine Umsiedlung von IDPs auf vorbereitete Grundstücke einer Zwangsräumung zuvorzukommen. So wurden z.B. in Baidoa 2019 1.000 IDP-Haushalte aus 15 Lagern auf mit der Stadtverwaltung abgestimmte Grundstücke umgesiedelt (IOM 25.6.2019; vgl. RD 27.6.2019). Dort wurden zuvor Latrinen, Wasserversorgung, Straßenbeleuchtung und andere Infrastruktur installiert. Auch zwei Polizeistationen wurden gebaut. Den IDPs wurden außerdem Gutscheine für Baumaterial zur Verfügung gestellt (IOM 25.6.2019. Auch die UN versuchen, Land für IDPs zu pachten (UNSC 13.11.2020, Abs. 52). Generell befinden sich derartige Relocation Areas am Stadtrand oder sogar weit außerhalb der jeweiligen Stadt. Allerdings bieten diese Lager wesentlich bessere Unterkünfte - etwa Häuser aus Wellblech oder sogar Stein (ACCORD 31.5.2021, S. 21).
Rechtliche Lage: Ende 2019 hat die Bundesregierung die Konvention der Afrikanischen Union zum Schutz von IDPs ratifiziert. Die Regionalverwaltung von Benadir (BAR) hat ein Büro für nachhaltige Lösungen für IDPs geschaffen. Auch eine nationale IDP-Policy wurde angenommen. Im Jänner 2020 präsentierte die BAR eine Strategie für nachhaltige Lösungen (UNOCHA 6.2.2020, S. 4; vgl. RI 12.2019, S. 11f). Auch auf Bundesebene wurde ein Rahmen für nachhaltige Lösungen geschaffen (USDOS 30.3.2021, S. 22). Diesbezüglich wurden nationale Richtlinien zur Räumung von IDP-Lagern erlassen. Insgesamt sind dies wichtige Schritte, um die Rechte von IDPs zu schützen und nachhaltige Lösungen zu ermöglichen (RI 12.2019, S. 4).
Menschenrechte: IDPs sind andauernden schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, ihre besondere Schutzlosigkeit und Hilfsbedürftigkeit werden von allerlei nichtstaatlichen – aber auch staatlichen – Stellen ausgenutzt und missbraucht. Schläge, Vergewaltigungen, Abzweigung von Nahrungsmittelhilfen, Bewegungseinschränkung und Diskriminierung aufgrund von Clanzugehörigkeit sind an der Tagesordnung (AA 18.4.2021, S. 21); es kommt auch zu Vertreibungen und sexueller Gewalt (HRW 14.1.2020). Dies trifft in erster Linie Bewohner von IDP-Lagern – in Mogadischu v.a. jene IDPs, die nicht über Clanbeziehungen in der Stadt verfügen (FIS 7.8.2020, S. 36). Weibliche und minderjährige IDPs sind hinsichtlich einer Vergewaltigung besonders gefährdet (USDOS 30.3.2021, S. 22; vgl. HRW 14.1.2020; AA 18.4.2021, S. 15). Zu den Tätern gehören bewaffnete Männer und Zivilisten (HRW 14.1.2020). Für IDPs in Lagern gibt es keinen Rechtsschutz, und es gibt in Lagern auch keine Polizisten, die man im Notfall alarmieren könnte (FIS 7.8.2020, S. 36).
Versorgung: In Mogadischu sind die Bedingungen für IDPs in Lagern hart. Oft fehlt es dort an simplen Notwendigkeiten, wie etwa Toiletten (FIS 7.8.2020, S. 36). Landesweit fehlen in 80 % der IDP-Lager Wasserstellen – v.a. in Benadir, dem SWS und Jubaland (UNOCHA 1.2021, S. 5). Die Rate an Unterernährung ist hoch, der Zugang zu grundlegenden Diensten eingeschränkt (RI 12.2019, S. 9). Es mangelt ihnen zumeist an Zugang zu genügend Lebensmitteln und akzeptablen Unterkünften (ÖB 3.2020, S. 12). Allerdings ist der Zustand von IDP-Lagern unterschiedlich. Während die neueren meist absolut rudimentär sind, verfügen ältere Lager üblicherweise über grundlegende Sanitär-, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen (FIS 7.8.2020. S. 36). Oft wurde dort auch eine Nachbarschaftshilfe aufgebaut (ACCORD 31.5.2021, S. 23). Trotzdem werden noch weniger Kinder von IDPs eingeschult, als es schon bei anderen Kindern der Fall ist (USDOS 30.3.2021, S. 33f).
Unterstützung: Die EU unterstützte über das Programm RE-INTEG Rückkehrer, IDPs und Aufnahmegemeinden. Dafür wurden 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt [siehe dazu Kapitel Rückkehrspezifische Grundversorgung] (EC o.D.). Damit wurde unter anderem für 7.000 Familien aus 54 IDP-Lagern in Baidoa Land beschafft, welches diesen permanent als Eigentum erhalten bleibt, und auf welchem sie siedeln können. Insgesamt hat die EU mit ähnlichen Programmen bisher 60.000 Menschen helfen können (EC 13.7.2019). Die Weltbank stellt für fünf Jahre insgesamt 112 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Mit diesem Geld soll die städtische Infrastruktur verbessert werden, wovon sowohl autochthone Stadtbewohner als auch IDPs profitieren sollen (RI 12.2019, S. 18f). Andere Programme für nachhaltige Lösungen werden von UN-HABITAT, dem Norwegian Refugee Council und der EU finanziert oder geführt (RI 12.2019, S. 9). UNSOM hat mit der somalischen Regierung ein Drei-Jahres-Programm begonnen, das ausschließlich auf IDPs abzielt. Mit diesem Programm namens Saameynta sollen für IDPs in Baidoa, Bossaso und Belet Weyne dauerhafte Lösungen gefunden und geschaffen werden. 100.000 IDPs sollen ordentlich angesiedelt und mit sozialen Diensten und Arbeitsmöglichkeiten versehen werden (UNSOM 31.1.2021). Im März 2021 konnte IOM knapp 7.000 IDPs aus Baidoa in das IDP-Lager Barwaaqo übersiedeln, wo schon 2019 mehr als 6.000 IDPs angesiedelt worden waren. Das Land für dieses Lager wurde von der Lokalverwaltung zur Verfügung gestellt. In Barwaaqo bekommen Familien ein Stück Land, auf dem eine Unterkunft errichtet und ein Garten betrieben werden kann. Die Familien erhalten zudem finanzielle Unterstützung. Zwei Jahre nach der Umsiedlung erhalten die Familien dann auch Rechtsanspruch auf den von ihnen genutzten Grund (IOM 9.3.2021a).
Die Situation von IDPs in Puntland wird von NGOs als durchaus positiv beschrieben, sie können z. B. geregelter Tätigkeit nachgehen (ÖB 3.2020, S. 12). Es gibt Anzeichen dafür, dass in Puntland aufhältige IDPs aus anderen Teilen Somalias dort permanent bleiben können und dieselben Rechte genießen, wie die ursprünglichen Einwohner (LIFOS 9.4.2019, S. 9).
Flüchtlinge: Somalia ist ein äußerst unattraktives Zufluchtsland für Asylsuchende. Die Zahl ausländischer Flüchtlinge wird als sehr gering eingeschätzt und beschränkte sich in der Vergangenheit im Wesentlichen auf ethnische Somali aus dem äthiopischen Somali Regional State. Die Zahl an Asylsuchenden aus dem Jemen und aus Syrien hat zugenommen. Auch aus dem äthiopischen Tigray kommen Flüchtlinge. Insgesamt handelt es sich um etwa 24.000 Menschen, sie halten sich v.a. in Somaliland und Puntland auf (AA 18.4.2021, S. 21). Asylwerbern aus dem Jemen wird prima facie der Asylstatus zuerkannt (USDOS 30.3.2021, S. 22). Der UNHCR betreibt ein Unterstützungs- und Integrationsprogramm zur möglichst schnellen Eingliederung von Flüchtlingen in das öffentliche Leben (AA 18.4.2021, S. 21).
Quellen:
AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (18.4.2021): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2050118/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-_und_abschieberelevante_Lage_in_der_Bundesrepublik_Somalia_%28Stand_Januar_2021%29%2C_18.04.2021.pdf , Zugriff 23.4.2021
ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation / Höhne, Markus / Bakonyi, Jutta (31.5.2021): Somalia - Al-Schabaab und Sicherheitslage; Lage von Binnenvertriebenen und Rückkehrer·innen [sic]; Schutz durch staatliche und nicht-staatliche Akteure; Dokumentation zum COI-Webinar mit Markus Höhne und Jutta Bakonyi am 5. Mai 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2052555/20210531_COI-Webinar+Somalia_ACCORD_Mai+2021.pdf , Zugriff 28.6.2021
EC - European Commission (13.7.2019): 7,000 Displaced Families in Baidoa Have A New Home, https://reliefweb.int/report/somalia/7000-displaced-families-baidoa-have-new-home , Zugriff 29.1.2021
EC - European Commission (o.D.): EU Emergency Trust Fund for Africa – RE-INTEG, https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/horn-africa/somalia/re-integ-enhancing-somalias-responsiveness-management-and-reintegration_en , Zugriff 29.1.2021
FIS - Finnish Immigration Service [Finnland] (7.8.2020): Somalia: Fact-Finding Mission to Mogadishu in March 2020, https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf/2f51bf86-ac96-f34e-fd02-667c6ae973a0/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf?t=1602225617645 , Zugriff 17.3.2021
HRW - Human Rights Watch (14.1.2020): World Report 2020 – Somalia, https://www.ecoi.net/de/dokument/2022682.html , Zugriff 16.1.2020
IOM - Internationale Organisation für Migration (9.3.2021a): IOM Somalia Relocates Nearly 7,000 Internally Displaced Persons Facing Eviction, https://www.iom.int/news/iom-somalia-relocates-nearly-7000-internally-displaced-persons-facing-eviction , Zugriff 11.3.2021
IOM - Internationale Organisation für Migration (25.6.2019): In Somalia, IOM Begins Relocating Families at Risk of Eviction, https://www.iom.int/news/somalia-iom-begins-relocating-families-risk-eviction , Zugriff 29.1.2021
IPC - Integrated Food Security Phase (3.2021): Somalia – IPC Acute Food Insecurity and Acute Malnutrition Analysis January-June 2021, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-ipc-acute-food-insecurity-and-acute-malnutrition-analysis-january-june , Zugriff 9.3.2021
LIFOS - Lifos/Migrationsverket [Schweden] (9.4.2019): Somalia - Folkbokförning, medborgarskap och identitetshandlngar, https://www.ecoi.net/en/file/local/2007147/190423300.pdf , Zugriff 17.3.2021
ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021
OXFAM / REACH (6.2018): Drought, Displacement and Livelihoods in Somalia/Somaliland. Time for gender-sensitive and protection-focused approaches, http://regionaldss.org/wp-content/uploads/2018/07/bn-somalia-somaliland-drought-displacement-protection-280618-en-002.pdf , Zugriff 26.1.2021
RD - Radio Dalsan (27.6.2019): UN relocates 3,900 IDPs to new sites in Somalia, https://www.radiodalsan.com/en/2019/06/27/un-relocates-3900-idps-to-new-sites-in-somalia/ , Zugriff 29.1.2021
RI - Refugees International (12.2019): Durable Solutions in Somalia, Moving from Policies to Practice for IDPs in Mogadishu, https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/5dfa4e11ba6ef66e21fbfd17/1576685091236/Mark+-+Somalia+-+2.0.pdf , Zugriff 28.1.2021
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (14.7.2021): Somalia - Internal Displacements Monitored by Protection & Return Monitoring Network (PRMN) - June 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2056012/UNHCR_Somalia_PRMN_InternalDisplacements_June_2021.pdf , Zugriff 20.7.2021
UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (1.2021): Somalia Humanitarian Bulletin, January 2021, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-humanitarian-bulletin-january-2021-enso , Zugriff 9.3.2021
UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (31.3.2020): Somalia Humanitarian Bulletin, 1-31 March 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2027648/March+2020+Humanitarian+Bulletin-Final+%281%29.pdf , Zugriff 8.4.2020
UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (6.2.2020): Somalia Humanitarian Bulletin, 1 January – 6 February 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2024797/January+2020+Humanitarian+Bulletin+eo+rev+M.pdf , Zugriff 20.2.2020
UNSC - UN Security Council (10.8.2021): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2021/723], https://www.ecoi.net/en/file/local/2058501/S_2021_723_E.pdf , Zugriff 27.8.2021
UNSC - UN Security Council (13.11.2020): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2020/1113], https://www.ecoi.net/en/file/local/2041334/S_2020_1113_E.pdf , Zugriff 2.12.2020
UNSOM - United Nations Assistance Mission in Somalia (31.1.2021): On visit to Baidoa, Humanitarian Coordinator Highlights Needs for ‘Long-term Durable Solutions’ for Internally Displaced Persons, https://unsom.unmissions.org/visit-baidoa-humanitarian-coordinator-highlights-needs-%E2%80%98long-term-durable-solutions%E2%80%99-internally , Zugriff 3.3.2021
USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021
Somaliland
Letzte Änderung: 21.10.2021
Somaliland kooperiert mit dem UNHCR und IOM, um Flüchtlingen, zurückkehrenden Flüchtlingen, Asylwerbern, Staatenlosen und anderen relevanten Personengruppen Unterstützung zukommen zu lassen (USDOS 30.3.2021, S. 22). Im September 2020 befanden sich 22.719 registrierte Asylwerber und Flüchtlinge in Somalia, mehr als die Hälfte davon in Somaliland. Diese stammen nahezu zur Gänze aus Äthiopien und dem Jemen (UNHCR 25.10.2020b).
Die relative Sicherheit in Somaliland hat aus Süd-/Zentralsomalia zahlreiche Menschen angezogen, auch wenn dort kein staatlicher Schutz besteht. IDPs sind von willkürlichen Verhaftungen und Diskriminierung betroffen (ÖB 3.2020, S. 19). Während von IDPs im Rest Somalias bewaffnete Gruppen und Milizen als Hauptverursacher von Unsicherheit genannt werden, finden diese in Somaliland kaum Erwähnung. Dort werden als Täter Kriminelle und Familienangehörige genannt. In Somaliland erwähnen weibliche IDPs auch nicht, dass sie im Lager besonderen Risiken sexueller Gewalt ausgesetzt wären (OXFAM 6.2018, S. 7f). Somaliland hat eine eigene Policy für IDPs verfasst (OXFAM 6.2018, S. 5).
Anfang Oktober 2021 hat Somaliland aus Südsomalia stammende Flüchtlinge aus der Stadt Laascaanood abgeschoben. Gemäß Angaben von Ältesten der Stadt handelte es sich bei den Deportierten in erster Linie um Personen aus dem South West State, die schon seit vielen Jahren in Somaliland ansässig waren (SD 4.10.2021) – manche davon schon seit 20 Jahren (APAN 6.10.2021). Insgesamt wurden 700 Personen nach Puntland deportiert (SD 4.10.2021), nach anderen Angaben waren es mindestens 1.000 (APAN 6.10.2021) oder sogar 3.000 (Sahan 8.10.2021a). Puntland erklärt, 758 deportierte Frauen, Männer und Kinder mit Nahrung und Gesundheitsdiensten versorgt zu haben. Die meisten Menschen wurden nach Galkacyo gebracht (GO 4.10.2021). Somaliland hat weitere Deportationen – diesmal aus Ceerigaabo – angeordnet. In diesem Fall wurde den somalischen Staatsbürgern, die aus dem SWS stammen, 15 Tage Zeit eingeräumt (SD 7.10.2021). Somaliland hat die Aktion mit Sicherheitsbedenken argumentiert. Die UN haben die Deportation verurteilt (APAN 6.10.2021).
Die für Flüchtlinge verantwortliche National Displacement and Refugee Agency arbeitet mit dem UNHCR zusammen. Kosten für medizinische Behandlung von Flüchtlingen werden vom UNHCR getragen. Alleine am Hargeysa Group Hospital werden im Durchschnitt täglich 25 Flüchtlinge behandelt. Flüchtlingskinder können kostenlos eine öffentliche Schule besuchen. Flüchtlinge dürfen in Somaliland arbeiten (UNHCR 29.10.2018).
Quellen:
APAN - Agence de Presse Africaine News (6.10.2021): UN frowns on deportations from Somaliland, http://apanews.net/en/news/un-frowns-on-deportations-from-somaliland/ , Zugriff 8.10.2021
GO - Garowe Online (4.10.2021): Puntland resettles Las Anod eviction victims, https://www.garoweonline.com/en/news/puntland/somalia-puntland-resettles-las-anod-eviction-victims , Zugriff 8.10.2021
ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021
OXFAM / REACH (6.2018): Drought, Displacement and Livelihoods in Somalia/Somaliland. Time for gender-sensitive and protection-focused approaches, http://regionaldss.org/wp-content/uploads/2018/07/bn-somalia-somaliland-drought-displacement-protection-280618-en-002.pdf , Zugriff 26.1.2021
Sahan - Sahan / Puntland Post (8.10.2021a): The Somali Wire Issue No. 245, per e-Mail, Originallink auf Somali: https://puntlandpost.net/2021/10/07/waan-waantii-u-dambaysay-ee-laga-dhex-waday-galmudug-iyo-ahlusuna-oo-fashilantay/
SD - Somali Dispatch (7.10.2021): Somaliland doubles down and orders the explosion of Southerners from Erigavo, https://www.somalidispatch.com/latest-news/somaliland-doubles-down-and-orders-the-explosion-of-southerners-from-erigavo/ , Zugriff 12.10.2021
SD - Somali Dispatch (4.10.2021): Some Las Anod Traditional leaders not satisfied with deportations, https://www.somalidispatch.com/latest-news/some-las-anod-traditional-leaders-not-satisfied-with-deportations/ , Zugriff 8.10.2021
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (25.10.2020b): Fact Sheet; Somalia; 1 - 30 September 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2041035/UNHCR_Somalia_Factsheet_Sep_2020.pdf , Zugriff 2.12.2020
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (29.10.2018): Shared services help refugees and locals coexist in Somaliland, https://www.unhcr.org/afr/news/stories/2018/10/5bd6c1014/shared-services-help-refugees-and-locals-coexist-in-somaliland.html , Zugriff 26.1.2021
USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021
Grundversorgung/Wirtschaft
Süd-/Zentralsomalia, Puntland
Wirtschaft und Arbeit
Letzte Änderung: 21.10.2021
Die somalische Wirtschaft hat mit dem dreifachen Schock aus Covid-19, einer Heuschreckenplage und Überschwemmungen zu kämpfen. Dabei hat sich die Wirtschaft als resilienter erwiesen, als zuvor vermutet: Ursprünglich war für 2020 ein Rückgang des BIP um 2,5 % prognostiziert worden (UNSC 13.11.2020, Abs. 17), tatsächlich sind es dann nur minus 0,4 % geworden (UNSC 10.8.2021, Abs. 17). Für 2021 wird ein Wachstum von 2,4 %, für 2022 eines von 3,2 % prognostiziert (WB 6.2021, S. 20).
Eine der Triebfedern der wirtschaftlichen Entwicklung ist und bleibt die Diaspora – etwa durch Investitionen (v. a. in Mogadischu und anderen Städten) (BS 2018, S. 5/28; vgl. UNSC 17.2.2021, Abs. 19). Remissen stabilisieren auch weiterhin Haushalte und Betriebe (UNSC 13.11.2020, Abs. 17). Diese Rückflüsse sind 2020 im Vergleich zu 2019 noch einmal gestiegen (UNSC 17.2.2021, Abs. 19; vgl. WB 6.2021, S. 11f), nach Angaben einer anderen Quelle sind sie aufgrund der Pandemie zurückgegangen (IPC 3.2021, S. 2). Neben der Diaspora (VICE 1.3.2020) sind auch zahlreiche Agenturen der UN (etwa UN-Habitat, UNICEF, UNHCR) tatkräftig dabei, das Land wiederaufzubauen (ÖB 3.2020, S. 20).
Allerdings war das Wirtschaftswachstum schon in besseren Jahren für die meisten Somalis zu gering, als dass sich ihr Leben dadurch verbessern hätte können (UNSC 21.12.2018, S. 4), die Bevölkerung wuchs schneller als das BIP. Das Pro-Kopf-Einkommen beträgt 500 US-Dollar (BS 2020, S. 30). Zusätzlich bleibt die somalische Wirtschaft im Allgemeinen weiterhin fragil. Dies hängt mit der schmalen Wirtschaftsbasis zusammen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist von Landwirtschaft und Fischerei abhängig und dadurch externen und Umwelteinflüssen besonders ausgesetzt (ÖB 3.2020, S. 15). Die Viehwirtschaft macht rund 60 % des BIP und 80 % der Exporte aus (BS 2020, S. 25/30). Die Exporte – vor allem von Vieh – sind im ersten Halbjahr 2020 um 22 % zurückgegangen (UNSC 13.11.2020, Abs. 17; vgl. UNSC 10.8.2021, Abs. 17). Dadurch stieg das Außenhandelsdefizit (UNSC 10.8.2021, Abs. 17). Das BIP/Kopf ist 2020 mit 302 US-Dollar fast auf den Stand von 2013 gesunken (WB 6.2021, S. 2). Außerdem behindern al Shabaab und andere nichtstaatliche Akteure kommerzielle Aktivitäten in Bakool, Bay, Gedo und Hiiraan und unterbinden die Leistung humanitärer Hilfe (USDOS 30.3.2021, S. 21). Insgesamt sind zuverlässige Daten zur Wirtschaft schwierig bis unmöglich zu erhalten bzw. zu verifizieren (ÖB 3.2020, S. 2/15) bzw. sind vertrauenswürdige Daten kaum vorhanden (BS 2020, S. 30).
Staatshaushalt: Die Regierung ist stark abhängig von externer Hilfe. Ein Großteil der Regierungsausgaben wird durch externe Akteure bezahlt (ACCORD 31.5.2021, S. 29; vgl. BS 2020, S. 39). Alleine die offizielle Entwicklungshilfe betrug 2017 1,75 Milliarden US-Dollar – 26 % des BIP (BS 2020, S. 39). Aufgrund der fehlenden Kontrolle über das Territorium – aber auch hinsichtlich technischer Fähigkeiten – war die Regierung bisher nicht in der Lage, ein nationales Steuersystem aufzubauen. Selbst für grundlegende Staatsausgaben ist das Land auf externe Geber angewiesen (BS 2020, S. 36). Die eigenen Einnahmen betrugen 2016 nur rd. 113 Millionen US-Dollar (BS 2020, S. 27). Im Jahr 2021 sollen sie bereits 260 Millionen US-Dollar betragen. Der große Rest des Budgets entstammt bi- und multilateralen Quellen (SPA 18.3.2021). Aufgrund der Streitigkeiten um die Wahlen im Frühjahr 2021 hat die EU ihre finanzielle Unterstützung zurückbehalten. Dies hinterlässt im Budget ein großes Loch, viele Beamte können nicht bezahlt werden (Sahan 16.4.2021a). Zudem gingen im ersten Quartal 2021 - aufgrund der politischen Streitigkeiten und einer neuen Covid-19-Welle - die Steuereinnahmen um 13 % zurück (WB 6.2021, S. 19).
Das Staatsbudget 2021 beträgt 671 Millionen US-Dollar und hat sich damit seit 2019 (344 Millionen) fast verdoppelt. Ca. 164 Millionen US-Dollar sind für Verteidigung und Sicherheit vorgesehen (SPA 18.3.2021). Nach anderen Angaben entfallen darauf ca. 36 % der Staatsausgaben (HIPS 2020, S. 11) bzw. in den Jahren 2017 bis 2021 durchschnittlich 31 % (AI 18.8.2021, S. 19). Von den Bundesstaaten gelingt es neben Puntland nur Jubaland ein relevantes Maß an Einnahmen selbst zu generieren (WB 6.2021, S. 16).
Im Jahr 2020 wurde in Somalia ein Meilenstein erreicht. Endlich kann das Land wieder an internationalen Finanzinstitutionen partizipieren. Im März 2020 erklärte die Afrikanische Entwicklungsbank nach einer Einzahlung durch die EU und das Vereinigte Königreich, dass alle Schulden und Rückstände Somalias beglichen sind. Die Weltbank, der IMF und die Afrikanische Entwicklungsbank haben alle Zahlungsrückstände und Darlehen bereinigt und ihre Beziehungen mit Somalia nach 30 Jahren normalisiert. Ende März bewilligte der Internationale Währungsfonds einen dreijährigen Kreditplan zur Unterstützung des Nationalen Entwicklungsplans (HIPS 2021, S. 4/23).
Arbeitsmarkt: Es gibt kein nationales Mindesteinkommen. Ca. 95 % der Berufstätigen arbeiten im informellen Sektor (USDOS 30.3.2021, S. 40). In einer von Jahrzehnten des Konflikts zerrütteten Gesellschaft hängen die Möglichkeiten des Einzelnen generell sehr stark von seinem eigenen und vom familiären Hintergrund sowie vom Ort (Stadt-Land- und Nord-Süd-Gefälle) ab (BS 2020, S. 30). Generell zeigt vor allem die urbane Ökonomie in Somalia – allen voran in Mogadischu – eine Erholung. Es gibt einen Bau-Boom. Supermärkte, Restaurants und Geschäfte werden eröffnet (BS 2020, S. 25). Alleine der Telekom-Konzern Hormuud Telecom hat in den vergangenen Jahren tausende Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt heute mehr als 20.000 Frauen und Männer (RD 14.2.2021). In Puntland und Teilen Südsomalias – insbesondere Mogadischu – boomt der Bildungsbereich (BS 2020, S. 32).
Einerseits wird berichtet, dass die Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge und zurückkehrende Flüchtlinge in Süd-/Zentralsomalia limitiert sind. So berichten etwa Personen, die aus Kenia zurückgekehrt sind, über mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten (USDOS 30.3.2021, S. 23). Andererseits wird ebenso berichtet, dass die besten Jobs oft an Angehörige der Diaspora fallen – etwa wegen besserer Sprachkenntnisse (FIS 7.8.2020, S. 33f). Am Arbeitsmarkt spielen Clanverbindungen eine Rolle (USDOS 30.3.2021, S. 39). Gerade um eine bessere Arbeit zu erhalten, ist man auf persönliche Beziehungen und das Netzwerk des Clans angewiesen. Dementsprechend schwer tun sich IDPs, wenn sie vor Ort über kein Netzwerk verfügen; meist sind sie ja nicht Mitglieder der lokalen Gemeinde (FIS 7.8.2020, S. 33f). Männer, die vom Land in Städte ziehen, stehen oft vor der Inkompatibilität ihrer landwirtschaftlichen Kenntnisse mit den vor Ort am Arbeitsmarkt gegebenen Anforderungen (DI 6.2019, S. 22f; vgl. OXFAM 6.2018, S. 10). Die Zugezogenen tun sich schwer, eine geregelte Arbeit zu finden (OXFAM 6.2018, S. 10); außerdem wird der Umstieg von Selbstständigkeit auf abhängige Hilfsarbeit oft als Demütigung und Erniedrigung gesehen. Darum müssen gerade IDPs aus ländlichen Gebieten in die Lage versetzt werden, neue Fähigkeiten zu erlernen, damit sie etwa am informellen Arbeitsmarkt oder als Kleinhändler ein Einkommen finden. Dies geschieht auch teilweise (DI 6.2019, S. 22f). Generell finden Männer unter anderem auf Baustellen, beim Graben, Steinebrechen, Schuhputzen oder beim Khatverkauf eine Arbeit. Ein Großteil der Tätigkeiten ist sehr anstrengend und mitunter gefährlich. Außerdem wird von Ausbeutung und Unterbezahlung berichtet (OXFAM 6.2018, S. 10).
Programme, wie die von der EU finanzierte Dalbile-Youth-Initiative, sollen Abhilfe schaffen. Dieses Programm, in welches sechs Millionen Euro investiert werden, dient der Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit. Junge Menschen werden mit Fähigkeiten und Ressourcen ausgestattet, Start-ups mit bis zu 2.000 US-Dollar gefördert (UNFPA 2.3.2021b). UNFPA und die EU unterstützen in Puntland Start-ups von Jungunternehmern – etwa im Bereich Fischfang, Modedesign oder Hotellerie – mit Ausbildung, Know-how und finanziellen Mitteln. Das Programm läuft jedenfalls bis 2024 (UNSC 10.8.2021, Abs. 35).
Einkommen: Am Bau kann man beispielsweise als Träger arbeiten. Der Verdienst für eine derartige Tätigkeit beläuft sich auf rund 100 US-Dollar im Monat. Auch am Hafen gibt es Verdienstmöglichkeiten. In der Verwaltung sind nur wenige Stellen verfügbar, besser stellt sich die Situation bei Polizei und Armee dar. Viele Menschen leben vom Kleinhandel oder von ihrer Arbeit in Restaurants oder Teehäusern. Allerdings ist eine Arbeit in der Gastwirtschaft mit niedrigem Ansehen verbunden. Die Mehrheitsbevölkerung ist derartige Tätigkeiten sowie jene auf Baustellen äußerst abgeneigt. Dort finden sich vielmehr marginalisierte Gruppen – z.B. IDPs – die oft auch als Tagelöhner arbeiten. Weibliche IDPs arbeiten als Mägde, Hausangestellte oder Wäscherinnen. Manche verkaufen Früchte auf Märkten. Damit erzielen sie ein Einkommen von 1-2 US-Dollar pro Tag (FIS 7.8.2020, S. 33f). Von in der Reintegrationsphase befindlichen ehemaligen Angehörigen der al Shabaab wurden im September 2017 folgende Berufe genannt: Köhler; Hilfsarbeiter am Bau in Dayniile (10 Tage pro Monat; 10 US-Dollar pro Tag); Koranlehrer am Vormittag in Dayniile (120 US-Dollar pro Monat); Rickshaw-Fahrer; Transporteur mit einer Eselkarre (10-12 US-Dollar pro Tag); Transporteur mit einer Scheibtruhe (Khalil 1.2019, S. 30). Ärzte verdienen im Banadir-Hospital 1.500-2.000 US-Dollar, Krankenschwestern 400-600 US-Dollar (FIS 5.10.2018, S. 36); nach anderen Angaben verdienen Krankenschwestern nur 200-300 US-Dollar (AI 18.8.2021, S. 17). Ein angestellter Fahrer, der Güter und Personen von Hiiraan nach Galgaduud befördert, verdient 300 US-Dollar pro Monat, ein anderer, der selbständig Personen transportiert, rechnet auf dieser Strecke pro Fahrt mit einem Verdienst von 75 US-Dollar (RE 18.2.2021). Eine Fleischverkäuferin in Belet Weyne verdient 4-8 US-Dollar am Tag (RE 19.2.2021).
Arbeitslosenquote: Die Arbeitslosenquote ist landesweit hoch (USDOS 30.3.2021, S. 23), wobei es zu konkreten Zahlen unterschiedlichste Angaben gibt: Laut einer Quelle liegt die Erwerbsquote (labour force participation) bei Männern bei 58 %, bei Frauen bei 37 % (UNSC 21.12.2018, S. 4). Eine weitere Quelle erklärt im August 2016, dass 58 % der männlichen Jugendlichen (Altersgruppe 15-35) ökonomisch aktiv sind, während drei von zehn Jugendlichen arbeitslos sind (UNFPA 8.2016, S. 4). In einer anderen Quelle wird die Arbeitslosenrate für 2018 mit 14 % angeführt (BS 2020, S. 23); die Weltbank nennt 2021 eine Rate von 13,4 % (WB 6.2021, S. 29). Eine weitere Quelle nennt bei 15-24-Jährigen eine Quote von 48 % (OXFAM 6.2018, S. 22, FN8) und eine andere Quelle berichtet von einer Arbeitslosenquote von 47,4 % bei der erwerbstätigen Bevölkerung (ÖB 3.2020, S. 15). Eine aktuellere Quelle erklärt, dass 37,5% der arbeitsfähigen und arbeitssuchenden Frauen arbeitslos sind (SLS 6.4.2021). Bei einer Studie aus dem Jahr 2016 gaben hingegen nur 14,3 % der befragten Jugendlichen (Mogadischu 6 %, Kismayo 13 %, Baidoa 24 %) an, gegenwärtig arbeitslos zu sein. Dies kann auf folgende Gründe zurückzuführen sein: a) dass die Situation in diesen drei Städten anders ist als in anderen Teilen Somalias; b) dass die wirtschaftliche Entwicklung seit 2012 die Situation verbessert hat; c) dass es nun mehr Unterbeschäftigte gibt; d) dass die Definition von „arbeitslos“ unklar ist (z. B. informeller Sektor) (IOM 2.2016).
Die Arbeitslosigkeit - und damit auch die Armut - haben sich infolge der COVID-19-Pandemie verstärkt. 21 % mussten ihre Arbeit niederlegen; und das, obwohl nur 55 % der Bevölkerung überhaupt am Arbeitsmarkt teilnimmt. 78 % der Haushalte berichteten über einen Rückgang des Einkommens (WB 6.2021, S. 23).
[Zur Arbeitsmarktlage in Somalia gibt es kaum aktuelle Informationen.] In einer eingehenden Analyse hat UNFPA im Jahr 2016 Daten zur Ökonomie in der somalischen Gesellschaft erhoben. Dabei wird festgestellt, dass nur knapp die Hälfte der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter (15-64) überhaupt am Arbeitsleben teilnimmt. Der Rest ist „ökonomisch inaktiv“; in diese Gruppe fallen in erster Linie Hausfrauen, gefolgt von Schülern/Studenten, pensionierten oder arbeitsunfähigen Personen. Bei den ökonomisch Aktiven wiederum finden sich in allen Lebensbereichen deutlich mehr Männer (UNFPA 2016):
Ländlich: 68,8 % der Männer - 40,5 % der Frauen
Urban: 52,6 % der Männer - 24,6 % der Frauen
IDP-Lager: 55,2 % der Männer - 32,6 % der Frauen
Nomaden: 78,9 % der Männer - 55,6 % der Frauen (UNFPA 2016)
Aufgeschlüsselt für Puntland und Süd-/Zentralsomalia ergibt sich aus den UNFPA-Daten, dass dort 44,4 % der erwerbsfähigen Bevölkerung arbeiten. 11,4 % gelten als Arbeitssuchende. 44,2 % der Bevölkerung sind ökonomisch inaktiv. Als arbeitend werden in der Studie folgende Personen bezeichnet: jene, die in den der Erhebung vorangegangenen zwölf Monaten bezahlter Arbeit nachgegangen sind oder selbstständig waren. Darunter fällt auch unbezahlte (aber produktive) Arbeit in der Familie, bei welcher direkt Einkommen generiert wird (etwa Viehhüten, Arbeit am eigenen Ackerland; Wirtschaftstreibende, Dienstleister im eigenen Betrieb). Als arbeitslos werden jene Personen bezeichnet, die in diesen zwölf Monaten nach Arbeit gesucht haben und bereit sind, eine Arbeit anzunehmen (UNFPA 2016, S. 29):
[Es folgt eine Grafik]
In der gleichen Studie wurde der Status bzgl. Arbeit auch auf Geschlechter heruntergebrochen. Folglich sind in Puntland und Süd-/Zentralsomalia 13,8 % der Männer und 9 % der Frauen im Alter von 15-64 Jahren auf der Arbeitssuche, wohingegen 55,8 % der Männer und 32,9 % der Frauen einer Arbeit nachgehen (UNFPA 2016, S. 31):
[Es folgt eine Grafik]
Die große Masse der werktätigen Männer und Frauen in Puntland und Süd-/Zentralsomalia arbeitet in Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei (65,6 %). Der nächstgrößere Anteil an Personen arbeitet als Dienstleister oder im Handel (13,5 %) (UNFPA 2016, S. 36f):
[Es folgt eine Grafik]
[…]
Lebensunterhalt: Die Mehrheit der Bevölkerung lebt von Subsistenzwirtschaft, sei es als Kleinhändler, kleine Viehzüchter oder Bauern. Zusätzlich stellen Remissen für viele Menschen und Familien ein Grundeinkommen dar (BS 2020, S. 25). Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist direkt oder indirekt von der Viehzucht abhängig (UNOCHA 31.7.2019, S. 2; vgl. OXFAM 6.2018, S. 4). Die große Masse der werktätigen Männer und Frauen arbeitet in Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei (62,8 %). Der nächstgrößere Anteil an Personen arbeitet als Dienstleister oder im Handel (14,1 %). 6,9 % arbeiten in bildungsabhängigen Berufen (etwa im Gesundheitsbereich oder im Bildungssektor), 4,8 % als Handwerker, 4,7 % als Techniker, 4,1 % als Hilfsarbeiter und 2,3 % als Manager (UNFPA 2016, S. 22).
Studien darüber, wie Menschen in Mogadischu ihren Lebensunterhalt bestreiten, haben sich auf die am meisten vulnerablen Gruppen der Stadt konzentriert: auf IDPs und Arme (urban poor). Für diese Gruppen ist es charakteristisch, dass sie humanitäre Unterstützung erhalten. Sie stellen etwa 20 % der Bevölkerung von Mogadischu. Diese Gruppen profitieren nur zu einem äußerst geringen Anteil von Remissen (2 % der Befragten; somalische Gesamtbevölkerung: 30 %) (LI 1.4.2016, S. 10). Die Mehrheit der IDPs verdingt sich als Tagelöhner. Aufgrund des Wiederaufbaus der Städte werden viele davon gebraucht. Die begehrtesten Jobs sind jene auf Baustellen, wo der Verdienst höher ist als in anderen Bereichen (ACCORD 31.5.2021, S. 23). Männer arbeiten oft im Transportwesen, am Hafen und als Bauarbeiter; Frauen arbeiten als Hausangestellte. Eine weitere Einkommensquelle dieser Gruppen ist der Kleinhandel – v. a. mit landwirtschaftlichen Produkten. Zusätzlich erhalten sie Nahrungsmittelhilfe und andere Leistungen über wohltätige Organisationen (LI 1.4.2016, S. 10; vgl. ACCORD 31.5.2021, S. 23). Dabei bekommen die Menschen nicht immer einen Job, sie arbeiten z.B. nur 2-3 Tage in der Woche (ACCORD 31.5.2021, S. 23). Allerdings bieten NGOs und der Privatsektor den Menschen grundlegende Dienste – vor allem in urbanen Zentren (OXFAM 6.2018, S. 4). Zudem haben Menschen in IDP-Lagern - v.a. wenn sie länger dort leben - in der Regel auch eine Nachbarschaftshilfe aufgebaut (ACCORD 31.5.2021, S. 23).
In einer Studie von IOM aus dem Jahr 2016 gaben arbeitslose Jugendliche (14-30 Jahre) an, in erster Linie von der Familie in Somalia (60 %) und von Verwandten im Ausland (27 %) versorgt zu werden (IOM 2.2016, S. 42f). Insgesamt ist das traditionelle Recht (Xeer) ein soziales Sicherungsnetz, eine Art der Sozial- und Unfall- (SEM 31.5.2017, S. 5/32f; vgl. GIGA 3.7.2018) bzw. Haftpflichtversicherung. Die Mitglieder des Qabiil (diya-zahlende Gruppe; auch Jilib) helfen sich bei internen Zahlungen – z. B. bei Krankenkosten – und insbesondere bei Zahlungen gegenüber Außenstehenden aus (GIGA 3.7.2018). Neben der Kernfamilie scheint der Jilib [Anm.: untere Ebene im Clansystem] maßgeblich für die Abdeckung von Notfällen verantwortlich zu sein. Wenn eine Person Unterstützung braucht, dann wendet sie sich an den Jilib oder – je nach Ausmaß – an untere Ebenen (z.B. Großfamilie) (SEM 31.5.2017, S. 9/32ff). Erweiterte Familie und Clan stellen also das grundlegende soziale Sicherheitsnetz dar (BS 2020, S. 29).
Aufgrund des Fehlens eines formellen Bankensystems ist die Schulden-Kredit-Beziehung (debt-credit relationship) ein wichtiges Merkmal der somalischen Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei spielen Vertrauen, persönliche und Clanverbindungen eine wichtige Rolle – und natürlich auch der ökonomische Hintergrund. Es ist durchaus üblich, dass Kleinhändler und Greißler anschreiben lassen (RVI 9.2018, S. 4). Allerdings ist es 2019 gelungen, die Gargaara Company Ltd. zu etablieren. Über diese Institution werden Kredite an Mikro-, Klein- und mittlere Unternehmen vergeben. Gargaara spielt auch beim Abfedern von Auswirkungen der Covid-19-Pandemie eine Rolle (WB 6.2021, S. 7).
Remissen: Im Jahr 2020 wurden insgesamt 2,8 Milliarden US-Dollar (2019: 2,3 Milliarden) nach Somalia zurück überwiesen. Davon flossen 1,6 Milliarden an Privathaushalte (2019: 1,3 Milliarden) (WB 6.2021, S. 11f). Wie erwähnt, sind für viele Haushalte Remissen aus der Diaspora eine unverzichtbare Einnahmequelle (FIS 7.8.2020, S. 34). Sie ermöglichen größeren Teilen der Bevölkerung den Lebensuntererhalt - und damit Wasser, Gesundheitsleistungen, Bildung und Strom - zu finanzieren (BS 2020, S. 25). Diese Remissen, die bis zu 40 % eines durchschnittlichen Haushaltseinkommens ausmachen, tragen also wesentlich zum sozialen Sicherungsnetz bei (BS 2020, S. 29) und fördern die Resilienz der Haushalte (DI 6.2019, S. 5). Städtische Haushalte erhalten viel eher regelmäßige monatliche Remissen, dort sind es 72 %. Die durchschnittliche Höhe der monatlichen Überweisungen beträgt 229 US-Dollar (RVI 9.2018, S. 1f). IDPs bekommen verhältnismäßig weniger oft Remissen (DI 6.2019, S. 28). Auch die Bevölkerung in Südsomalia – und hier v. a. im ländlichen Raum – empfängt verhältnismäßig weniger Geld als jene in Somaliland oder Puntland. Ein Grund dafür ist, dass dort ein höherer Anteil marginalisierter Gruppen und ethnischer Minderheiten beheimatet ist (RVI 9.2018, S. 2). Vorerst wurde geschätzt, dass die Remissen aufgrund der Covid-19-Pandemie 2020 um 17 % zurückgehen würden (UNSC 13.8.2020, Abs. 26). Schließlich waren sie aber 2020 noch einmal höher als schon 2019 (UNSC 17.2.2021, Abs. 19).
Mindestens 65 % der Haushalte, welche Remissen beziehen, erhalten diese regelmäßig (monatlich), der Rest erhält sie anlassbezogen oder im Krisenfall. Remissen können folglich Fluktuationen im Einkommen bzw. gestiegene Ausgaben ausgleichen. Dies ist gerade in Zeiten einer humanitären Krise - etwa jener von 2017 - wichtig. Durch Remissen können Haushalte Quantität und Qualität der für den Haushalt besorgten Lebensmittel verbessern, und ein sehr großer Teil der Überweisungen wird auch für Lebensmittel aufgewendet. Zusätzlich wird in Somalia in Zeiten der Krise auch geteilt. Menschen bitten z.B. andere Personen, von welchen sie wissen, dass diese Remissen erhalten, um Hilfe (RVI 9.2018, S. 2f).
Quellen:
ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation / Höhne, Markus / Bakonyi, Jutta (31.5.2021): Somalia - Al-Schabaab und Sicherheitslage; Lage von Binnenvertriebenen und Rückkehrer·innen [sic]; Schutz durch staatliche und nicht-staatliche Akteure; Dokumentation zum COI-Webinar mit Markus Höhne und Jutta Bakonyi am 5. Mai 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2052555/20210531_COI-Webinar+Somalia_ACCORD_Mai+2021.pdf , Zugriff 28.6.2021
AI - Amnesty International (18.8.2021): "We just watched COVID-19 patients die": COVID-19 exposed Somalia's weak healthcare system but debt relief can transform it [AFR 52/4602/2021], https://www.ecoi.net/en/file/local/2058478/AFR5246022021ENGLISH.pdf , Zugriff 27.8.2021
BS - Bertelsmann Stiftung (2020): BTI 2020 - Somalia Country Report, https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_SOM.pdf , Zugriff 4.5.2020
BS - Bertelsmann Stiftung (2018): BTI 2018 - Somalia Country Report, https://www.ecoi.net/en/file/local/1427454/488355_en.pdf , Zugriff 24.2.2021
DI - Development Initiatives (6.2019): Towards an improved understanding of vulnerability and resilience in Somalia, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Report_Towards-an-improved-understanding-of-vulnerability-and-resilience-in-Somalia.pdf , Zugriff 14.12.2020
DW - Deutsche Welle (11.3.2021): Women upskill women in Somalia (Video), https://www.dw.com/en/women-upskill-women-in-somalia/av-56831435 , Zugriff 15.3.2021
FIS - Finnish Immigration Service [Finnland] (7.8.2020): Somalia: Fact-Finding Mission to Mogadishu in March 2020, https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf/2f51bf86-ac96-f34e-fd02-667c6ae973a0/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf?t=1602225617645 , Zugriff 17.3.2021
FIS - Finnish Immigration Service [Finnland] (5.10.2018): Somalia: Fact-Finding Mission to Mogadishu and Nairobi, January 2018, https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia_Fact_Finding+Mission+to+Mogadishu+and+Nairobi+January+2018.pdf/2abe79e2-baf3-0a23-97d1-f6944b6d21a7/Somalia_Fact_Finding+Mission+to+Mogadishu+and+Nairobi+January+2018.pdf , Zugriff 17.3.2021
GIGA - Wissenschaftlicher Mitarbeiter am German Institute of Global and Area Studies (3.7.2018): Sachverständigengutachten zu 10 K 1802/14A
HIPS - The Heritage Institute for Policy Studies (2021): State of Somalia Report 2020, Year in Review, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SOS-REPORT-2020-Final-2.pdf , Zugriff 12.2.2021
HIPS - The Heritage Institute for Policy Studies (2020): State of Somalia Report 2019, Year in Review, http://www.heritageinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/HIPS_2020-SOS-2019-Report-English-Version.pdf , Zugriff 17.3.2021
ICG - International Crisis Group (27.6.2019): Women and Al-Shabaab’s Insurgency, https://www.ecoi.net/en/file/local/2011897/b145-women-and-al-shabaab_0.pdf , Zugriff 9.12.2020
IOM - Internationale Organisation für Migration (2.2016): Youth, Employment and Migration in Mogadishu, Kismayo and Baidoa, http://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/IOM-Youth-Employment-Migration-9Feb2016.pdf , Zugriff 24.2.2021
IPC - Integrated Food Security Phase (3.2021): Somalia – IPC Acute Food Insecurity and Acute Malnutrition Analysis January-June 2021, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-ipc-acute-food-insecurity-and-acute-malnutrition-analysis-january-june , Zugriff 9.3.2021
Khalil - Khalil, James / Brown, Rory / et.al. / Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (1.2019): Deradicalisation and Disengagement in Somalia. Evidence from a Rehabilitation Programme for Former Members of Al-Shabaab, https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_disengagement_in_somalia_web.pdf , Zugriff 2.2.2021
LI - Landinfo [Norwegen] (1.4.2016): Somalia - Relevant social and economic conditions upon return to Mogadishu, https://landinfo.no/asset/3570/1/3570_1.pdf , Zugriff 24.2.2021
ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021
OXFAM / REACH (6.2018): Drought, Displacement and Livelihoods in Somalia/Somaliland. Time for gender-sensitive and protection-focused approaches, http://regionaldss.org/wp-content/uploads/2018/07/bn-somalia-somaliland-drought-displacement-protection-280618-en-002.pdf , Zugriff 26.1.2021
RD - Radio Dalsan (14.2.2021): Hormuud Launches Women’s Only Tellers, https://www.radiodalsan.com/en/2021/02/14/hormuud-launches-womens-only-tellers/ , Zugriff 16.2.2021
RE - Radio Ergo (19.2.2021): Somali IDP women in Beletweyne set up businesses to educate their children, https://radioergo.org/en/2021/02/19/somali-idp-women-in-beletweyne-set-up-businesses-to-educate-their-children/ , Zugriff 3.3.2021
RE - Radio Ergo (18.2.2021): Conflict along Hiran-Galmudug road affects jobs and local markets, https://radioergo.org/en/2021/02/18/conflict-along-hiran-galmudug-road-affects-jobs-and-local-markets/ , Zugriff 23.2.2021
RVI - Rift Valley Institute / Majid, Nisar / Abdirahman, Khalif / Hassan, Shamsa (9.2018): Remittances and Vulnerability in Somalia, http://riftvalley.net/publication/remittances-and-vulnerability-somalia , Zugriff 24.2.2021
Sahan - Sahan / Rashid Abdi (16.4.2021a): Editor’s Pick – Desperate Farmaajo and his "look East" pivot, in: The Somali Wire Issue No. 124, per e-Mail
SEM - Staatssekretariat für Migration [Schweiz] (31.5.2017): Focus Somalia – Clans und Minderheiten, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/som/SOM-clans-d.pdf , Zugriff 10.12.2020
SLS - Somaliland Sun (6.4.2021): Somalia: In All Sectors Women have Nearly Half the Opportunities Afforded to Men-Oxfam, https://www.somalilandsun.com/somalia-in-all-sectors-women-have-nearly-half-the-opportunities-afforded-to-men-oxfam/ , Zugriff 13.4.2021
SPA - Somali Public Agenda (18.3.2021): Review of 2021 federal government budget for security, economic growth and public services, https://somalipublicagenda.org/review-of-2021-federal-government-budget-for-security-economic-growth-and-public-services/ , Zugriff 31.8.2021
UNFPA - UN Population Fund (2.3.2021b): Young people gain economic empowerment through innovations, https://somalia.unfpa.org/en/news/young-people-gain-economic-empowerment-through-innovations , Zugriff 11.3.2021
UNFPA - UN Population Fund (8.2016): Somali youth in figures - better data, better lives, http://somalia.unfpa.org/en/publications/somali-youth-figures-better-data-better-lives , Zugriff 24.2.2021
UNFPA - UN Population Fund (2016): Economic Characteristics of the Somali People, https://www.nbs.gov.so/docs/Analytical_Report_Volume_4.pdf , Zugriff 27.1.2021
UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (31.7.2019): Humanitarian Bulletin Somalia, 1-31 July 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2014046/July+2019+Humanitarian+Bulletin-Final.pdf , Zugriff 24.2.2021
UNSC - UN Security Council (10.8.2021): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2021/723], https://www.ecoi.net/en/file/local/2058501/S_2021_723_E.pdf , Zugriff 27.8.2021
UNSC - UN Security Council (19.5.2021): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2021/485], https://www.ecoi.net/en/file/local/2052226/S_2021_485_E.pdf , Zugriff 21.6.2021
UNSC - UN Security Council (17.2.2021): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2021/154], https://www.ecoi.net/en/file/local/2046029/S_2021_154_E.pdf , Zugriff 2.3.2021
UNSC - UN Security Council (13.11.2020): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2020/1113], https://www.ecoi.net/en/file/local/2041334/S_2020_1113_E.pdf , Zugriff 2.12.2020
UNSC - UN Security Council (13.8.2020): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2020/798], https://www.ecoi.net/en/file/local/2036555/S_2020_798_E.pdf , Zugriff 9.10.2020
UNSC - UN Security Council (21.12.2018): Report of the Secretary-General on Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/1456824/1226_1548256199_n1846028.pdf , Zugriff 8.2.2021
USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021
VICE - Vice on HBO (1.3.2020): Somalia's Fight to Rebuild After War, Video auf YouTube, Upload durch VICEon HBO, https://www.youtube.com/watch?v=BSP3TyVaTJw , Zugriff 15.3.2021
WB - Weltbank (6.2021): Somalia Economic Update. Investing in Health to Anchor Growth, http://documents1.worldbank.org/curated/en/926051631552941734/pdf/Somalia-Economic-Update-Investing-in-Health-to-Anchor-Growth.pdf , Zugriff 15.9.2021
Grundversorgung und humanitäre Lage
Letzte Änderung: 21.10.2021
Die humanitären Bedürfnisse bleiben weiter hoch, angetrieben vom anhaltenden Konflikt, von politischer und wirtschaftlicher Instabilität und regelmäßigen Klimakatastrophen sowie der dreifachen Belastung durch Covid-19, Heuschrecken und Überflutungen (UNSC 13.11.2020, Abs. 50; vgl. UNSC 17.2.2021, Abs. 54). Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist in weiten Landesteilen nicht gewährleistet. Periodisch wiederkehrende Dürreperioden mit Hungerkrisen wie auch Überflutungen, zuletzt auch die Heuschreckenplage, die äußerst mangelhafte Gesundheitsversorgung sowie der mangelhafte Zugang zu sauberem Trinkwasser und das Fehlen eines funktionierenden Abwassersystems machen Somalia zum Land mit dem viertgrößten Bedarf an internationaler Nothilfe weltweit (AA 18.4.2021, S. 4/22). Covid-19 hat die bereits bestehende Krise nur noch verschlimmert. Es fügt sich ein in die Krisen der schlimmsten Heuschreckenplage seit 25 Jahren, schweren Überflutungen mit zeitweise 650.000 Vertriebenen, dem mancherorts andauernden Konflikt und vorangehenden Jahren der Dürre. Insgesamt gelten rund 2,6 Millionen Menschen als im Land vertrieben, 3,5 Millionen können auch nur die grundlegendste Nahrungsversorgung nicht sicherstellen (DEVEX 13.8.2020) und stehen vor akuter Unsicherheit bei der Nahrungsmittelversorgung (WFP 6.10.2021).
Seit dem Jahr 2000 hat Somalia 19 schwere Überschwemmungen und 17 Dürren durchgemacht. Das ist dreimal so viel wie im Zeitraum 1970-1990. Im Jahr 2017 stand Somalia nach einer schweren Dürre am Rand einer Hungersnot. 2019 gab es nach einer ungewöhnlichen Gu-Regenzeit die schlechteste Ernte seit der Hungersnot im Jahr 2011 (UNSOM 31.1.2021).
Überschwemmungen: Schon im Zuge der überaus positiv ausgefallenen Deyr-Regenzeit (September-Dezember) 2019 kam es in HirShabelle, Jubaland und dem SWS zu Überschwemmungen. Besonders betroffen war Belet Weyne. 570.000 Menschen waren betroffen, 370.000 mussten ihre Häuser verlassen. Humanitäre Organisationen haben mehr als 350.000 Menschen Unterstützung geleistet (UNSC 13.2.2020, Abs. 60f). Doch auch die Gu-Regenzeit (April-Juni) 2020 sorgte für Überschwemmungen. Erneut waren in 39 Bezirken 1,3 Millionen Menschen betroffen, ca. 500.000 wurden vertrieben (UNSC 13.8.2020, Abs. 64). Bei saisonalen Überflutungen im September 2020 wurden erneut 630.000 Menschen vertrieben (UNSC 13.11.2020, Abs. 53). Dies betraf v. a. die Bezirke Merka, Afgooye, Balcad, Jowhar und Jalalaqsi (PGN 10.2020, S. 9). In der Gu-Regenzeit 2021 trafen Überschwemmungen vor allem die Bezirke Jowhar und Belet Weyne; rund 166.000 Menschen waren betroffen (UNOCHA 26.5.2021). Bei den Überschwemmungen im April-Juni 2020 wurden Felder zerstört (UNSC 13.8.2020, Abs. 64). Im September 2020 wurden bei Überschwemmungen mehr als 1.320 Quadratkilometer bewirtschaftetes Land verwüstet (UNSC 13.11.2020, Abs. 53). Insgesamt wurden 2020 alleine im Bundesstaat HirShabelle fast 1.500 Quadratkilometer Ackerland zerstört (HIPS 2021, S. 18).
Im November 2020 hat der Zyklon Gati Puntland getroffen und auch Teile Somalilands erreicht. Dies war der stärkste Zyklon in der Region, seit es Aufzeichnungen gibt. Der Zyklon brachte doppelt so starke Niederschläge wie in einem Jahr durchschnittlich üblich. Dutzende puntländische Ortschaften und auch ein Teil von Bossaso wurden überschwemmt (PGN 2.2021, S. 5f). Infrastruktur, Häuser und 120 Fischerboote wurden beschädigt oder zerstört, 7.500 Stück Vieh getötet (USAID 8.1.2021, S. 2). 120.000 Menschen waren betroffen, 42.000 wurden temporär vertrieben. 78.000 Betroffenen wurde von humanitären Organisationen Hilfe geleistet (UNSC 17.2.2021, Abs. 55).
Heuschrecken: Im Jahr 2020 war Somalia von der größten Heuschreckenplage seit 25 Jahren betroffen, die Bundesregierung rief den nationalen Notstand aus (BBC 2.2.2020; vgl. UNSC 13.2.2020, Abs. 65). Zumindest Anfang 2020 blieben die durch Heuschrecken verursachten Schäden begrenzt und lokal (FSNAU 3.2.2020c). Die damals am meisten betroffenen Gebiete waren Somaliland, Puntland und Galmudug (UNSC 13.2.2020, Abs. 65). Die Gu-Regenfälle 2020 haben dafür gesorgt, dass die Heuschrecken erneut ideale Brutbedingungen vorfinden. Die FAO und die Regierung hatten vorsorglich 437 Quadratkilometer mit Bio-Pestiziden besprühen lassen (UNSC 13.8.2020, Abs. 65). Später im Jahr wurden neuerlich 396 Quadratkilometer in Somaliland, Puntland und Galmudug besprüht. Damit wurden rund 90.000 Tonnen Nahrung gesichert. Luft- und Bodenoperationen gegen die Plage werden fortgesetzt (UNSC 13.11.2020, Abs. 55). Trotzdem hat sich die Plage auch in die zentralen und südlichen Landesteile verbreitet. Insgesamt sind rund 3.000 Quadratkilometer und 700.000 Menschen betroffen. Humanitäre Organisationen unterstützten 25.900 agro-pastorale Haushalte, davon rd. 7.500 mit Geld (UNSC 17.2.2021, Abs. 56). Vor allem in Puntland und Somaliland wachsen noch Schwärme heran. Klimatische Bedingungen werden aber aller Voraussicht nach die Ausbreitung in landwirtschaftliche Gebiete in Süd-/Zentralsomalia verhindern (FSNAU 17.5.2021, S. 5). Da im Norden Äthiopiens aber derzeit keine Daten erhoben werden und keine Heuschrecken bekämpft werden können, ist unklar, wie sich die Lage bis Ende 2021 weiter entwickeln wird (FAO 27.8.2021).
Regenfälle: Die Deyr-Regenzeit 2020 (Oktober-Dezember) setzte um drei bis vier Wochen zu spät ein. Insgesamt blieb Deyr unterdurchschnittlich – und dies v. a. in den meisten Gebieten Nordsomalias (IPC 3.2021, S. 2). Vor allem die Regionen Sanaag, Bari, Nugaal und Mudug waren von Wassermangel betroffen (FAO 1.3.2021). Nur in Zentralsomalia fiel mehr Regen als üblich (IPC 3.2021, S. 2). Damit herrschte vor den Gu-Regenfällen (April-Juni) in mehr als 80 % des Landes moderate bis schwere Dürre (UNOCHA 17.6.2021; vgl. FSNAU 17.5.2021, S. 1). Diese wurde von der Bundesregierung am 25.4.2021 schlussendlich auch ausgerufen. Angesichts der globalen La-Niña-Lage wird prognostiziert, dass sich die Situation mittelfristig nicht entspannen wird (UNSC 19.5.2021, Abs. 56/59). Die Gu-Regenfälle (April-Juni) 2021 verliefen gering, sie endeten bereits sehr früh - nämlich im Mai. Bis zur nächsten Regenzeit im Herbst werden milde bis moderate Dürrebedingungen vorherrschen (UNOCHA 17.6.2021, S. 1). Nach anderen Angaben steht Ostafrika 2021 und 2022 vor einer verheerenden Dürre, die eben durch La Niña ausgelöst wurde (Funk 4.10.2021). In Teilen Jubalands, in den Bezirken Afmadow, Dhobley und Kulbiyow in Lower Juba, herrscht bereits Dürre. Die Regierung von Jubaland hat zu sofortiger Hilfe aufgerufen, um Leben zu retten (GO 6.10.2021).
Ernte: In Südsomalia wird die Ernte nach der Deyr-Regenzeit um 20 % niedriger ausfallen, als üblich. Im Norden viel die Gu/Karan-Ernte im November 2020 um 58% niedriger aus als im langjährigen Durchschnitt. Die Heuschreckenplage hat signifikant zum Ernterückgang beigetragen (IPC 3.2021, S. 2; vgl. FEWS 4.2.2021). Die Gu-Ernte 2021 lag Schätzungen zufolge um 30-40 % unter dem langjährigen Durchschnitt (UNOCHA 7.2021). Nach anderen Angaben liegt die Ernte in Südsomalia um 60 % unter dem langjährigen Schnitt, in Nordwestsomalia um 63 % (FSNAU 9.9.2021a).
Armut: Rund 77 % der Bevölkerung müssen mit weniger als 1,9 US-Dollar pro Tag auskommen – insbesondere in ländlichen Gebieten und IDP-Lagern (ÖB 3.2020, S. 14; vgl. BS 2020, S. 22). Nach anderen Angaben leben 69 % der Bevölkerung in Armut (HIPS 2020, S. 14), nach wieder anderen Angaben sind es 73 %. 43 % werden als extrem arm eingestuft (SIDRA 6.2019a, S. 5). Es gibt viele IDPs und Kinder, die auf der Straße leben und arbeiten (USDOS 30.3.2021, S. 34). Generell sind somalische Haushalte aufgrund von Naturkatastrophen, Epidemien, Verletzung oder Tod für Notsituationen anfällig. Mangelnde Bildung, übermäßige Abhängigkeit von landwirtschaftlichem Einkommen, hohe Arbeitslosigkeit, geringer Wohlstand und große Haushaltsgrößen tragen weiter dazu bei (ÖB 3.2020, S. 14). 60 % der Somali sind zum größten Teil von der Viehzucht abhängig, 23 % sind Subsistenz-Landwirte (OXFAM 6.2018, S. 4). Zwei Drittel der Bevölkerung leben im ländlichen Raum. Sie sind absolut vom Regen abhängig. In den vergangenen Jahren haben Frequenz und Dauer von Dürren zugenommen. Deswegen wurde auch die Kapazität der Menschen, derartigen Katastrophen zu begegnen, reduziert. Mit jeder Dürre wurden ihre Vermögenswerte reduziert: Tiere starben oder wurden zu niedrigen Preisen verkauft, Ernten blieben aus; es fehlt das Geld, um neues Saatgut anzuschaffen (TG 8.7.2019).
Versorgungslage / IPC: [IPC = Integrated Phase Classification for Food Security; 1-moderat bis 5-Hungersnot] Die Zahl an Menschen, die in ganz Somalia stark oder sehr stark von Lücken in der Nahrungsmittelversorgung betroffen sind (IPC 3 und höher), ist von 1,3 Millionen Anfang 2020 (FSNAU 3.2.2020c) auf 1,6 Millionen Anfang 2021 angewachsen. Weitere 2,5 Millionen Menschen leiden ebenfalls an Problemen bei der Nahrungsmittelversorgung (IPC 2) (IPC 3.2021, S. 2). Im September 2021 wurden 2,2 Millionen Menschen in IPC 3-4 eingeordnet, weitere 5,6 Millionen in IPC 2; allerdings gilt nun eine neue Annahme von einer Gesamtbevölkerung von 15,7 Millionen Menschen. Die Prognose bis Jahresende besagt, dass sich dann 3,5 Millionen Menschen in IPC 3-4 und weitere 3,7 Millionen in IPC 2 befinden werden (FSNAU 9.9.2021a).
Die folgenden IPC-Food-Insecurity-Lagekarten zeigen die Situation im Zeitraum Juli 2019 bis September 2021:
Hunger ist v.a. bei Nomaden (42 %) und bei ländlichen Haushalten (37 %) prävalent (WB 6.2021, S. 24). Angesichts der IPC-Karten ist die Stadtbevölkerung i.d.R. von IPC 3 oder IPC 4 anteilig weit weniger betroffen als Menschen in ländlichen Gebieten; und letztere sind weit weniger betroffen als IDPs (FSNAU o.D.). Generell finden sich unter IDPs mehr Personen, die unter Mangel- oder Unterernährung leiden (USDOS 30.3.2021, S. 21). Die Mehrheit der IDPs in städtischen Gebieten sind arm und haben nur eingeschränkte Reserven und Einkommensmöglichkeiten. Sie sind stark von externer humanitärer Hilfe abhängig. Sie, sowie Teile der armen Stadtbevölkerung (urban poor) werden bis Ende 2021 vor moderaten bis großen Lücken bei der Nahrungsmittelversorgung stehen (FEWS 4.2.2021). Dies gilt aber auch für viele Haushalte in vielen nomadischen Gebieten sowie für arme Haushalte in agro-pastoralen Gebieten - etwa an den Flüssen (FSNAU 9.9.2021a).
IPC für den Zeitraum 1/2017-9/2021 in Zahlen gefasst:
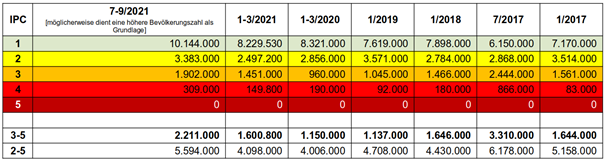
Verteilung nach Gebieten in Prozent der Bevölkerung für Jänner-März 2020 bzw. Jänner-März 2021:
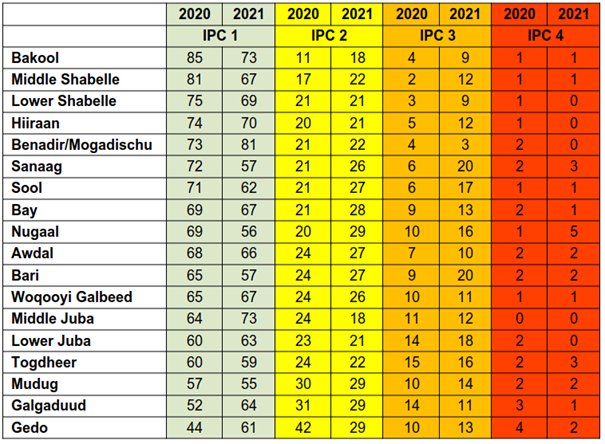
Eine weitere Kartensammlung, in welcher ausschließlich alarmierende Werte mehrere, für die Nahrungsmittelversorgung relevanter Werte zusammengefasst dargestellt werden, zeigt die Entwicklung der vergangenen Jahre (je dunkler das Rot, desto mehr Alarmwerte wurden überschritten):
Ca. 838.800 Kinder unter fünf Jahren werden bis Dezember 2021 vor einer Situation der akuten Unter- oder Mangelernährung stehen, 143.200 vor schwerer akuter Unterernährung (FSNAU 9.9.2021a). Nach neueren Angaben ist die Zahl bereits im Juni auf eine Million Kinder angestiegen (UNOCHA 17.6.2021, S. 2). Die Prognose für Juli 2022 geht von ca. 1,2 Millionen unterernährten bzw. 213.400 schwer unterernährten Kindern aus (FSNAU 9.9.2021a). Die Daten unten zeigen, dass IDPs in manchen Städten besonders von Unterernährung betroffen sind, in anderen weniger stark [GAM = akute Unterernährung; SAM = schwere akute Unterernährung]:
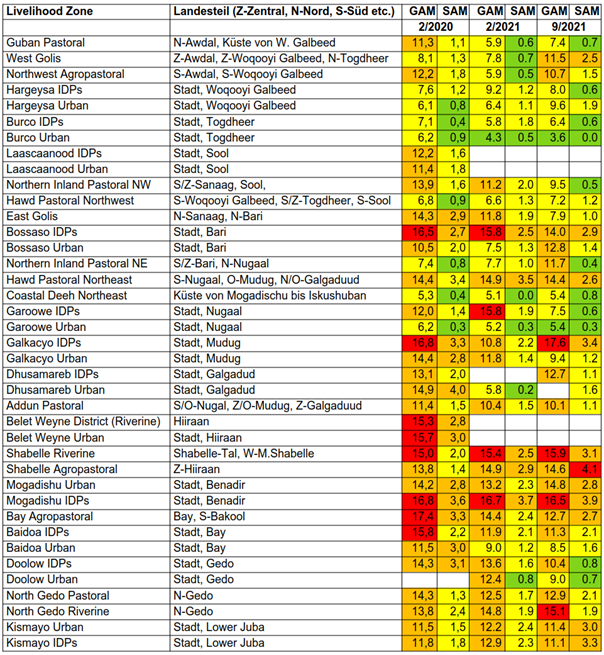
Durchschnittlich befinden sich 11,5% in akuter Unterernährung (2020: 10.9%). Weiterhin bleiben die Zahlen also hoch. Besonders angespannt ist die Situation im Shabelletal bei IDPs in Mogadischu. Prognosen zufolge wird sich die Situation auch in folgenden Gebieten zuspitzen: Baidoa IDPs, Bay Agro-pastoral, Hiiraan, Coastal Deeh Pastoral, Garoowe IDPs, Baidoa urban und Doolow urban (FSNAU 9.9.2021a). Die IPC-Stufen zur Unter- und Mangelernährung für August 2021 und die Prognose bis November 2021:
Humanitäre Hilfe: Monatlich werden durchschnittlich 1,8 Millionen Menschen mit Nahrungsmittelhilfe erreicht; geplant wären 4 Millionen (UNOCHA 7.2021; FSNAU 9.9.2021a). Diese Hilfe verhindert eine stärkere Unsicherheit bei der Nahrungsmittelversorgung und eine höhere Rate an Unterernährung (FEWS 4.2.2021). Für Mogadischu gibt es ein spezielles Sicherheitsnetz, das von der Regierung gemeinsam mit dem World Food Programme betrieben wird. Dieses erreicht seit Juli 2018 monatlich 125.000 Menschen (IPC 3.2021, S. 3). Dadurch werden 35 US-Dollar pro Monat und Haushalt ausbezahlt (FSNAU 9.9.2021a).
Die humanitäre Unterstützung für Somalia ist eine der am besten finanzierten humanitären Maßnahmen weltweit (RI 12.2019, S. 16). Alleine die USA geben in den Jahren 2020 und 2021 mehr als einen halbe Milliarde US-Dollar dafür aus (USAID 8.1.2021, S. 1). Hilfsprojekte von internationalen Organisationen oder NGOs erreichen in der Regel nicht alle Bedürftigen. Allerdings kann aufgrund großer internationaler humanitärer Kraftanstrengungen und einer zunehmenden Professionalisierung der humanitären Hilfe bei den regelmäßig wiederkehrenden Dürren sowie Überschwemmungen inzwischen weitgehend verhindert werden, dass es zu Hungertoten kommt (AA 18.4.2021, S. 22). Laut UN-Generalsekretär sind die Spitzen bei der Notwendigkeit humanitärer Hilfe in Somalia schon zur Routine geworden (UNSC 13.11.2020, Abs. 96). In der Regel erreichen humanitäre Organisationen die Menschen. Im November 2020 hatten Organisationen der Nahrungsmittelhilfe beispielsweise die Erreichung von 2,1 Millionen Menschen angestrebt; erreicht wurden schließlich 1,9 Millionen. Aufgrund von Behinderungen beim Zugang zu den Menschen konnten in diesem Monat etwa nur 3 % der Menschen in Middle Shabelle und niemand in Middle Juba erreicht werden. In Benadir konnten – aufgrund von Finanzierungsausfällen – nur 22 % erreicht werden. Im Kampf gegen Unterernährung stoßen die Organisationen auf Probleme bei der Erreichbarkeit von Menschen in Middle Juba, dem Bezirk Tayeeglow (Bakool), Sablaale (Lower Shabelle) und Adan Yabaal (Middle Shabelle) (UNOCHA 27.1.2021, S. 3ff).
Insgesamt nutzen rund 70 % der Bevölkerung mobile Bankdienste, ein Drittel der Menschen haben mobile Konten (BS 2020, S. 26). Aufgrund von Covid-19 hat z.B. die Hilfsorganisation CARE ihre work-for-cash-Programme ausgesetzt. Als Ersatz wird Hilfsbedürftigen das Geld auch ohne Arbeit auf ihr Mobiltelefon überwiesen. 84.000 Menschen nehmen dies in Anspruch. Die Europäische Kommission hat aufgrund der Heuschreckenplage weitere 5,8 Millionen Euro für Geldtransfers an Betroffene zur Verfügung gestellt (DEVEX 13.8.2020).
Folgende Organisationen sind beispielsweise in folgenden Städten in einem oder mehreren der genannten Bereiche tätig:
Baidoa (Kinderschutz, Gesundheit, Rückkehr/Unterkunft, Lokalverwaltung, Katastrophenmanagement, Kommunikation): World Vision, Save the Children International, Médecins Sans Frontières, International Organization for Migration (IOM), IMC Worldwide, Somalia’s Ministry of Resettlement, Disaster Management and Disability Affairs, Ministry of Humanitarian Affairs, Ministry of Planning, Baidoa District Administration, Bay Regional Administration, Gargaar Relief and Development Organization (GREDO), Social-life and Agricultural Development Organization (SADO), Radio Baidoa, Baidoa Specialist Hospital;
Belet Weyne (Bildung, Schutz, Ernährung und Gesundheit, Nahrungsversorgungssicherheit, humanitäre Hilfe, Geldtransfer-Programme): UNICEF, Danish Refugee Council (DRC), the International Committee of the Red Cross (ICRC), Relief International, World Food Programme (WFP), Merci, World Health Organisation (WHO), UNOCHA, WARDI, Green Hope, Global Guardian Somalia Security Services, Beledweyne Private School;
Kismayo (handwerkliche Ausbildung, Unterstützung beim Lebensunterhalt mit Lebensmittelgutscheinen und anderen Aktivitäten, Unterkunft, Bildung): Jubaland Chamber of Commerce & Industry (JCCI), American Refugee Committee (ARC), IOM, CARE, Norwegian Refugee Council (NRC), Daallo Airlines, Kismayo University (DI 6.2019, S. 25f);
In Gedo beteiligt sich u.a. auch AMISOM an Hilfsmaßnahmen - etwa durch die Lieferung von Wasser in Tanklastwagen (RD 14.3.2021). Allerdings ist außerhalb urbaner Zentren der Zugang zu manchen Bezirken nur eingeschränkt möglich – v.a. wegen der Unsicherheit entlang von Versorgungsrouten (UNSC 17.2.2021, Abs. 58). Al Shabaab und andere nichtstaatliche Akteure behindern die Leistung humanitärer Hilfe und die Lieferung von Hilfsgütern an vulnerable Bevölkerungsteile – speziell in Süd-/Zentralsomalia (USDOS 30.3.2021, S. 15; vgl. UNSC 17.2.2021, Abs. 58). In Bakool hat sich die humanitäre Lage aufgrund von Unsicherheit, Drohungen und einer Blockade drastisch verschlechtert. Der Zugang für humanitäre Organisationen ist beschränkt (UNOCHA 1.2021, S. 3). Im Kampf gegen Unterernährung stoßen die Organisationen auf Probleme bei der Erreichbarkeit von Menschen in Middle Juba, dem Bezirk Tayeeglow (Bakool), Sablaale (Lower Shabelle) und Adan Yabaal (Middle Shabelle) (UNOCHA 27.1.2021, S.3ff). Zudem kam es alleine im Zeitraum August-November 2020 zu 44 gewaltsamen Zwischenfällen mit Auswirkungen auf humanitäre Organisationen. Dabei kamen zwei Mitarbeiter ums Leben, einer wurde verletzt (UNSC 13.11.2020, Abs. 57). Rund ein Drittel des Landes ist für humanitäre Kräfte nur schwer erreichbar (UNSC 13.5.2020, Abs. 64).
Öffentliche Hilfe - Programm "Baxnaano": Dieses im April 2020 vom Arbeits- und Sozialministerium eingeführte Sozialhilfeprogramm hat dabei geholfen, vulnerable ländliche Haushalte vor dem Fall in die Armut zu bewahren. Über das Programm werden rund 100.000 Haushalte mit Geldtransfers versorgt. Das Baxnaano soll Verluste durch Heuschrecken und Wetterschocks abfedern (WB 6.2021, S. 3/7). Nach jüngeren Angaben versorgte Baxnaano im Zeitraum Jänner-Juni 2021 440.900 Haushalte; es wurden 20 US-Dollar pro Monat ausbezahlt (FSNAU 9.9.2021a). Nach anderen Angaben werden mehr als 1,1 Millionen Menschen - in ländlichen Gebieten, aber auch arme Menschen und IDPs in Städten - über Programme mit vierteljährlichen Geldzahlungen bedacht (WFP 6.10.2021). Der Anteil des Sozialsektors am Staatsbudget soll 2021 auf 34 % anwachsen; der Großteil davon fließt über Baxnaano an arme und vulnerable Haushalte (WB 6.2021, S. 19).
Gesellschaftliche Unterstützung: Insgesamt gibt es aber kein öffentliches Wohlfahrtssystem (BS 2020, S. 29), keinen sozialen Wohnraum und keine Sozialhilfe (AA 18.4.2021, S. 22). Soziale Unterstützung erfolgt entweder über islamische Wohltätigkeitsorganisationen, NGOs oder den Clan. Wohnungs- und Arbeitsmarkt sowie Armutsminderung liegen im privaten Sektor (BS 2020, S. 29). Das eigentliche soziale Sicherungsnetz ist die erweiterte Familie, der Subclan oder der Clan. Sie bieten oftmals für Personen, deren Unterhalt und Überleben in Gefahr ist, zumindest einen rudimentären Schutz (AA 18.4.2021, S. 22; vgl. OXFAM 6.2018, S. 11f; BS 2020, S. 29). Vorrangig stellen die patrilinearen (väterlichen) Abstammungsgemeinschaft die Solidaritäts- und Schutzgruppe. Aber daneben gibt es auch die Patri-(Vater)-Linie der Mutter und zusätzlich möglicherweise noch angeheiratete Verwandtschaft. Alle drei Linien bilden in der Regel - wie es ein Experte formuliert - "einen ganz beachtlichen Verwandtschaftskosmos". Und in diesem Netzwerk kann Hilfe und Solidarität gesucht werden, es besteht diesbezüglich eine moralische Pflicht. Allerdings müssen verwandtschaftliche Beziehungen auch gepflegt werden. Entscheidend ist also nicht unbedingt die Quantität an Verwandten, sondern die Qualität der Beziehungen. Wer als schwacher Akteur in diesem Netzwerk positioniert ist, der wird schlechter behandelt als die stark Positionierten (ACCORD 31.5.2021, S. 32f). In einer Dokumentation der Deutschen Welle wird ein junger Mann gezeigt, der im Sudan medizinisch versorgt und von dort zurückgeholt werden musste. Die Ältesten bzw. Sultans sammeln Geld im ganzen Clan, und dieser gab dafür schließlich 7.000 US-Dollar aus. Danach hat der Clan dem Mann um 3.000 US-Dollar ein Tuk-Tuk finanziert, damit er den gefährlichen Weg der Migration nicht noch einmal antritt (DW 3.2021). Diese Art des "Fundraising" (Qaraan) in Somalia und in der Diaspora wird also nicht nur gemacht, um sogenanntes Blutgeld im Fall eines Mordes zu sammeln, sondern auch, um andere Bedürfnisse eines Clanmitglieds abzudecken. Darunter fallen auch Probleme bei der Nahrungsmittelversorgung (Majid 2017, S. 18).
Eine weitere Hilfestellung bieten Remissen aus dem Ausland (BS 2020, S. 29). Remissen sind im Zuge der Covid-19-Pandemie zurückgegangen. Eine Erhebung im November und Dezember 2020 hat gezeigt, dass 22 % der städtischen, 12 % der ländlichen und 6 % der IDP-Haushalte Remissen beziehen. Die Mehrheit der Empfänger berichtete von Rückgängen von über 10 % (IPC 3.2021, S. 2). Nach anderen Angaben sind die Remissen an Privathaushalte während der Pandemie nicht zurückgegangen sondern von 1,3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2019 auf 1,6 Mrd. im Jahr 2020 gestiegen (WB 6.2021, S. 11f). Dabei stellen Remissen einen bedeutenden Anteil des Budgets von Privathaushalten dar. Vor allem für die unteren 40 %, wo Remissen 54 % aller Haushaltsausgaben decken (WB 6.2021, S. 4).
In Krisenzeiten (etwa Hungersnot 2011 und Dürre 2016/17) stellt die Hilfe durch Freunde oder Verwandte die am meisten effiziente und verwendete Bewältigungsstrategie dar. Neben Familie und Clan helfen also auch andere soziale Verbindungen – seien es Freunde, geschlechtsspezifische oder Jugendgruppen, Bekannte, Berufsgruppen oder religiöse Bünde. Meist ist die Unterstützung wechselseitig. Über diese sozialen Netzwerke können auch Verbindungen zwischen Gemeinschaften und Instanzen aufgebaut werden, welche Nahrungsmittel, medizinische Versorgung oder andere Formen von Unterstützung bieten. Auch für IDPs stellen solche Netzwerke die Hauptinformationsquelle dar, wo sie z.B. Unterkunft und Nahrung finden können (DI 6.2019, S. 15ff). Generell ist es auch üblich, Kinder bei engen oder fernen Verwandten unterzubringen, wenn eine Familie diese selbst nicht erhalten kann (SIDRA 6.2019b, S. 4; vgl. Majid 2017, S. 24). 22 % der bei einer Studie befragten IDP-Familien haben Kinder bei Verwandten, 28 % bei institutionellen Pflegeeinrichtungen (7 %) untergebracht. Weitere 28 % schicken Kinder zum Essen zu Nachbarn (OXFAM 6.2018, S. 11f).
In der somalischen Gesellschaft – auch bei den Bantu – ist die Tradition des Austauschs von Geschenken tief verwurzelt. Mit dem traditionellen Teilen werden in dieser Kultur der Gegenseitigkeit bzw. Reziprozität Verbindungen gestärkt. Folglich wurden auch im Rahmen der Dürre 2016/17 die über Geldtransfers zur Verfügung gestellten Mittel und Remissen mit Nachbarn, Verwandten oder Freunden geteilt – wie es die Tradition des Teilens vorsah (DI 6.2019, S. 20f). Selbst Kleinhändlerinnen in IDP-Lagern, die ihre Ware selbst nur auf Kredit bei einem größeren Geschäft angeschafft haben, lassen anschreiben und streichen manchmal die Schulden von noch ärmeren Menschen (RE 19.2.2021). Menschen, die selbst wenig haben, teilen ihre wenigen Habseligkeiten und helfen anderen beim Überleben. Es herrscht eine starke Solidarität (ACCORD 31.5.2021, S. 19).
Die hohe Anzahl an IDPs zeigt aber, dass manche Clans nicht in der Lage sind, der Armut ihrer Mitglieder entsprechend zu begegnen. Vor allem, wenn Menschen in weit von ihrer eigentlichen Clanheimat entfernte Gebiete fliehen, verlieren sie zunehmend an Rückhalt und setzen sich größeren Risiken aus. Eine Ausnahme davon bilden Migranten, die ihren Familien und Freunden mit Remissen helfen können (DI 6.2019, S. 12).
Quellen:
AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (18.4.2021): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2050118/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-_und_abschieberelevante_Lage_in_der_Bundesrepublik_Somalia_%28Stand_Januar_2021%29%2C_18.04.2021.pdf , Zugriff 23.4.2021
ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation / Höhne, Markus / Bakonyi, Jutta (31.5.2021): Somalia - Al-Schabaab und Sicherheitslage; Lage von Binnenvertriebenen und Rückkehrer·innen [sic]; Schutz durch staatliche und nicht-staatliche Akteure; Dokumentation zum COI-Webinar mit Markus Höhne und Jutta Bakonyi am 5. Mai 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2052555/20210531_COI-Webinar+Somalia_ACCORD_Mai+2021.pdf , Zugriff 28.6.2021
BBC - BBC News (2.2.2020): Somalia declares emergency over locust swarms, https://www.bbc.com/news/world-africa-51348517 , Zugriff 20.2.2020
BS - Bertelsmann Stiftung (2020): BTI 2020 - Somalia Country Report, https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_SOM.pdf , Zugriff 4.5.2020
DEVEX / Sara Jerving (13.8.2020): Stigma and weak systems hamper the Somali COVID-19 response, https://www.devex.com/news/stigma-and-weak-systems-hamper-the-somali-covid-19-response-97895 , Zugriff 12.10.2020
DI - Development Initiatives (6.2019): Towards an improved understanding of vulnerability and resilience in Somalia, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Report_Towards-an-improved-understanding-of-vulnerability-and-resilience-in-Somalia.pdf , Zugriff 14.12.2020
DW - Deutsche Welle (3.2021): DW Documentary – Somalia Living with Violence and Terror, verfügbar auf: https://ne-np.facebook.com/aaferroofficial/videos/161693795787317/ , Zugriff 27.7.2021
FAO - UN Food and Agriculture Organization (27.8.2021): Desert Locust situation update 25 August 2021, https://reliefweb.int/report/somalia/desert-locust-situation-update-25-august-2021 , Zugriff 27.8.2021
FAO - UN Food and Agriculture Organization / SWALIM (1.3.2021): Somalia Gu 2021 Rainfall Forecast and Weather Update, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-gu-2021-rainfall-forecast-and-weather-update , Zugriff 9.3.2021
FEWS - Famine Early Warning System Network / FSNAU (4.2.2021): FSNAU FEWS NET 2020 Post Deyr Technical Release, https://www.fsnau.org/node/1854 , Zugriff 9.3.2021
FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit Somalia / FAO (22.9.2021): Early Warning - Early Action: Trends in Risk Factors, Jan 2016 – Aug 2021 (Indicators in Alarm Phanse), https://www.fsnau.org/downloads/Early-Warning-Early-Action-Indicators-progression-Aug-2021_0.pdf , Zugriff 5.10.2021
FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit Somalia / FAO (9.9.2021a): Somalia 2021 Post Gu Food Security and Nutrition Outcomes and Projections, https://fsnau.org/downloads/Somalia-2021-Post-Gu-Seasonal-Food-Security-and-Nutrition-Assessment-Findings-9-Sep-2021.pdf , Zugriff 5.10.2021
FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit Somalia / FEWS NET (17.5.2021): Food Security & Nutrition, Quarterly Brief with a Focus on the 2021 Jiaal Impact and Gu Season Early Warning, https://fsnau.org/downloads/FSNAU-Quarterly-Brief-May-2021.pdf , Zugriff 1.7.2021
FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit Somalia / FAO (4.2.2021): Somalia 2020 Post Deyr Seasonal Food Security and Nutrition Assessment, https://www.fsnau.org/node/1859 , Zugriff 9.3.2021
FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit Somalia / FAO (3.2.2020a): Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary, https://www.fsnau.org/downloads/2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results-February-2020.pdf , Zugriff 20.2.2020
FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit Somalia / FAO (3.2.2020c): Post Deyr Technical Release, https://www.fsnau.org/downloads/FSNAU-FEWS%20NET-2019-Post-Deyr-Technical-Release.pdf , Zugriff 20.2.2020
FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit Somalia / FAO (o.D.): IPC Maps, https://www.fsnau.org/ipc/ipc-map , Zugriff 5.10.2021
Funk - Funk, Chris / The Conversation (4.10.2021): Scientists sound the alarm over drought in East Africa: what must happen next, https://theconversation.com/scientists-sound-the-alarm-over-drought-in-east-africa-what-must-happen-next-168095 , Zugriff 11.10.2021
GO - Garowe Online (6.10.2021): Amid Al-Shabaab menace, draught hits Somalia’s Jubaland, https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/amid-al-shabaab-menace-draught-hits-somalia-s-jubaland , Zugriff 13.10.2021
HIPS - The Heritage Institute for Policy Studies (2021): State of Somalia Report 2020, Year in Review, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SOS-REPORT-2020-Final-2.pdf , Zugriff 12.2.2021
HIPS - The Heritage Institute for Policy Studies (2020): State of Somalia Report 2019, Year in Review, http://www.heritageinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/HIPS_2020-SOS-2019-Report-English-Version.pdf , Zugriff 17.3.2021
IPC - Integrated Food Security Phase (3.2021): Somalia – IPC Acute Food Insecurity and Acute Malnutrition Analysis January-June 2021, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-ipc-acute-food-insecurity-and-acute-malnutrition-analysis-january-june , Zugriff 9.3.2021
Majid - Majid, Nisar / Abdirahman, Khalif / Hassan, Shamsa (2017): Remittances and Vulnerability in Somalia. Assessing Sources, Uses and Delivery Mechanisms, http://documents1.worldbank.org/curated/en/633401530870281332/pdf/Remittances-and-Vulnerability-in-Somalia-Resubmission.pdf , Zugriff 22.7.2021
ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021
OXFAM / REACH (6.2018): Drought, Displacement and Livelihoods in Somalia/Somaliland. Time for gender-sensitive and protection-focused approaches, http://regionaldss.org/wp-content/uploads/2018/07/bn-somalia-somaliland-drought-displacement-protection-280618-en-002.pdf , Zugriff 26.1.2021
PGN - Political Geography Now (2.2021): Somalia Control Map & Timeline - February 2021, per e-Mail, mit Zugriffsberechtigung verfügbar auf: https://www.polgeonow.com/2021/02/somalia-control-map-2021.html
PGN - Political Geography Now (10.2020): Somalia Control Map & Timeline - October 2020, per e-Mail, mit Zugriffsberechtigung verfügbar auf: https://www.polgeonow.com/2020/10/somalia-map-of-al-shabaab-control.html
RD - Radio Dalsan (14.3.2021): AU troops deliver water and foodstuffs to residents of Bura Hache in Somalia, https://www.radiodalsan.com/en/2021/03/14/au-troops-deliver-water-and-foodstuffs-to-residents-of-bura-hache-in-somalia/ , Zugriff 15.3.2021
RE - Radio Ergo (19.2.2021): Somali IDP women in Beletweyne set up businesses to educate their children, https://radioergo.org/en/2021/02/19/somali-idp-women-in-beletweyne-set-up-businesses-to-educate-their-children/ , Zugriff 3.3.2021
RI - Refugees International (12.2019): Durable Solutions in Somalia, Moving from Policies to Practice for IDPs in Mogadishu, https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/5dfa4e11ba6ef66e21fbfd17/1576685091236/Mark+-+Somalia+-+2.0.pdf , Zugriff 28.1.2021
SIDRA - Somali Institute for Development Research and Analysis (6.2019a): The Idle Youth Labor Force in Somalia: A blow to the Country’s GDP, https://sidrainstitute.org/2019/06/30/the-idle-youth-labor-force-in-somalia-a-blow-to-the-countrys-gdp/ , Zugriff 8.10.2020
SIDRA - Somali Institute for Development Research and Analysis (6.2019b): Rape: A rising Crisis and Reality for the Women in Somalia, https://sidrainstitute.org/wp-content/uploads/2019/06/Rape-Policy-Brief.pdf , Zugriff 17.3.2021
TG - The Guardian (8.7.2019): In Somalia, the climate emergency is already here. The world cannot ignore it, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/08/somalia-climate-emergency-world-drought-somalis , Zugriff 26.1.2021
UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (7.2021): Somalia Humanitarian Bulletin, July 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2058109/Somalia_+Humanitarian+Bulletin_July+2021_Final.pdf , Zugriff 27.8.2021
UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (17.6.2021): Somalia Humanitarian Bulletin, May 2021, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Somalia_%20Humanitarian%20Bulletin_May%202021_final.pdf , Zugriff 30.6.2021
UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (26.5.2021): Somalia - 2021 Gu’ Season Floods Update #3 - As of 26 May 2021, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-2021-gu-season-floods-update-3-26-may-2021 , Zugriff 30.6.2021
UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (9.3.2021): Somalia – Overview of Water Shortages, https://reliefweb.int/report/somalia/ocha-somalia-overview-water-shortages-09-march-2021 , Zugriff 11.3.2021
UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (27.1.2021): Somalia – Humanitarian Dashboard – December 2020, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-humanitarian-dashboard-december-2020-27-january-2021 , Zugriff 9.3.2021
UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (1.2021): Somalia Humanitarian Bulletin, January 2021, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-humanitarian-bulletin-january-2021-enso , Zugriff 9.3.2021
UNSC - UN Security Council (19.5.2021): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2021/485], https://www.ecoi.net/en/file/local/2052226/S_2021_485_E.pdf , Zugriff 21.6.2021
UNSC - UN Security Council (17.2.2021): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2021/154], https://www.ecoi.net/en/file/local/2046029/S_2021_154_E.pdf , Zugriff 2.3.2021
UNSC - UN Security Council (13.11.2020): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2020/1113], https://www.ecoi.net/en/file/local/2041334/S_2020_1113_E.pdf , Zugriff 2.12.2020
UNSC - UN Security Council (13.8.2020): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2020/798], https://www.ecoi.net/en/file/local/2036555/S_2020_798_E.pdf , Zugriff 9.10.2020
UNSC - UN Security Council (13.5.2020): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2020/398], https://www.ecoi.net/en/file/local/2030188/S_2020_398_E.pdf , Zugriff 13.10.2020
UNSC - UN Security Council (13.2.2020): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2020/121], https://www.ecoi.net/en/file/local/2025872/S_2020_121_E.pdf , Zugriff 26.3.2020
UNSOM - United Nations Assistance Mission in Somalia (31.1.2021): On visit to Baidoa, Humanitarian Coordinator Highlights Needs for ‘Long-term Durable Solutions’ for Internally Displaced Persons, https://unsom.unmissions.org/visit-baidoa-humanitarian-coordinator-highlights-needs-%E2%80%98long-term-durable-solutions%E2%80%99-internally , Zugriff 3.3.2021
USAID - US Agency for International Development [USA] (8.1.2021): Somalia - Complex Emergency Fact Sheet #1, Fiscal Year (FY) 2021, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-complex-emergency-fact-sheet-1-fiscal-year-fy-2021-january-8-2021 , Zugriff 9.3.2021
USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021
WB - Weltbank (6.2021): Somalia Economic Update. Investing in Health to Anchor Growth, http://documents1.worldbank.org/curated/en/926051631552941734/pdf/Somalia-Economic-Update-Investing-in-Health-to-Anchor-Growth.pdf , Zugriff 15.9.2021
WFP - World Food Programme (6.10.2021): WFP Somalia Country Brief, August 2021, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Somalia%20Country%20Brief%20August%20.pdf , Zugriff 11.10.2021
Rückkehrspezifische Grundversorgung
Letzte Änderung: 08.07.2021
Einkommen: Somalis aus der Diaspora - aus Europa oder den USA - die freiwillig zurückkehren, nehmen oft keine Hilfspakete in Anspruch, sondern kehren einfach zurück. Viele der Rückkehrer aus Kenia und dem Jemen gehen in die großen Städte Kismayo, Mogadischu und Baidoa, weil sie sich dort bessere ökonomische Möglichkeiten erwarten (ACCORD 31.5.2021, S. 24). Der UNHCR hat über drei Jahre mehr als 2.000 Haushalte mit fast 12.000 Angehörigen – darunter vor allem unterstützte Rückkehrer aus Kenia, Äthiopien und dem Jemen – zu ihrer Situation in Somalia befragt. Insgesamt haben 66 % der Rückkehrerhaushalte angegeben, dass ihr Einkommen nicht ausreicht. Dies wird vor allem auf mangelnde Jobmöglichkeiten zurückgeführt; seit der Pandemie 2020 auch auf rückläufige Remissen. Die meisten Rückkehrer leben von Einkommen als Taglöhner oder als Selbstständige sowie von humanitärer Hilfe (UNHCR 31.5.2021, S. 4).
Nach anderen Angaben ist Somalia auf eine Rückkehr von Flüchtlingen in großem Ausmaß nicht vorbereitet, und es kann davon ausgegangen werden, dass sich ein erheblicher Teil der Rückkehrer als IDPs wiederfinden wird (ÖB 3.2020, S. 14). Arbeitslose Rückkehrer im REINTEG-Programm (siehe unten) berichten über mangelnde Möglichkeiten; über eingeschränkte Erfahrungen, Fähigkeiten und Informationen über den Arbeitsmarkt. Nur 30 % der REINTEG-Rückkehrer sind mit ihrer ökonomischen Situation zufrieden, viele klagen über niedriges Einkommen und lange Arbeitsstunden (IOM 3.12.2020). Dabei ist wirtschaftliche Unabhängigkeit für viele Rückkehrer im REINTEG-Programm ein Hauptthema (IOM 9.3.2021b). Viele von ihnen sind diesbezüglich Druck seitens ihrer Familie ausgesetzt – v.a. wenn sie aufgrund ihrer „abgebrochenen“ Migration noch Schulden offen haben (IOM 9.3.2021b; vgl. ACCORD 31.5.2021, S. 24). Manche Rückkehrer gehen deshalb explizit nicht in Regionen, wo Mitglieder des eigenen Clans leben (ACCORD 31.5.2021, S. 24).
Laut einer Quelle muss eine nach Mogadischu zurückgeführte Person nicht damit rechnen, ohne Angehörige zu verhungern. Selbst wenn jemand tatsächlich überhaupt niemanden kennen sollte, dann würde diese Person in ein IDP-Lager gehen und dort in irgendeiner Form Hilfe bekommen. Die Person ist auf Mitleid angewiesen; Hilfe findet sich vielleicht auch in einer Moschee. Jedenfalls würde eine solche Person so schnell wie möglich versuchen, dorthin zu gelangen, wo sich ein Familienmitglied befindet. Dass gar keine Familie existiert, ist sehr unwahrscheinlich (ACCORD 31.5.2021, S. 37).
Unterstützung / Netzwerk: Der Jilib [Anm.: untere Ebene im Clansystem] ist unter anderem dafür verantwortlich, Mitglieder in schwierigen finanziellen Situationen zu unterstützen. Das traditionelle Recht (Xeer) bildet hier ein soziales Sicherungsnetz, eine Art der Sozial- und Unfallversicherung. Wenn eine Person Unterstützung braucht, dann wendet sie sich an den Jilib oder – je nach Ausmaß – an untere Ebenen (z.B. Großfamilie) (SEM 31.5.2017, S. 5/31f). Jedenfalls versucht die Mehrheit der Rückkehrer in eine Region zu kommen, wo zumindest Mitglieder ihres Clans leben (ACCORD 31.5.2021, S. 24), denn eine erfolgreiche Rückkehr und Reintegration kann in erheblichem Maße von der Clanzugehörigkeit bzw. von lokalen Beziehungen der rückkehrenden Person abhängig sein. Rückkehrer ohne Clan- oder Familienverbindungen am konkreten Ort der Rückkehr finden sich ohne Schutz in einer Umgebung wieder, in der sie oftmals als Fremde angesehen werden (ÖB 3.2020, S. 14). Nach anderen Angaben ist es bei einer Rückkehr weniger entscheidend, ob jemand Verwandte hat oder nicht. Entscheidend ist vielmehr, wie diese persönlichen Verwandtschaftsbeziehungen funktionieren und ob sie aktiv sind, ob sie gepflegt wurden. Denn Solidarität wird nicht bedingungslos gegeben. Wer sich lange nicht um seine Beziehungen gekümmert hat, wer einen (gesellschaftlichen) Makel auf sich geladen hat oder damit behaftet ist, der kann - trotz vorhandener Verwandtschaft - nicht uneingeschränkt auf Solidarität und Hilfe hoffen (ACCORD 31.5.2021, S. 39f).
Auch in Mogadischu sind Freundschaften und Clannetzwerke sehr wichtig. Zur Aufnahme kleinerer oder mittelgroßer wirtschaftlicher Aktivitäten ist aber kein Netzwerk notwendig (FIS 7.8.2020, S. 39). Insgesamt herrschen am Arbeitsmarkt Nepotismus und Korruption (SIDRA 6.2019a, S. 5).
Unterstützung extern: Für Rückkehrer aus dem Jemen (LIFOS 3.7.2019, S. 63) und Kenia gibt es seitens des UNHCR Rückkehrpakete (ACCORD 31.5.2021, S. 23) bzw. finanzielle Unterstützung. Bei Ankunft in Somalia bekommt jede Person eine Einmalzahlung von 200 US-Dollar, danach folgt eine monatliche Unterstützung von 200 US-Dollar pro Haushalt und Monat für ein halbes Jahr. Das World Food Programm gewährleistet für ein halbes Jahr eine Versorgung mit Nahrungsmitteln. Für Schulkosten werden 25 US-Dollar pro Monat und Schulkind ausbezahlt. Bei Erfüllung bestimmter Kriterien wird für die Unterkunft pro Haushalt eine Summe von 1.000 US-Dollar zur Verfügung gestellt (UNHCR 30.9.2018, S. 6; vgl. LIFOS 3.7.2019, S. 63), die etwa zur Organisation einer Unterkunft dienen können (LIFOS 3.7.2019, S. 63). Deutschland unterstützt in Jubaland ein Vorhaben, das der Vorbereitung der aufnehmenden Gemeinden für freiwillige Rückkehrer dient (AA 2.4.2020, S. 22). IOM hat über die von der EU finanzierte EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration seit März 2017 knapp 6.500 Rückkehrer bei der freiwilligen Rückkehr nach Somalia unterstützt. Fast 12.000 Rückkehrer erhielten Unterstützung nach ihrer Ankunft in Somalia (IOM 8.3.2021). Der UNHCR unterstützt ausgewählte Haushalte in unterschiedlichen Teilen Somalias mit Ausbildungs-, Schulungs- und finanziellen Maßnahmen (UNHCR 27.6.2021, S. 9).
Rückkehrprogramme: In das europäische Programm zur freiwilligen Rückkehr ERRIN (European Return and Reintegration Network) wurde mit November 2019 auch die Destination Somalia aufgenommen. Umgesetzt wird das Programm vor Ort von der Organisation IRARA (International Return and Reintegration Assistance) mit Büro in Mogadischu. Das Programm umfasst – neben den direkt von Österreich zur Verfügung gestellten Mitteln – pro Rückkehrer 200 Euro Bargeld sowie 2.800 Euro Sachleistungen. Letztere umfassen (je nach Wunsch des Rückkehrers) eine vorübergehende Unterbringung, medizinische und soziale Unterstützung, Beratung in administrativen und rechtlichen Belangen, Unterstützung bei der Gründung eines Kleinunternehmens sowie schulische und berufliche Bildung (BMI 8.11.2019). Neben Mogadischu hat IRARA Standorte in Kismayo, Baidoa und Belet Weyne. Laut IRARA werden nicht nur freiwillige Rückkehrer, sondern auch abgewiesene Asylwerber, irreguläre Migranten, unbegleitete Minderjährige und andere vulnerable Gruppen unterstützt und vom Programm abgedeckt. Bei Ankunft bietet IRARA Abholung vom Flughafen; Unterstützung bei der Weiterreise; temporäre Unterkunft (sieben Tage); medizinische Betreuung; Grundversorgung. Zur Reintegration wird ein maßgeschneiderter Plan erstellt, der folgende Maßnahmen enthalten kann: soziale, rechtliche und medizinische Unterstützung; langfristige Unterstützung bei der Unterkunft; Bildung; Hilfe bei der Arbeitssuche; Berufsausbildung; Unterstützung für ein Start-up; Unterstützung für vulnerable Personen (IRARA o.D.a).
Das ebenfalls von der EU finanzierte Programm REINTEG bietet freiwilligen Rückkehrern – je nach Bedarf – medizinische und psycho-soziale Unterstützung; Bildung für Minderjährige; Berufstraining und Ausbildung, um ein Kleinunternehmen zu starten; die Grundlage für eine Arbeit, die ein eigenes Einkommen bringt; und Unterstützung bei Unterkunft und anderen grundlegenden Bedürfnissen. Durchschnittlich waren die REINTEG-Rückkehrer zwei Jahre lang weg aus Somalia (IOM 3.12.2020). Für Rückkehrer im REINTEG-Programm hat IOM im Mai 2020 eine Hotline eingerichtet. Rückkehrer melden sich dort, um etwa Fragen hinsichtlich der Zeitpläne zur ökonomischen Reintegration beantwortet zu bekommen, oder um hinsichtlich ihrer Mikro-Unternehmen oder auch z.B. für psycho-soziale oder medizinische Unterstützung anzusuchen (IOM 9.3.2021b). Nachdem schon im Jahr 2019 in Hargeysa erfolgreich ein Rückkehrer-Komitee für REINTEG eingerichtet worden war, wurde ein solches 2020 auch in Mogadischu gebildet. Die ebenfalls aus Rückkehrern zusammengesetzten Komitees unterstützen Rückkehrer nach ihrer Ankunft. Sie teilen Informationen und Netzwerke und stellen Kontakt zu relevanten Organisationen und Reintegrationsprojekten her (IOM 3.12.2020).
Unterkunft: Der Zugang zu einer Unterkunft oder zu Bildung wird von Rückkehrern im REINTEG-Programm als problematisch beschrieben (IOM 3.12.2020). Der Immobilienmarkt in Mogadischu boomt, die Preise sind gestiegen (BS 2020, S. 25). In den „besseren“ Bezirken der Stadt, wo es größere Sicherheitsvorkehrungen gibt – z.B. Waaberi, Medina, Hodan oder das Gebiet am Flughafen – kostet die Miete eines einfachen Raumes mit 25 m² 50-100 US-Dollar pro Monat. Am Stadtrand – z.B. in Heliwaa oder am Viehmarkt – sind die Preise leistbarer. Der Kubikmeter Wasser wird um 1-1,5 US-Dollar verkauft (FIS 7.8.2020, S. 31). Es gibt keine eigenen Lager für Rückkehrer, daher siedeln sich manche von ihnen in IDP-Lagern an (LIFOS 3.7.2019, S. 63; vgl. AA 18.4.2021, S. 22); nach anderen Angaben finden sich viele der Rückkehrer aus dem Jemen und aus Kenia schlussendlich in IDP-Lagern wieder (ACCORD 31.5.2021, S. 24). Gemäß der bereits weiter oben erwähnten Rückkehrer-Studie des UNHCR haben hingegen nur 19 % der mehr als 2.000 befragten Rückkehrerhaushalte angegeben, in einem IDP-Lager zu wohnen (UNHCR 31.5.2021, S. 2).
Vom Returnee Management Office (RMO) der somalischen Immigrationsbehörde kann gegebenenfalls eine Unterkunft und ein inner-somalischer Weiterflug organisiert und bezahlt werden, die Rechnung ist vom rückführenden Staat zu begleichen. Generell mahnen Menschenrechtsorganisationen, dass sich Rückkehrer in einer prekären Situation befinden und die Grundvoraussetzungen für eine freiwillige Rückkehr nicht gewährleistet sind (AA 2.4.2020, S. 22f). Grundsätzlich braucht es zur Anmietung eines Objektes einen Bürgen, der vor Ort bekannt ist. Dies ist i.d.R. ein Mann. Für eine alleinstehende Frau gestaltet sich die Wohnungssuche dementsprechend schwierig, dies ist kulturell unüblich und wirft unter Umständen Fragen auf (FIS 7.8.2020, S. 32).
Frauen und Minderheiten: Prinzipiell gestaltet sich die Rückkehr für Frauen schwieriger als für Männer. Eine Rückkehrerin ist auf die Unterstützung eines Netzwerks angewiesen, das in der Regel enge Familienangehörige – geführt von einem männlichen Verwandten – umfasst. Für alleinstehende Frauen ist es mitunter schwierig, eine Unterkunft zu mieten oder zu kaufen (FIS 5.10.2018, S. 23). Auch für Angehörige von Minderheiten – etwa den Bantus – gestaltet sich eine Rückkehr schwierig. Ein Mangel an Netzwerken schränkt z.B. den Zugang zu humanitärer Hilfe ein (LIFOS 19.6.2019, S. 8). Für eine weibliche Angehörige von Minderheiten, die weder Aussicht auf familiäre noch Clanunterstützung hat, stellt eine Rückkehr tatsächlich eine Bedrohung dar (ÖB 3.2020, S. 11).
Quellen:
AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (18.4.2021): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2050118/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-_und_abschieberelevante_Lage_in_der_Bundesrepublik_Somalia_%28Stand_Januar_2021%29%2C_18.04.2021.pdf , Zugriff 23.4.2021
ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation / Höhne, Markus / Bakonyi, Jutta (31.5.2021): Somalia - Al-Schabaab und Sicherheitslage; Lage von Binnenvertriebenen und Rückkehrer·innen [sic]; Schutz durch staatliche und nicht-staatliche Akteure; Dokumentation zum COI-Webinar mit Markus Höhne und Jutta Bakonyi am 5. Mai 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2052555/20210531_COI-Webinar+Somalia_ACCORD_Mai+2021.pdf , Zugriff 28.6.2021
BMI - Bundesministerium für Inneres [Österreich] (8.11.2019): ERRIN Reintegrationsprojekt Somalia und Somaliland ab 8. November 2019, per e-Mail
BS - Bertelsmann Stiftung (2020): BTI 2020 - Somalia Country Report, https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_SOM.pdf , Zugriff 4.5.2020
FIS - Finnish Immigration Service [Finnland] (7.8.2020): Somalia: Fact-Finding Mission to Mogadishu in March 2020, https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf/2f51bf86-ac96-f34e-fd02-667c6ae973a0/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf?t=1602225617645 , Zugriff 17.3.2021
FIS - Finnish Immigration Service [Finnland] (5.10.2018): Somalia: Fact-Finding Mission to Mogadishu and Nairobi, January 2018, https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia_Fact_Finding+Mission+to+Mogadishu+and+Nairobi+January+2018.pdf/2abe79e2-baf3-0a23-97d1-f6944b6d21a7/Somalia_Fact_Finding+Mission+to+Mogadishu+and+Nairobi+January+2018.pdf , Zugriff 17.3.2021
IOM - Internationale Organisation für Migration (9.3.2021b): ‘Returnees can Call us from Sunday to Thursday during Working Hours’, https://migrationjointinitiative.org/news/returnees-can-call-us-sunday-thursday-during-working-hours , Zugriff 11.3.2021
IOM - Internationale Organisation für Migration (8.3.2021): Eintrag auf Twitter, 8:15, https://twitter.com/IOM_Somalia/status/1368822542157438979/photo/1 , Zugriff 11.3.2021
IOM - Internationale Organisation für Migration (3.12.2020): How Peer Support Can Assist Returnees to Breathe Easy, https://migrationjointinitiative.org/news/how-peer-support-can-assist-returnees-breathe-easy , Zugriff 11.3.2021
IRARA - International Return and Reintegration Assistance (o.D.a): Country Leaflets – Somalia, https://www.irara.org/leaflets/ , Zugriff 11.3.2021
LIFOS - Lifos/Migrationsverket [Schweden] (19.6.2019): Minoritetsgruppen bantu i Somalia Version 1.0, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=43198 , Zugriff 2.2.2021
LIFOS - Lifos/Migrationsverket [Schweden] (3.7.2019): Säkerhetssituationen i Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2015777/190827400.pdf , Zugriff 17.3.2021
ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021
SEM - Staatssekretariat für Migration [Schweiz] (31.5.2017): Focus Somalia – Clans und Minderheiten, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/som/SOM-clans-d.pdf , Zugriff 10.12.2020
SIDRA - Somali Institute for Development Research and Analysis (6.2019a): The Idle Youth Labor Force in Somalia: A blow to the Country’s GDP, https://sidrainstitute.org/2019/06/30/the-idle-youth-labor-force-in-somalia-a-blow-to-the-countrys-gdp/ , Zugriff 8.10.2020
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (27.6.2021): UNHCR Somalia: Operational Update 1-31 May 2021, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Somalia%20Operational%20Update%20-%20May%202021.pdf , Zugriff 1.7.2021
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (31.5.2021): Somalia Post Return Monitoring Snapshot Round 5 | MAY 2021, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PRM%20Snapshot%20May%202021.pdf , Zugriff 1.7.2021
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (30.9.2018): Operational Update Somalia 1-30 September 2018, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/66704.pdf , Zugriff 21.6.2019
Medizinische Versorgung
Süd-/Zentralsomalia, Puntland
Letzte Änderung: 21.10.2021
Das somalische Gesundheitssystem ist das zweitfragilste weltweit (WB 6.2021, S. 32). Die medizinische Versorgung ist im gesamten Land äußerst mangelhaft (AA 18.4.2021, S. 23). Die Infrastruktur bei der medizinischen Versorgung ist minimal und beschränkt sich meist auf Städte und sichere Gebiete (HIPS 5.2020, S. 38). Die Ausrüstung reicht nicht, um auch nur die grundlegendsten Bedürfnisse der Bevölkerung ausreichend abdecken zu können (HIPS 5.2020, S. 38; vgl. AA 3.12.2020). Es mangelt an Geld, Personal, Referenzsystemen, Diagnoseeinrichtungen, an Ausbildungseinrichtungen, Regulierungen und Managementfähigkeiten (HIPS 5.2020, S. 38). 2021 betrug das Budget des Gesundheitsministeriums 33,6 Millionen US-Dollar (AI 18.8.2021, S. 19). Allerdings zeigt sich in Aufwärtstrend: 2020 wurden 1,3 % des Budgets für den Gesundheitsbereich ausgegeben, 2021 wurden dafür 5 % veranschlagt (WB 6.2021, S. 19).
Dennoch zählt die Gesundheitslage zu den schlechtesten der Welt (ÖB 3.2020, S. 15). Die durchschnittliche Lebenserwartung ist zwar von 45,3 Jahren im Jahr 1990 auf heute 57,1 Jahre beträchtlich gestiegen, bleibt aber immer noch niedrig (WB 6.2021, S. 29). Erhebliche Teile der Bevölkerung haben keinen Zugang zu trinkbarem Wasser oder zu hinreichenden sanitären Einrichtungen (AA 18.4.2021, S. 23); daran sterben jährlich 87 von 100.000 Einwohnern (Äthiopien: 44) (HIPS 5.2020, S. 24). Die Quoten von Mütter- und Säuglingssterblichkeit sind unter den höchsten Werten weltweit (AA 18.4.2021, S. 23). Eine von zwölf Frauen stirbt während der Schwangerschaft, eines von sieben Kindern vor dem fünften Geburtstag (Äthiopien: 17). Bei der hohen Kindersterblichkeit schwingt Unterernährung bei einem Drittel der Todesfälle als Faktor mit (ÖB 3.2020, S. 15; vgl. HIPS 5.2020, S. 21ff). Selbst in Somaliland und Puntland werden nur 44 % bzw. 38 % der Mütter von qualifizierten Geburtshelfern betreut (ÖB 3.2020, S. 15). Al Shabaab hat die medizinische Versorgung eingeschränkt – etwa durch die Behinderung zivilen Verkehrs, die Vernichtung von Medikamenten und die Schließung von Kliniken (USDOS 11.3.2020, S.14). Insgesamt haben nur ca. 15 % der Menschen in ländlichen Gebieten Zugang zu medizinischer Versorgung (AI 18.8.2021, S. 5). Die Rate an grundlegender Immunisierung für Kinder liegt bei Nomaden bei 1 %, in anderen ländlichen Gebieten bei 14 %, in Städten bei 19 % (WB 6.2021, S. 31). Zudem gibt es für medizinische Leistungen und pharmazeutische Produkte keinerlei Qualitäts- oder Sicherheitsstandards (WB 6.2021, S. 27).
Es mangelt an Personal für die medizinische Versorgung. Besonders akut ist der Mangel an Psychiatern, an Technikern für medizinische Ausrüstung und an Anästhesisten. Am größten aber ist der Mangel an einfachen Ärzten (HIPS 5.2020, S. 42). Insgesamt kommen auf 100.000 Einwohner nur zwei im medizinischen Bereich ausgebildete Personen (Standard weltweit: 25 pro 100.000) (UNOCHA 31.3.2020, S. 2). Nach anderen Angaben kommen auf 10.000 Einwohner 4,28 medizinisch ausgebildete Personen (Subsaharaafrika: 13,3; WHO-Ziel: 25) (WB 6.2021, S. 34). Nach wieder anderen Angaben kommen auf 100.000 Einwohner fünf Ärzte, vier Krankenpfleger und eine Hebamme. Dabei herrscht jedenfalls eine Ungleichverteilung: In Puntland gibt es 356 Ärzte, in Jubaland nur 54 und in Galmudug und im SWS je nur 25 (HIPS 5.2020, S. 27/44ff). Die Weltbank hat das mit 100 Millionen US-Dollar dotierte "Improving Healthcare Services in Somalia Project / Damal Caafimaad" genehmigt. Damit soll die Gesundheitsversorgung für ca. 10 % der Gesamtbevölkerung Somalias, namentlich in Gebieten von Nugaal (Puntland), Bakool und Bay (SWS), Hiiraan und Middle Shabelle verbessert werden (WB 22.7.2021).
In Benadir gibt es 61 Gesundheitseinrichtungen, in HirShabelle 81. In anderen Bundesstaaten stehen folgende Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung (HIPS 5.2020, S. 39ff):
Nach anderen Angaben gibt es in ganz Somalia 11 öffentliche und 50 andere Spitäler. In Mogadischu gibt es 4 öffentliche und 46 andere Gesundheitszentren (FIS 7.8.2020, S. 31). Jedenfalls müssen Patienten oft lange Wegstrecken zurücklegen, um an medizinische Versorgung zu gelangen (HIPS 5.2020, S. 39). In Mogadischu gibt es mindestens zwei Spitäler, die für jedermann zugänglich sind. In manchen Spitälern kann bei Notlage über die Ambulanzgebühr verhandelt werden (FIS 5.10.2018, S. 36). Im Gegensatz zu Puntland werden in Süd-/Zentralsomalia Gesundheitseinrichtungen vorwiegend von internationalen NGOs unter Finanzierung von Gebern betrieben (HIPS 5.2020, S. 39). Das Keysaney Hospital wird von der Somali Red Crescent Society (SRCS) betrieben. Zusätzlich führt die SRCS Rehabilitationszentren in Mogadischu und Galkacyo (SRCS 2020, S. 8). Die Spitäler Medina und Keysaney (Mogadischu) sowie in Kismayo und Baidoa werden vom Roten Kreuz unterstützt (ICRC 7.2020). Das Rote Kreuz unterstützt die Somali Red Crescent Society beim Betrieb von 29 Erstversorgungseinrichtungen (20 feste und 9 mobile Kliniken). Auch vier Spitäler mit insgesamt 410 Betten in Mogadischu (Keysaney, Medina), Baidoa und Kismayo werden unterstützt (ICRC 13.9.2019). Insgesamt gibt es im Land nur 5,34 stationäre Krankenhausbetten pro 10.000 Einwohnern (WHO-Ziel: 25 Betten) (WB 6.2021, S. 34).
Allerdings sind die öffentlichen Krankenhäuser mangelhaft ausgestattet (AA 18.4.2021, S. 23; vgl. FIS 7.8.2020, S. 31f), was Ausrüstung/medizinische Geräte, Medikamente, ausgebildete Kräfte und Finanzierung angeht (AA 18.4.2021, S. 23). Dabei ist der Standard von Spitälern außerhalb Mogadischus erheblich schlechter (FIS 5.10.2018, S. 36). Zudem bietet die Mehrheit der Krankenhäuser nicht alle Möglichkeiten einer tertiären Versorgung (HIPS 5.2020, S. 38). Speziellere medizinische Versorgung – etwa Chirurgie – ist nur eingeschränkt verfügbar – in öffentlichen Einrichtungen fast gar nicht, unter Umständen aber in privaten. So werden selbst am Banadir Hospital – einem der größten Spitäler des Landes, das über vergleichsweise gutes Personal verfügt und auch Universitätsklinik ist – nur einfache Operationen durchgeführt (FIS 5.10.2018, S. 35). Relativ häufig müssen daher Patienten von öffentlichen Einrichtungen an private verwiesen werden (FIS 7.8.2020, S. 31). Immerhin stellt der private Sektor 60 % aller Gesundheitsleistungen und 70 % aller Medikamente. Und auch in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen wird der Großteil der Dienste über NGOs erbracht (WB 6.2021, S. 27f).
Die Primärversorgung wird oftmals von internationalen Organisationen bereitgestellt und ist für Patienten kostenfrei. Allerdings muss manchmal für Medikamente bezahlt werden (FIS 5.10.2018, S. 35f; vgl. ACCORD 31.5.2021, S. 20). Oft handelt es sich bei dieser Primärversorgung um sogenannte "Mother Health Clinics", von welchen es in Somalia relativ viele gibt. Diese werden von der Bevölkerung als Gesamtgesundheitszentren genutzt, weil dort die Diagnosen eben kostenlos sind (ACCORD 31.5.2021, S. 20). Private Einrichtungen, die spezielle Leistungen anbieten, sind sehr teuer. Schon ein kleiner operativer Eingriff kostet 100 US-Dollar. Am Banadir-Hospital in Mogadischu wird eine Ambulanzgebühr von 5-10 US-Dollar eingehoben, die Behandlungsgebühr an anderen Spitälern beläuft sich auf 5-12 US-Dollar. Medikamente, die Kindern oder ans Bett gebundenen Patienten verabreicht werden, sind kostenlos. Üblicherweise sind die Kosten für eine Behandlung aber vom Patienten zu tragen (FIS 5.10.2018, S. 35f). Am türkischen Spital in Mogadischu, das als öffentliche Einrichtung wahrgenommen wird, werden nur geringe Kosten verrechnet, arme Menschen werden gratis behandelt (MoH/DIS 27.8.2020, S. 73). Generell gilt, wenn z.B. ein IDP die Kosten nicht aufbringen kann, wird er in öffentlichen Krankenhäusern auch umsonst behandelt. Zusätzlich kann man sich auch an Gesundheitseinrichtungen wenden, die von UN-Agenturen betrieben werden. Bei privaten Einrichtungen sind alle Kosten zu bezahlen (FIS 7.8.2020, S. 31/37). Es gibt keine Krankenversicherung (MoH/DIS 27.8.2020, S. 73); nach anderen Angaben ist diese so gut wie nicht existent, im Jahr 2020 waren nur 2 % der Haushalte hinsichtlich Ausgaben für Gesundheit versichert (WB 6.2021, S. 34).
Aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten musste die SRCS ihre mobilen und stationären Kliniken von 129 auf 72 reduzieren (57 stationäre und 15 mobile). Als Ziel wird die Abdeckung des Bedarfs von rund 1,6 Millionen Menschen angegeben. Im Jahr 2019 konnten mehr als 850.000 Patienten behandelt werden. Davon waren 45 % Kinder und 40 % Frauen. Die häufigsten Behandlungen erfolgten in Zusammenhang mit akuten Atemwegserkrankungen (26 %), Durchfallerkrankungen (9,2 %), Anämie (13 %), Hautkrankheiten (5,2 %), Harnwegsinfektionen (11,6 %) und Augeninfektionen (4,4 %) (SRCS 2020, S. 9f). Die am öftesten diagnostizierten chronischen Krankheiten sind Diabetes und Bluthochdruck (WB 6.2021, S. 30).
Versorgungs- und Gesundheitsmaßnahmen internationaler Hilfsorganisationen mussten auch immer wieder wegen Kampfhandlungen oder aufgrund von Anordnungen unterbrochen werden (AA 18.4.2021, S. 23).
Psychiatrie: Es gibt in ganz Süd-/Zentralsomalia und Puntland nur einen Psychiater, elf Sozialarbeiter für psychische Gesundheit sowie 19 Pflegekräfte. Folgende psychiatrische Einrichtungen sind bekannt (WHO Rizwan 8.10.2020):
An psychiatrischen Spitälern gibt es nur zwei, und zwar in Mogadischu; daneben gibt es drei entsprechende Abteilungen an anderen Spitälern und vier weitere Einrichtungen. Dabei gibt es eine hohe Rate an Personen mit posttraumatischer Belastungsstörung (WHO Rizwan 8.10.2020). Psychische Probleme werden durch den bestehenden Konflikt und den durch Instabilität, Arbeits- und Hoffnungslosigkeit verursachten Stress gefördert. Schätzungen zufolge sind 30 % der Bevölkerung betroffen (FIS 5.10.2018, S. 34; vgl. ÖB 3.2020, S. 16), die absolute Zahl wird mit 1,9 Millionen Betroffenen beziffert (HIPS 5.2020, S. 26). Nach anderen Angaben (Stand 2020) wurden bei 4,3 % der Bevölkerung durch einen Arzt eine Geisteskrankheit diagnostiziert während man von einer Verbreitung von 14 % ausgeht (WB 6.2021, S. 31).
Psychisch Kranken haftet meist ein mit Diskriminierung verbundenes Stigma an. Nach wie vor ist das Anketten psychisch Kranker eine weitverbreitete Praxis. Dies gilt selbst für psychiatrische Einrichtungen – etwa in Garoowe (WHO Rizwan 8.10.2020). Aufgrund des Mangels an Einrichtungen werden psychisch Kranke mitunter an Bäume gebunden oder zu Hause eingesperrt (USDOS 30.3.2021, S. 35). Im Zweifelsfall suchen Menschen mit psychischen und anderen Störungen Zuflucht im Glauben (ACCORD 31.5.2021, S. 38).
Verfügbarkeit:
Nur 5 % der Einrichtungen sind in der Lage, Tuberkulose, Diabetes oder Gebärmutterhalskrebs zu diagnostizieren und zu behandeln (WB 6.2021, S. 34).
Diabetes: Kurz- und langwirkendes Insulin ist kostenpflichtig verfügbar. Medikamente können überall gekauft werden. Die Behandlung erfolgt an privaten Spitälern (UNFPA/DIS 25.6.2020, S. 84). Rund 537.000 Menschen leiden in Somalia an einer Form von Diabetes (HIPS 5.2020, S. 26).
Dialyse: In Mogadischu ist Dialyse nicht möglich (FIS 7.8.2020, S. 31); nach anderen Angaben steht Dialyse in Städten zur Verfügung, nicht aber auf Bezirksebene (MoH/DIS 27.8.2020, S. 74). Am türkischen Krankenhaus in Mogadischu kostet jede Behandlung 35 US-Dollar (DIS 11.2020, App. F, S. 16).
HIV/AIDS: Kostenlose Dienste stehen zur Verfügung (MoH/DIS 27.8.2020, S. 74). Über das Land verstreut gibt es Zentren, in welchen anti-retrovirale Medikamente kostenfrei abgegeben werden (UNFPA/DIS 25.6.2020, S. 83).
Krebs: Es gibt nur diagnostische Einrichtungen, keine Behandlungsmöglichkeiten (MoH/DIS 27.8.2020, S. 74). Es sind auch keine Medikamente verfügbar. Wer es sich leisten kann, geht zur Behandlung nach Indien, Äthiopien, Kenia oder Dschibuti (UNFPA/DIS 25.6.2020, S. 83).
Orthopädie: Das SRCS betreibt in Hargeysa, Mogadischu und Galkacyo orthopädische Rehabilitationszentren samt Physiotherapie (SRCS 2020, S. 8). An den genannten Zentren der SRCS in Mogadischu und Galkacyo werden Prothesen, Orthosen, Physiotherapie, Rollstühle und Gehhilfen organisiert, unterhalten und repariert (SRCS 2020, S. 20ff).
Psychische Krankheiten: Die Verfügbarkeit ist hinsichtlich der Zahl an Einrichtungen, qualifiziertem Personal und geographischer Reichweite unzureichend. Auch die Verfügbarkeit psychotroper Medikamente ist nicht immer gegeben, das Personal im Umgang damit nicht durchgehend geschult (WHO Rizwan 8.10.2020). Oft werden Patienten während psychotischer Phasen angekettet (UNFPA/DIS 25.6.2020, S. 84).
Transplantationen: Diese sind in Somalia nicht möglich, es gibt keine Blutbank. Patienten werden i.d.R. nach Indien, in die Türkei oder nach Katar verwiesen (UNFPA/DIS 25.6.2020, S. 84).
Tuberkulose: Die Behandlung wird über den Global Fund gratis angeboten (UNFPA/DIS 25.6.2020, S. 84). Die Zahl an Infizierten mit der multi-resistenten Art von Tuberkulose ist in Somalia eine der höchsten in Afrika. Mehr als 8 % der Neuinfizierten weisen einen resistenten Typ auf (HIPS 5.2020, S. 25).
Medikamente: Grundlegende Medikamente sind verfügbar (FIS 5.10.2018, S. 37; vgl. FIS 7.8.2020, S. 31), darunter solche gegen die am meisten üblichen Krankheiten sowie jene zur Behandlung von Diabetes, Bluthochdruck, Epilepsie und von Geschwüren. Auch Schmerzstiller sind verfügbar. In den primären Gesundheitszentren ländlicher Gebiete kann es bei Medikamenten zur Behandlung chronischer Krankheiten zu Engpässen kommen (FIS 5.10.2018, S. 37). Nach anderen Angaben kommt es in Krankenhäusern allgemein immer wieder zu Engpässen bei der Versorgung mit Medikamenten, Verbands- und anderen medizinischen Verbrauchsmaterialien (AA 3.12.2020). Die oben erwähnten, vom Roten Kreuz unterstützten Spitäler erhalten Medikamente vom Roten Kreuz (ICRC 13.9.2019).
Es gibt keine Regulierung des Imports von Medikamenten (DIS 11.2020, S. 73). Medikamente können ohne Verschreibung gekauft werden. Die Versorgung mit Medikamenten erfolgt in erster Linie über private Apotheken. Für Apotheken gibt es keinerlei Aufsicht (FIS 5.10.2018, S. 37). Die zuständige österreichische Botschaft kann zur Medikamentenversorgung in Mogadischu keine Angaben machen (ÖB 3.2020, S. 16).
Quellen:
AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (18.4.2021): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2050118/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-_und_abschieberelevante_Lage_in_der_Bundesrepublik_Somalia_%28Stand_Januar_2021%29%2C_18.04.2021.pdf , Zugriff 23.4.2021
AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (3.12.2020): Somalia – Reise- und Sicherheitshinweise – Reisewarnung, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/somalia-node/somaliasicherheit/203132#content_6 , Zugriff 3.12.2020
ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation / Höhne, Markus / Bakonyi, Jutta (31.5.2021): Somalia - Al-Schabaab und Sicherheitslage; Lage von Binnenvertriebenen und Rückkehrer·innen [sic]; Schutz durch staatliche und nicht-staatliche Akteure; Dokumentation zum COI-Webinar mit Markus Höhne und Jutta Bakonyi am 5. Mai 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2052555/20210531_COI-Webinar+Somalia_ACCORD_Mai+2021.pdf , Zugriff 28.6.2021
AI - Amnesty International (18.8.2021): "We just watched COVID-19 patients die": COVID-19 exposed Somalia's weak healthcare system but debt relief can transform it [AFR 52/4602/2021], https://www.ecoi.net/en/file/local/2058478/AFR5246022021ENGLISH.pdf , Zugriff 27.8.2021
DIS - Danish Immigration Service [Dänemark] (11.2020): Somalia - Health System, https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landenotater/COI_report_somalia_health_care_nov_2020.pdf?la=en-GB&hash=3F6C5E28C30AF49C2A5183D32E1B68E3BA52E60C , Zugriff 2.12.2020
FIS - Finnish Immigration Service [Finnland] (7.8.2020): Somalia: Fact-Finding Mission to Mogadishu in March 2020, https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf/2f51bf86-ac96-f34e-fd02-667c6ae973a0/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf?t=1602225617645 , Zugriff 17.3.2021
FIS - Finnish Immigration Service [Finnland] (5.10.2018): Somalia: Fact-Finding Mission to Mogadishu and Nairobi, January 2018, https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia_Fact_Finding+Mission+to+Mogadishu+and+Nairobi+January+2018.pdf/2abe79e2-baf3-0a23-97d1-f6944b6d21a7/Somalia_Fact_Finding+Mission+to+Mogadishu+and+Nairobi+January+2018.pdf , Zugriff 17.3.2021
HIPS - The Heritage Institute for Policy Studies (5.2020): Somalia’s Healthcare System: A Baseline Study & Human Capital Development Strategy, http://www.heritageinstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/Somalia-Healthcare-System-A-Baseline-Study-and-Human-Capital-Development-Strategy.pdf , Zugriff 3.12.2020
ICRC - International Committee of the Red Cross (7.2020): Facts & Figures January – June 2020, https://blogs.icrc.org/somalia/wp-content/uploads/sites/99/2020/07/Facts-Figures-Mid-2020-EN.pdf , Zugriff 3.12.2020
ICRC - International Committee of the Red Cross (13.9.2019): Health activities in Somalia, https://blogs.icrc.org/somalia/2019/09/13/health-activities-in-somalia-2/ , Zugriff 17.3.2021
MoH/DIS – Ministry of Health [Somalia] / Danish Immigration Service [Dänemark] (27.8.2020): Telefoninterview des DIS mit dem somalischen Gesundheitsministerium, in: DIS (11.2020): Somalia - Health System, S.72-75, https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landenotater/COI_report_somalia_health_care_nov_2020.pdf?la=en-GB&hash=3F6C5E28C30AF49C2A5183D32E1B68E3BA52E60C , Zugriff 7.12.2020
ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021
SRCS - Somali Red Crescent Society (2020): Annual Report 2019, http://data.ifrc.org/fdrs/societies/somali-red-crescent-society , Zugriff 3.12.2020
UNFPA/DIS - UN Population Fund / Danish Immigration Service [Dänemark] (25.6.2020): Skype-Interview des DIS mit UNFPA, in: DIS (11.2020): Somalia - Health System, S.79-84, https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landenotater/COI_report_somalia_health_care_nov_2020.pdf?la=en-GB&hash=3F6C5E28C30AF49C2A5183D32E1B68E3BA52E60C , Zugriff 7.12.2020
UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (31.3.2020): Somalia Humanitarian Bulletin, 1-31 March 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2027648/March+2020+Humanitarian+Bulletin-Final+%281%29.pdf , Zugriff 8.4.2020
USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021
USDOS - US Department of State [USA] (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/SOMALIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf , Zugriff 17.3.2020
WB - Weltbank (22.7.2021): Somalia’s Women and Children are Among the 1.84 Million to Benefit from Improved Healthcare Services, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/19/somalia-s-women-and-children-are-among-the-1-84-million-to-benefit-from-improved-healthcare-services , Zugriff 31.8.2021
WB - Weltbank (6.2021): Somalia Economic Update. Investing in Health to Anchor Growth, http://documents1.worldbank.org/curated/en/926051631552941734/pdf/Somalia-Economic-Update-Investing-in-Health-to-Anchor-Growth.pdf , Zugriff 15.9.2021
WHO Rizwan - World Health Organization / Humayun Rizwan (8.10.2020): Mental Health in Somalia, https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mental_health_presentation.pdf , Zugriff 3.12.2020
Rückkehr
Süd-/Zentralsomalia, Puntland
Letzte Änderung: 21.10.2021
Rückkehr international: Die steigende Rückkehr von somalischen Flüchtlingen nach Somalia ist eine Tatsache (ÖB 3.2020, S. 13). Schon nach den Jahren 2011 und 2012 hat die Zahl der aus der Diaspora nach Süd- und Zentralsomalia zurückkehrenden Menschen stark zugenommen. Es gibt keine Statistiken, doch alleine die vollen Flüge nach Mogadischu und die sichtbaren Investments der Diaspora scheinen die Entwicklung zu bestätigen (EASO 12.2017, S. 55). Viele lokale Angestellte internationaler NGOs oder Organisationen sind aus der Diaspora zurückgekehrte Somali. Andere kommen nach Somalia auf Urlaub oder eröffnen ein Geschäft (BFA 3./4.2017). Repräsentanten der somalischen Gemeinde in London geben an, dass hunderte ihrer Kinder nach Somalia, Somaliland und Kenia ausgeflogen wurden. Grund dafür ist die wachsende Sorge der Eltern vor Drogenbanden und Gewalt in England (TG 9.3.2019).
Großbritannien, Norwegen, Dänemark und Finnland führen grundsätzlich Abschiebungen nach Mogadischu durch. 2018 hat auch die Schweiz erstmals nach Somalia rückgeführt. Belgien und die Niederlande haben im Jahr 2020 wegen COVID-19 keine Rückführungen durchgeführt, Rückführungen aus Deutschland gestalteten sich schwierig (AA 18.4.2021, S. 24). Im November 2019 wurde Somalia in das ERRIN-Programm für freiwillige Rückkehr aufgenommen. Daran partizipiert auch Österreich (BMI 8.11.2019).
Rückkehr regional: Die Rückkehrbewegung nach Somalia hat sich in den Jahren 2020 und 2021 deutlich verlangsamt. Insgesamt sind von Ende 2014 bis Juni 2021 knapp 133.000 Menschen mit oder ohne Unterstützung nach Somalia zurückgekehrt. Im ersten Halbjahr 2021 waren es allerdings nur knapp 1.400 – vor allem aus dem Jemen (UNHCR 10.7.2021). Mehr als 75 % der Rückkehrer aus dem Jemen gehen nach Mogadischu (UNHCR 30.6.2019a). Aus dem Jemen kamen mehr als 5.400 somalische Flüchtlinge mit Unterstützung durch den UNHCR zurück in ihr Land. Weitere knapp 40.000 sind aus dem Jemen ohne Unterstützung zurückgekehrt (AA 18.4.2021, S. 22; vgl. ÖB 3.2020, S. 13). Im Feber 2021 landete ein Boot mit 164 jemenitischen und somalischen Familien in Bossaso, die Menschen wurden dort in einem Flüchtlingszentrum registriert (Sahan 25.2.2021b). Seit 2018 ist die Zahl an Rückkehrern jedenfalls rückläufig (AA 18.4.2021, S. 22). Im Jahr 2020 waren es insgesamt nur etwa 1.000 Rückkehrer (USDOS 30.3.2021, S. 21) - nicht zuletzt aufgrund der COVID-19-Pandemie. Ende 2020 wurden die diesbezüglichen Aktivitäten in begrenztem Ausmaß wieder aufgenommen (UNHCR 31.5.2021, S. 1).
Der UNHCR und andere internationale Partner unterstützen seit 2014 die freiwillige Rückkehr von Somaliern aus Kenia. Grundlage ist ein trilaterales Abkommen zwischen Kenia, Somalia und dem UNHCR (AA 18.4.2021, S. 22; vgl. NLMBZ 3.2019, S. 54). Seit Abschluss des trilateralen Abkommens kehrten mit Unterstützung des UNHCR über 84.900 Menschen aus Kenia nach Somalia zurück. Diese gingen vor allem nach Kismayo und das südliche Jubaland (AA 18.4.2021, S. 22). Die Remigration von Kenia nach Somalia erfolgt hauptsächlich über Land, wobei die Fahrt bis an die Grenze organisiert wird, und die Rückkehrer dann innerhalb Somalias den Transport selbst arrangieren (NLMBZ 3.2019, S. 54). Noch nie wurde ein Bus, welcher Rückkehrer transportiert, angegriffen (FIS 7.8.2020, S. 28). Allerdings kommt es aufgrund von Gewalt und Konflikt immer wieder zu Unterbrechungen bei der Rückkehrbewegung (USDOS 30.3.2021, S. 22).
Seit Frühjahr 2018 unterstützt die sogenannte EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration rückkehrwillige somalische Migranten vornehmlich in Libyen und Äthiopien. Die Leistungen umfassen Beratung zu Möglichkeiten der Rückkehr sowie der Integration in den somalischen Arbeitsmarkt. Außerdem wird die Entwicklung von standardisierten Rückführungsverfahren nach Somalia gefördert. Zwischen 2014 und 2020 kamen 773 somalische Flüchtlinge aus Dschibuti, 469 aus Libyen, 143 aus dem Sudan, 34 aus Eritrea und weitere aus Angola, Tunesien, Gambia, China und der Ukraine nach Somalia zurück (AA 18.4.2021, S. 22).
Behandlung: Die Zahl der von westlichen Staaten zurückgeführten somalischen Staatsangehörigen nimmt stetig zu. Mit technischer und finanzieller Unterstützung haben sich verschiedene westliche Länder über die letzten Jahre hinweg für die Schaffung und anschließende Professionalisierung eines speziell für Rückführung zuständigen Returnee Management Offices (RMO) innerhalb des Immigration and Naturalization Directorates (IND) eingesetzt. Das RMO hat für alle Rückführungsmaßnahmen nach Somalia eine einheitliche Prozedur festgelegt, die konsequent zur Anwendung gebracht wird (AA 18.4.2021, S. 23). Am Flughafen kann es zu einer Befragung von Rückkehrern kommen (NLMBZ 3.2019, S. 52). Das RMO befragt sie hinsichtlich Identität, Nationalität, Familienbezügen sowie zum gewünschten zukünftigen Aufenthaltsort. Es gibt keine staatlichen Aufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige und andere Rückkehrer. Eine Unterkunft und ein innersomalischer Weiterflug kann vom RMO organisiert werden, die Rechnung begleichen die rückführenden Staaten (AA 18.4.2021, S. 23f).
Es sind keine Fälle bekannt, wo somalische Behörden Rückkehrer misshandelt haben (NLMBZ 3.2019, S. 52). Staatliche Repressionen sind nicht die Hauptsorge der Rückkehrer. Nach vorliegenden Erkenntnissen werden Rückkehrer vom RMO/IND grundsätzlich mit Respekt behandelt (AA 18.4.2021, S. 23f).
Rückkehrstudie von UNHCR: Der UNHCR hat für eine repräsentative Studie von 2018 bis 2020 mehr als 2.000 Haushalte mit fast 12.000 Angehörigen – darunter vor allem unterstützte Rückkehrer aus Kenia, Äthiopien und dem Jemen – zu ihrer Situation in Somalia befragt. Dabei hatten 46 % der Befragten angegeben, wegen der verbesserten Sicherheitslage nach Somalia zurückgegangen zu sein. 13 % machten diesen Schritt wegen besserer ökonomischer Möglichkeiten. Nur 19 % der befragten Haushalte gaben an, in einem IDP-Lager zu wohnen (wobei der UNHCR diese Bezeichnung dezidiert für inadäquat hält). 95 % der Rückkehrer gaben an, nach ihrer Rückkehr keinerlei Form von Gewalt (Drohungen, Einschuchterungen, physische Gewalt) erlebt zu haben. 87 % gaben an, sich in ihrer Gemeinde und im Bezirk frei bewegen zu können. 92 % der Befragten gaben an, dass sie nicht als Rückkehrer diskriminiert würden; und 90 % wurden auch nicht wegen ihrer ethnischen oder Clan-Zugehörigkeit diskriminiert. 88% der Befragten haben keine Streitigkeiten austragen müssen. Von jenen, die in Konflikte verwickelt waren, gaben 43 % Wohnungs- und Landstreitigkeiten als Gründe an, weitere 19 % Familienstreitigkeiten (UNHCR 31.5.2021).
Erreichbarkeit: Einen internationalen Standards entsprechenden, regelmäßigen Direktflugverkehr nach Mogadischu gibt es mit Turkish Airlines aus Istanbul, Ethiopian Airlines aus Addis Abeba, Kenyan Airways aus Nairobi und Qatar Airways aus Doha. Darüber hinaus fliegen regionale Fluglinien, die Vereinten Nationen, die Europäische Union und private Chartermaschinen Mogadischu aus Nairobi regelmäßig an. Für Rückführungen somalischer Staatsbürger wurden vor COVID-19 die Verbindungen der Turkish Airlines via Istanbul bzw. via Nairobi mit Jubba Airways bevorzugt. Bei Ersterer erfolgte meist eine polizeiliche Eskortierung bis Mogadischu, bei Letzterer nur bis Nairobi, da die Fluglinie sich dann gegen die Zahlung einer Gebühr um die Sicherheit kümmerte (AA 18.4.2021, S. 24).
Quellen:
AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (18.4.2021): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2050118/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-_und_abschieberelevante_Lage_in_der_Bundesrepublik_Somalia_%28Stand_Januar_2021%29%2C_18.04.2021.pdf , Zugriff 23.4.2021
BFA - BFA/SEM Fact Finding Mission Somalia (3./4.2017): Informationen aus den Protokollen der FFM
BMI - Bundesministerium für Inneres [Österreich] (8.11.2019): ERRIN Reintegrationsprojekt Somalia und Somaliland ab 8. November 2019, per e-Mail
EASO - European Asylum Support Office (12.2017): Somalia Security Situation, https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/coi-somalia-dec2017lr.pdf , Zugriff 3.12.2020
FIS - Finnish Immigration Service [Finnland] (7.8.2020): Somalia: Fact-Finding Mission to Mogadishu in March 2020, https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf/2f51bf86-ac96-f34e-fd02-667c6ae973a0/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf?t=1602225617645 , Zugriff 17.3.2021
NLMBZ - Ministerie von Buitenlandse Zaken [Niederlande] (3.2019): Country of Origin Information Report on South and Central Somalia (nicht veröffentlichte englische Version), niederländische Version auf https://www.ecoi.net/en/file/local/2006489/Algemeen_ambtsbericht_Zuid-_en_Centraal-_Somalie__maart_2019.pdf , Zugriff 2.12.2020
ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021
Sahan - Sahan / Hillaac Net (25.2.2021b): The Somali Wire No. 90, per e-Mail, Originallink auf Somali: https://www.hillaac.net/puntland-oo-qaabishay-in-ka-badan-160-qoys-oo-qaxooti-ka-soo-cararay-yemen/
TG - The Guardian (9.3.2019): Mothers send sons to Somalia to avoid knife crime, https://www.theguardian.com/uk-news/2019/mar/09/british-somalis-send-sons-abroad-to-protect-against-knife-crime , Zugriff 3.12.2020
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (10.7.2021): Somalia - Returnees Figures and Trends as of 30 June 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2056013/UNHCR+Somalia+Monthly+Refugee+Returnee+Report+-+June+2021.pdf , Zugriff 20.7.2021
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (31.5.2021): Somalia Post Return Monitoring Snapshot Round 5 | MAY 2021, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PRM%20Snapshot%20May%202021.pdf , Zugriff 1.7.2021
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (30.11.2019): Refugee returnees to Somalia at 30 November 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2022050/document-8.pdf , Zugriff 27.1.2020
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (30.6.2019): UNHCR Somalia Factsheet - 1 - 30 June 2019, https://reliefweb.int/report/somalia/unhcr-somalia-factsheet-1-30-june-2019 , Zugriff 3.12.2020
USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021
Auszug aus UN OCHA Update zur humanitären Lage (Beobachtungszeitraum Februar 2022) vom 14.03.2022:
[…]
DROUGHT INTENSIFYING AS PARTNERS RAMP UP ASSISTANCE
Humanitarian partners and authorities continued to scale up assistance to mitigate the adverse outcomes of the drought emergency in Somalia. The drought emergency has intensified, with the number of people affected increasing to about 4.5 million people, up from 3.2 million in December 2021; and this number is steadily rising. About 671,000 people have been displaced internally in search of water, food, livelihoods and pasture. The displacement trend indicates higher numbers than during the 2016/17 drought emergency. According to the Protection and Return Monitoring Network, about 259,500 people were displaced between October 2016 and February 2017, compared to 572,700 people displaced between October 2021 and February 2022. Reports from Baardheere, Gedo region, Jubaland State, inform of deaths of children and adults from causes related to drought. Pastoralists have reported significant loss of livestock, a main source of livelihoods in the country. In Bakool region, authorities estimate that up to 10,000 cattle, sheep, goats and camels died in February alone. Authorities in Hiraan region also reported loss of large numbers of livestock.
Pasture and water are close to complete depletion in key pastoral livelihoods across Somalia, according to FAO-SWALIM. The high demand for water is overstretching functional permanent water sources, with preliminary survey findings informing of 15 to 24 pumping hours per day for many boreholes. Along the Juba and Shabelle rivers, current water levels are below their historical minimum and dry riverbeds are observed in many sections of the two rivers. This has affected irrigated agriculture in areas that depend on the two rivers and the quality of the river water has deteriorated, likely contributing to increased cases of acute watery diarrhoea (AWD) in some districts. While drought conditions are expected to get worse until the start of the April rains, SWALIM informs that forecasts from major climate information services indicate differing outlooks for the April to June 2022 season, ranging from likely average to above-average rainfall and average to below-average rainfall. Given the failure of three consecutive rainy seasons since October 2020, SWALIM has observed that extended drought impacts are likely to be experienced in parts of Somalia even under the more optimistic rainfall forecasts.
Acute malnutrition levels are projected to deteriorate across much of Somalia from February to April. Urgent treatment and nutrition support are required for approximately 1.4 million children under age 5, who will likely face acute malnutrition between January and December 2022, including 329,500 who are likely to be severely malnourished. In particular, high levels of acute malnutrition have been reported among new IDP arrivals in Banadir, Baidoa, Gaalkacyo, Baardheere, Belet Xaawo and Belet Weyne. Furthermore, about 10,000 learners have been affected by the closure of 60 schools in Galmudug and Jubaland states due to the drought emergency.
In addition, food assistance for drought-affected families in Afgooye, Baardheere, Belet Weyne, Berbera, Borama, Bossaso, Burco, Burtinle, Diinsoor, Eyl, Jowhar, Lughaye and Marka districts is below 25 per cent of the target, due to lack of adequate funding for most partners and challenging access in hard-to-reach areas. Shelter Cluster partners report that about 60 per cent of the households displaced by drought need assistance to access shelter and non-food items.
To respond to the drought emergency, humanitarian partners are prioritizing operational areas by identifying locations where the drought-related impact is most severe, classifying districts into categories that define the response approach required and facilitating multi-cluster rapid response efforts. In January, 128 humanitarian partners reached at least 1.4 million people with different forms of assistance.
[…]
SHF ALLOCATES US$25 MILLION FOR EARLY RESPONSE TO DROUGHT
The Deputy Special Representative of the Secretary-General, UN Resident and Humanitarian Coordinator for Somalia, Mr. Adam Abdelmoula, has launched an early allocation of US$25 million from the Somalia Humanitarian Fund (SHF) to provide immediate assistance to communities hard-hit by the drought emergency in priority locations.
“In many ways, this drought emergency is similar to the 2016/2017 crisis; in some ways, it is already worse. Already over 4.5 million people are affected and over half a million displaced, and the numbers are surging," said Mr. Abdelmoula. “Substantial and early funding for response activities, including the 2022 Humanitarian Response Plan (HRP) is critical to prevent further suffering and save lives."
Among the first sources of funding this year, this allocation will catalyze additional resources and early action to save and sustain the lives of those most affected by the deepening drought. Focusing on underserved and hard-to-reach areas, the allocation comes at a time when recurring shocks have deepened poverty levels in Somalia, compounded pre-existing vulnerabilities and stripped communities of their livelihoods.
The allocation complements the $17 million that was recently provided from the UN Central Emergency Response Fund to meet the immediate needs of communities affected by drought. The allocation will focus on integrated multi-cluster interventions that prioritize key lifesaving activities for people most affected by the drought in Jubaland and Puntland. It also includes supporting families displaced by drought and new arrivals at IDP sites, by ensuring provision of key services. In addition, cluster-specific interventions such as WASH, livelihoods and nutrition will allow for provision of safe drinking water, emergency livestock assistance, and continuation of nutrition life-saving services. Somalia, on the frontline of climate change, has been heavily impacted by the severe drought that is sweeping across the Horn of Africa, amid serious funding shortfalls for humanitarian response. The 2022 HRP seeks US$1.5 billion to assist 5.5 million people in Somalia, but only 3.3 per cent of the required funding ($48.8 million) has been received as of February. With the next rainy season not expected until April 2022, millions of people in Somalia are staring at a potential catastrophe.
[…]
Auszug aus USAID Kurzbericht zur humanitären Lage (wesentliche Entwicklungen; Ernährungssicherheit; Gesundheit; Hygiene, Wasser- und Sanitärversorgung; Ernährung) vom 28.03.2022
Relief Actors Report Risk of Famine in Somalia
During 2022 Food security conditions in Somalia have rapidly deteriorated since the start of the January -to-March jilaal dry season, according to a joint Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) and Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU) assessment released in March. Persistent drought conditions—coupled with the adverse socioeconomic effects of the COVID-19 pandemic and prolonged insecurity—continue to result in escalating staple food prices, loss of livestock, and widespread water scarcity as of late March. Relief actors suggest households in Somalia have lost up to 30 percent of their livestock holdings due to starvation or disease since mid-2021, while staple food and water prices rose between 140 and 160 percent above the five-year average in parts of Somalia in February alone. Moreover, water shortages have exacerbated inadequate access to sanitation and hygiene facilities, leaving households vulnerable to diseases such as cholera.
As a result, between 4 and 5 million people in Somalia—up to 30 percent of the country’s total population—will likely require humanitarian food assistance to prevent Crisis—IPC 3—or worse levels of acute food insecurity during 2022, including up to 1.5 million people facing Emergency—IPC 4—levels of acute food security. A projected fourth consecutive below-average rainy season between April and June will likely exacerbate already dire food security conditions across Somalia, as many households face widening food consumption gaps and the erosion of their coping capacity, relief actors report. Significant levels of acute food insecurity are expected to worsen through September; FEWS NET and FSNAU assess that Somalia faces a risk of Famine—IPC 5—in 2022 if the April-to-June gu rains fail, purchasing power continues to decline, and food assistance is unable to reach areas of high concern.
The 2022 Somalia Humanitarian Response Plan, which requested nearly $1.5 billion to reach approximately 5.5 million people across the country, is less than 4 percent funded as of March. Relief actors anticipate breaks in food assistance pipelines may occur in May, as the number of people experiencing acute food insecurity is rapidly outpacing current levels of food and water assistance. Scaled up and sustained humanitarian assistance—in addition to improved humanitarian access to conflict-affected areas—is necessary to avert the risk of Famine in Somalia in 2022.
[…]
Auswirkungen des Ukrainekrieges:
Wegen des Ausfalles von drei Regenzeiten droht am Horn von Afrika wegen ausbleibender Regenfälle die schlimmste Dürre seit 1981 und eine weitere Verschärfung der Hungerkrise. Somalia ist am stärksten von der Dürre betroffen.
Experten befürchten aufgrund des Krieges in der Ukraine eine Verschärfung der Hungerkatastrophe in Ostafrika. Russland und die Ukraine gehören zu den größten Weizenexporteuren weltweit. Durch den Überfall Russlands verursachte Produktionsausfälle sowie Schäden an Häfen und vielfältige Sanktionen dürften zu einem Rückgang der Exporte führen. Lieferungen derzeit sind kaum möglich. Bereits jetzt steigen die Weltmarktpreise und wachsen die Sorgen um die Nahrungsversorgung in Afrika und Asien (vgl. dazu Horn von Afrika: Schlimmste Dürre seit 1981, ZDFheute vom 02.04.2022, https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/afrika-duerre-hunger-ukraine-krieg-russland-100.html#:~:text=Drei%20Regenzeiten%20sind%20am%20Horn ,UN%2DWeltern%C3%A4hrungsprogramm%20(WFP).; Der Hunger wird zunehmen, Süddeutsche Zeitung vom 27.03.2022, https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-russland-hunger-getreide-weizen-krieg-exporte-importe-aegypten-jemen-libanon-afrika-welternaehrungsprogramm-lebensmittel-nahrung-1.5536980 ).
2. Beweiswürdigung:
Zu den vorgebrachten Fluchtgründen wird auf das eigene (oben wiedergegebene) Vorbringen des Beschwerdeführers hingewiesen, der selbst ein Fortbestehen der schon im Erstverfahren vorgebrachten Gründe einräumte. So gab er bei der Erstbefragung am 29.07.2021 – abgesehen von Vorbringen zu seiner psychischen Gesundheit sowie der allgemeinen Lage in Somalia (siehe dazu sogleich unten) – an, dass er seine früheren Fluchtgründe aufrecht halte (vgl. AS 26). Ebenso wies er in seiner Einvernahme vor dem BFA am 07.09.2021 lediglich darauf hin, dass es seinen bereits im Erstverfahren behaupteten Fluchtgrund noch gebe und auch seine Familie vor Al-Shabaab habe fliehen müssen (vgl. AS 79). Der Beschwerdeführer brachte jedoch keinerlei Umstände vor, die auf eine asylrelevante Gefährdung seiner Person im Zusammenhang mit der Flucht seiner Familie schließen lassen würden. Der bereits im Vorverfahren angegebene Fluchtgrund wurde zudem bereits mit rechtskräftigem Erkenntnis vom 10.10.2019 als nicht glaubhaft gewertet und eine asylrelevante Verfolgung aufgrund seiner Clanzugehörigkeit verneint. Im Übrigen konnten auch dem Beschwerdevorbringen keine konkreten Hinweise auf eine Bedrohung des Beschwerdeführers entnommen werden, welche auf eine Bedrohung, die ihre Ursachen in Gründen der GFK hätte, schließen ließe. Die mögliche Wahrnehmung des Beschwerdeführers als Verräter durch seine Freunde und Nachbarn in Somalia stellt sich zudem als rein spekulativ dar. Der Beschwerdeführer machte somit im gegenständlichen Verfahren keine neuen Fluchtgründe, die einen glaubwürdigen Kern hätten, geltend.
Der Beschwerdeführer behauptete aber auch bereits in seiner Erstbefragung zu seinem gegenständlichen Folgeantrag, dass er mental schwer krank sei und sich sein Zustand sowie die Lage in Somalia in den letzten 2 Monaten stark verschlechtert habe (vgl. AS 26). In der darauffolgenden Einvernahme durch das BFA gab er ferner an, dass sich sein Hautzustand fortwährend verschlechtere, er vom Arzt Salben erhalten habe und seine Familie vor Al-Shabaab habe fliehen müssen (vgl. AS 79). Im Erstverfahren ging das Bundesverwaltungsgericht demgegenüber davon aus, dass der Beschwerdeführer in keiner ärztlichen Behandlung stand und nur hin und wieder Medikamente wegen psychischer Leiden nahm sowie seine Kernfamilie XXXX und weitere Verwandte im Umland dieser Stadt aufhältig waren, sodass er von diesen – vor allem anfangs – notfalls die notwendige Unterstützung erhalten konnte. Zudem wurde im Vergleichserkenntnis darauf hingewiesen, dass auch die Versorgung von XXXX mit Lebensmitteln nicht erwarten ließ, dass der Beschwerdeführer dort wegen Nahrungsmittelknappheit in eine aussichtslose Lage geraten könnte. Zur Lage in Somalia wurde zudem unter anderem festgestellt, dass nach den überdurchschnittlichen Gu-Regenfällen 2018 die Getreideernte die größten Erträge seit 2010 einbringen werde und sich die Lage bei der Nahrungsversorgung weiter verbesserte. Für die Deyr-Regenzeit 2018 (Oktober-Dezember) war auch eine überdurchschnittliche Niederschlagsmenge prognostiziert, womit auch eine weitere Verbesserung bei den Weideflächen und bei der Wasserverfügbarkeit und i.d.F. Verbesserungen bei der Viehzucht und in der Landwirtschaft einhergehen werde.
Die gegenständlich maßgebliche Situation im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers ergibt sich aus der Länderinformation der Staatendokumentation sowie den Berichten von UNOCHA und USAID.
Hinsichtlich der Versorgungslage lässt sich den Informationen der Staatendokumentation vom 21.10.2021 entnehmen, dass die humanitären Bedürfnisse weiter hoch bleiben, angetrieben vom anhaltenden Konflikt, von politischer und wirtschaftlicher Instabilität und regelmäßigen Klimakatastrophen sowie der dreifachen Belastung durch Covid-19, Heuschrecken und Überflutungen. Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist in weiten Landesteilen nicht gewährleistet. Periodisch wiederkehrende Dürreperioden mit Hungerkrisen wie auch Überflutungen, zuletzt auch die Heuschreckenplage, die äußerst mangelhafte Gesundheitsversorgung sowie der mangelhafte Zugang zu sauberem Trinkwasser und das Fehlen eines funktionierenden Abwassersystems machen Somalia zum Land mit dem viertgrößten Bedarf an internationaler Nothilfe weltweit. Covid-19 hat die bereits bestehende Krise nur noch verschlimmert. Es fügt sich ein in die Krisen der schlimmsten Heuschreckenplage seit 25 Jahren, schweren Überflutungen mit zeitweise 650.000 Vertriebenen, dem mancherorts andauernden Konflikt und vorangehenden Jahren der Dürre. Insgesamt gelten rund 2,6 Millionen Menschen als im Land vertrieben, 3,5 Millionen können auch nur die grundlegendste Nahrungsversorgung nicht sicherstellen und stehen vor akuter Unsicherheit bei der Nahrungsmittelversorgung. Zudem herrschte vor den Gu-Regenfällen (April-Juni) in mehr als 80 % des Landes moderate bis schwere Dürre, welche von der Bundesregierung am 25.04.2021 schlussendlich auch ausgerufen wurde. Außerdem gibt es Berichte, wonach Ostafrika 2021 und 2022 vor einer verheerenden Dürre steht.
Zudem lassen aktuellere Informationen von UNOCHA und USAID eine Verschlechterung der von der Staatendokumentation beschriebenen Situation erkennen:
Nach dem Bericht von UNOCHA mit Stand Februar 2022 hat sich der Dürrenotstand verschärft, wobei die Zahl der Betroffenen von 3,2 Millionen im Dezember 2021 auf etwa 4,5 Millionen Menschen gestiegen ist; und diese Zahl stetig wächst. Selbst bei optimistischeren Niederschlagsvorhersagen würden in Teilen Somalias voraussichtlich ausgedehnte Auswirkungen der Dürre auftreten. Darüber hinaus würde diese Dürrekrise der Krise von 2016/2017 in vielerlei Hinsicht ähneln; teilweise sei es schon schlimmer.
In dem Sinn legt auch USAID dar, dass sich im Jahr 2022 die Ernährungsbedingungen in Somalia seit Beginn der Jilaal-Trockenzeit von Januar bis März rapide verschlechtert haben. Eine prognostizierte vierte unterdurchschnittliche Regenzeit in Folge zwischen April und Juni werde nach Berichten von Hilfsakteuren wahrscheinlich die ohnehin schon düsteren Bedingungen der Ernährungssicherheit in ganz Somalia verschärfen, da viele Haushalte mit wachsenden Lücken beim Lebensmittelkonsum und der Erosion ihrer Bewältigungskapazität konfrontiert sind.
Darüber hinaus befürchten Experten aufgrund des Krieges in der Ukraine eine Verschärfung der Hungerkatastrophe in Ostafrika aufgrund eines Rückgangs der Exporte und steigender Weltmarktpreise (siehe dazu die in den Feststellungen angeführten Quellen).
Vor diesem Hintergrund erscheint es jedoch nicht als von vornherein ausgeschlossen, dass der Beschwerdeführer im Fall der Rückkehr in seine Heimat Gefahr liefe, in eine ausweglose Lage zu geraten, welche die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten rechtfertigen könnte. Es ist somit seit Rechtskraft des Vergleichserkenntnisses zu einer relevanten Änderung der Versorgungslage in Somalia gekommen.
3. Rechtliche Beurteilung:
Zu A):
3.1. Zurückweisung des Antrages auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache:
a) Gemäß § 68 Abs. 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71 AVG die Abänderung eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen, wenn die Behörde nicht Anlass zu einer Verfügung gemäß § 68 Abs. 2 bis 4 AVG findet. Diesem ausdrücklichen Begehren auf Abänderung steht ein Ansuchen gleich, das bezweckt, eine Sache erneut inhaltlich zu behandeln, die bereits rechtskräftig entschieden ist (VwGH 30.09.1994, 94/08/0183; 30.05.1995, 93/08/0207; 09.09.1999, 97/21/0913; 07.06.2000, 99/01/0321).
"Entschiedene Sache" iSd § 68 Abs. 1 AVG liegt vor, wenn sich gegenüber dem Vorbescheid weder die Rechtslage noch der wesentliche Sachverhalt geändert hat und sich das neue Parteibegehren im Wesentlichen mit dem früheren deckt (VwGH 09.09.1999, 97/21/0913; 27.09.2000, 98/12/0057; 25.04.2002, 2000/07/0235). Einem zweiten Asylantrag, der sich auf einen vor Beendigung des Verfahrens über den ersten Asylantrag verwirklichten Sachverhalt stützt, steht die Rechtskraft des Vorbescheides entgegen (VwGH 10.06.1998, 96/20/0266). Es kann aber nur eine solche behauptete Änderung des Sachverhaltes die Behörde zu einer neuen Sachentscheidung - nach etwa notwendigen amtswegigen Ermittlungen - berechtigen und verpflichten, der für sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen rechtlich Asylrelevanz zukäme; eine andere rechtliche Beurteilung des Antrages darf nicht von vornherein ausgeschlossen sein (vgl. etwa VwGH 04.11.2004, 2002/20/0391, mwN).
Infolge des in § 17 VwGVG normierten Ausschlusses der Anwendbarkeit des 4. Hauptstücks des AVG im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, welcher auch die in § 68 Abs. 1 AVG normierte Zurückweisung wegen entschiedener Sache umfasst, kommt eine unmittelbare Zurückweisung einer Angelegenheit aufgrund der genannten Bestimmung durch das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich nicht in Betracht. Davon unberührt bleibt, dass das Verwaltungsgericht im Verfahren über Bescheidbeschwerden zur Überprüfung der rechtmäßigen Anwendung von § 68 AVG in Bescheiden durch die Verwaltungsbehörde berufen ist (vgl. Filzwieser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, Asyl- und Fremdenrecht, § 7 BFA-VG, K10.; vgl. auch VfSlg. 19.882/2014).
In Beschwerdeverfahren über zurückweisende Bescheide des BFA wegen entschiedener Sache gemäß § 68 AVG ist "Sache" des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht die Frage, ob die Zurückweisung des verfahrenseinleitenden Antrags auf internationalen Schutz durch die Behörde gemäß § 68 Abs. 1 AVG zu Recht erfolgt ist, ob die Behörde also auf Grundlage des von ihr zu berücksichtigenden Sachverhalts zu Recht davon ausgegangen ist, dass im Vergleich zum rechtskräftig entschiedenen vorangegangenen Verfahren auf internationalen Schutz keine wesentliche Änderung der maßgeblichen Umstände eingetreten ist. Gelangt das Verwaltungsgericht zu dem Ergebnis, dass die Behörde nicht von entschiedener Sache hätte ausgehen dürfen, sondern aufgrund des Vorliegens neuer Sachverhaltselemente eine inhaltliche Prüfung des Antrages auf internationalen Schutz hätte durchführen müssen, hat es den zurückweisenden Bescheid auf Grundlage des für zurückweisende Entscheidungen im Zulassungsverfahren anzuwendenden § 21 Abs. 3 BFA-VG zu beheben, wodurch das Verfahren vor der Behörde zugelassen ist und eine neuerliche Zurückweisung des Antrages gemäß § 68 AVG unzulässig wird. Hingegen ist dem Bundesverwaltungsgericht ein inhaltlicher Abspruch über den zugrundeliegenden Antrag auf internationalen Schutz in einem Beschwerdeverfahren über einen zurückweisenden Bescheid nach § 68 AVG verwehrt, weil diesfalls die Sache des Beschwerdeverfahrens überschritten würde (vgl. Filzwieser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, Asyl- und Fremdenrecht, § 7 BFA-VG, K11., K17.).
Bei einer Überprüfung einer gemäß § 68 Abs. 1 AVG bescheidmäßig abgesprochenen Zurückweisung eines Asylantrages hat es lediglich darauf anzukommen, ob sich die Zurückweisung auf ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage stützen durfte. Dabei hat die Prüfung der Zulässigkeit einer Durchbrechung der Rechtskraft auf Grund geänderten Sachverhalts nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ausschließlich anhand jener Gründe zu erfolgen, die von der Partei in erster Instanz zur Begründung ihres Begehrens auf neuerliche Entscheidung geltend gemacht worden sind. Derartige Gründe können im Rechtsmittelverfahren nicht neu geltend gemacht werden (s. zB VwSlg. 5642A; VwGH 23.05.1995, 94/04/0081; zur Frage der Änderung der Rechtslage während des anhängigen Berufungsverfahrens s. VwSlg. 12799 A). Allgemein bekannte Tatsachen sind dagegen jedenfalls auch von Amts wegen zu berücksichtigen (VwGH 29.06.2000, 99/01/0400; 07.06.2000, 99/01/0321). Dem geänderten Sachverhalt muss nach der ständigen Judikatur des VwGH Entscheidungsrelevanz zukommen (vgl. VwGH 15.12.1992, 91/08/0166; ebenso VwGH 16.12.1992, 92/12/0127; 23.11.1993, 91/04/0205; 26.04.1994, 93/08/0212; 30.01.1995, 94/10/0162). Die Verpflichtung der Behörde zu einer neuen Sachentscheidung wird nur durch eine solche Änderung des Sachverhalts bewirkt, die für sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen den Schluss zulässt, dass nunmehr bei Bedachtnahme auf die damals als maßgebend erachteten Erwägungen eine andere Beurteilung jener Umstände, die seinerzeit den Grund für die Abweisung des Parteienbegehrens gebildet haben, nicht von vornherein als ausgeschlossen gelten kann (VwSlg. 7762 A; VwGH 29.11.1983, 83/07/0274; 21.02.1991, 90/09/0162; 10.06.1991, 89/10/0078; 04.08.1992, 88/12/0169; 18.03.1994, 94/12/0034; siehe auch VwSlg. 12.511 A, VwGH 05.05.1960, 1202/58; 03.12.1990, 90/19/0072). Dabei muss die neue Sachentscheidung - obgleich auch diese Möglichkeit besteht - nicht zu einem anderen von der seinerzeitigen Entscheidung abweichenden Ergebnis führen. Die behauptete Sachverhaltsänderung hat zumindest einen "glaubhaften Kern" aufzuweisen, dem Asylrelevanz zukommt (VwGH 21.3.2006, 2006/01/0028, sowie VwGH 18.6.2014, Ra 2014/01/0029, mwN, VwGH 25.02.2016, Ra 2015/19/0267). Neues Sachverhaltsvorbringen in der Beschwerde gegen den erstinstanzlichen Bescheid nach § 68 AVG ist von der "Sache" des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht nicht umfasst und daher unbeachtlich (VwGH vom 24.6.2014, Ra 2014/19/0018, mwN). Als Vergleichsbescheid (Vergleichserkenntnis) ist der Bescheid (das Erkenntnis) heranzuziehen, mit dem zuletzt in der Sache entschieden wurde (vgl. in Bezug auf mehrere Folgeanträge VwGH 26.07.2005, 2005/20/0226, mwN).
Dem neuen Tatsachenvorbringen muss also eine Sachverhaltsänderung zu entnehmen sein, die - falls feststellbar - zu einem anderen Ergebnis als im ersten Verfahren führen kann, wobei die behauptete Sachverhaltsänderung zumindest einen glaubhaften Kern aufweisen muss, dem Asylrelevanz zukommt und an den die oben erwähnte positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann (vgl. das schon zitierte Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 04.11.2004 mwN). Die Behörde hat sich insoweit bereits bei der Prüfung der Zulässigkeit des (neuerlichen) Asylantrages mit der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Beschwerdeführers (und gegebenenfalls mit der Beweiskraft von Urkunden) auseinander zu setzen. Ergeben die Ermittlungen der Behörde, dass eine Sachverhaltsänderung, die eine andere Beurteilung nicht von vornherein ausgeschlossen erscheinen ließe, entgegen den Behauptungen der Partei in Wahrheit nicht eingetreten ist, so ist der Asylantrag gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückzuweisen. (VwGH 21.10.1999, 98/20/0467; vgl. auch VwGH 17.09.2008, 2008/23/0684; 19.02.2009, 2008/01/0344).
Wird die seinerzeitige Verfolgungsbehauptung aufrechterhalten und bezieht sich der Asylwerber auf sie, so liegt nicht ein wesentlich geänderter Sachverhalt vor, sondern es wird der Sachverhalt bekräftigt (bzw. sein "Fortbestehen und Weiterwirken" behauptet; vgl. VwGH 20.03.2003, 99/20/0480), über den bereits rechtskräftig abgesprochen worden ist. Mit einem solchen Asylantrag wird daher im Ergebnis die erneute sachliche Behandlung einer bereits rechtskräftig entschiedenen Sache bezweckt (vgl. VwGH 07.06.2000, 99/01/0321). Ein auf das AsylG 2005 gestützter Antrag auf internationalen Schutz ist nicht bloß auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, sondern hilfsweise - für den Fall der Nichtzuerkennung dieses Status - auch auf die Gewährung von subsidiärem Schutz gerichtet. Dies wirkt sich ebenso bei der Prüfung eines Folgeantrages nach dem AsylG 2005 aus: Asylbehörden sind verpflichtet, Sachverhaltsänderungen nicht nur in Bezug auf den Asylstatus, sondern auch auf den subsidiären Schutzstatus zu prüfen (vgl. VfGH 29.06.2011, U 1533/10; VwGH 19.02.2009, 2008/01/0344 mwN).
Nach der Rechtsprechung des VfGH ist das Bundesverwaltungsgericht nach einer zurückweisenden Entscheidung des BFA gemäß § 68 Abs. 1 AVG über einen Folgeantrag auf internationalen Schutz verpflichtet, das Vorliegen einer realen Gefahr einer Verletzung des Art. 2 oder 3 EMRK bei einer Rückkehr des Beschwerdeführers eingehend auch im Hinblick auf die laufende Entwicklung zu prüfen (vgl. etwa VfGH 29.11.2021, E2979/2021). Auch wenn die Behörde einen Folgeantrag auf internationalen Schutz gemäß §68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache zurückweist, hat das über die dagegen erhobene Beschwerde entscheidende Bundesverwaltungsgericht das Vorbringen des Asylwerbers dahingehend zu prüfen, ob ein erstmals vorgebrachter Fluchtgrund, soweit er sachverhaltsändernde Elemente enthält, einen glaubhaften Kern aufweist und ob er im Lichte der Art. 2 und 3 EMRK einer Rückführung aktuell entgegensteht (VfGH 30.11.2021, E3097/2021).
b) Sache des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist somit die Frage, ob der neuerliche Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf das seit 10.07.2019 rechtskräftige hg. Vergleichserkenntnis vom selben Tag, mit dem zuletzt in der Sache entschieden wurde, gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückzuweisen ist oder eine solche Änderung des Sachverhalts vorliegt, die für sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen den Schluss zulässt, dass nunmehr bei Bedachtnahme auf die damals als maßgebend erachteten Erwägungen eine andere Beurteilung jener Umstände, die seinerzeit den Grund für die Abweisung des Parteienbegehrens gebildet haben, nicht von vornherein als ausgeschlossen gelten kann.
3.1.1. Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides (Asyl):
Wie bereits in den Feststellungen und der Beweiswürdigung dargestellt, bezog sich der Beschwerdeführer lediglich auf die im Erstverfahren bereits geltend gemachten Fluchtgründe (Verfolgung durch Al-Shabaab). Über das Bestehen/Nichtbestehen und die rechtliche Qualifikation dieser Gründe wurde bereits im Verfahren über den ersten Antrag auf internationalen Schutz rechtskräftig abgesprochen. Eine sonstige relevante Änderung bezüglich für die Asylgewährung maßgeblicher Umstände wurde nicht substantiiert behauptet und im Ergebnis die – unzulässige – Neuaufrollung des Verfahrens angestrebt.
Die Beschwerde war daher hinsichtlich Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides als unbegründet abzuweisen.
3.1.2. Zu Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides (subsidiärer Schutz):
Ein Antrag auf internationalen Schutz richtet sich aber auch auf die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten und daher sind auch Sachverhaltsänderungen, die ausschließlich subsidiäre Schutzgründe betreffen, von den Asylbehörden im Rahmen von Folgeanträgen einer Prüfung zu unterziehen (vgl. VwGH 19.02.2009, 2008/01/0344).
Wie sich aus den Feststellungen iZm der Beweiswürdigung ergibt, liegen hinsichtlich der Versorgungslage seit dem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 10.07.2019 Änderungen des Sachverhaltes vor, denen maßgebliche rechtliche Relevanz hinsichtlich einer Zuerkennung des Status der subsidiär Schutzberechtigten zukommt, sodass eine andere rechtliche Beurteilung des nunmehrigen Antrags – in Ansehung der Entscheidung über den ersten Antrag auf internationalen Schutz – nicht von vornherein ausgeschlossen ist. Der Beschwerdeführer behauptet einerseits sein Gesundheitszustand habe sich verschlechtert und seine Familie habe inzwischen fliehen müssen. Darüber hinaus waren die humanitären Bedürfnisse in Somalia bereits Ende letzten Jahres hoch und haben sich zudem im Jahr 2022 die Ernährungsbedingungen in Somalia rapide verschlechtert sowie der Dürrenotstand verschärft. Die bestehende Dürrekrise würde der Krise von 2016/2017 in vielerlei Hinsicht ähneln und sei teilweise schon schlimmer. Zusätzlich wird aufgrund des Krieges in der Ukraine eine Verschärfung der Hungerkatastrophe in Ostafrika aufgrund eines Exportrückgangs und steigender Weltmarktpreise befürchtet. Angesichts dessen kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass eine Situation vorliegt, die den Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Somalia einer realen Gefahr einer Verletzung seiner verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte gemäß Art. 2 und 3 EMRK aussetzt.
Folglich war Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides ersatzlos zu beheben. Die belangte Behörde wird sich im fortzusetzenden Verfahren inhaltlich mit dem Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz betreffend die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten auseinandersetzen zu haben. Dabei werden allfällige aktuelle Entwicklungen bzw. Berichte hinsichtlich die Versorgungslage, insbesondere bezüglich der Dürresituation und zu möglichen Auswirkungen des Ukrainekrieges, zu berücksichtigen sein.
3.2. Zu Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides (Aufenthaltstitel nach § 57 AsylG)
Aufgrund der Behebung hinsichtlich Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides war in weiterer Folge dem darauf aufbauenden Spruchpunkt III. die Grundlage entzogen, weshalb auch dieser zu beheben waren.
Zum Entfall der mündlichen Verhandlung:
§ 21 Abs. 6a BFA-VG lautet: „Unbeschadet des Abs. 7 kann das Bundesverwaltungsgericht über (…) Beschwerden gegen zurückweisende Entscheidungen im Zulassungsverfahren ohne Abhaltung einer mündlichen Verhandlung entscheiden.“
Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 24 VwGVG.
Gemäß § 24 Abs. 1 des VwGVG hat das Verwaltungsgericht auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. Die Verhandlung kann nach § 24 Abs. 2 Z 1 VwGVG entfallen, wenn der das vorangegangene Verwaltungsverfahren einleitende Antrag der Partei oder die Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben oder die angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt für rechtswidrig zu erklären ist. Nach Abs. 4 leg.cit. kann, soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nichts anderes bestimmt ist, das Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, wenn die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. Nr. C 83 vom 30.03.2010 S. 389 entgegenstehen.
Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat in Bezug auf § 41 Abs. 7 AsylG 2005 in der Fassung bis 31.12.2013 unter Berücksichtigung des Art. 47 iVm. Art. 52 der Grundrechte-Charta der Europäischen Union (im Folgenden: GRC) ausgesprochen, dass das Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung in Fällen, in denen der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde erklärt erscheint oder sich aus den Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen tatsachenwidrig ist, im Einklang mit Art. 47 Abs. 2 GRC steht, wenn zuvor bereits ein Verwaltungsverfahren stattgefunden hat, in dessen Rahmen Parteiengehör gewährt wurde. Hat die beschwerdeführende Partei hingegen bestimmte Umstände oder Fragen bereits vor der belangten Behörde releviert oder sind solche erst nachträglich bekannt geworden, ist die Durchführung einer mündlichen Verhandlung erforderlich, wenn die von der beschwerdeführenden Partei bereits im Verwaltungsverfahren oder in der Beschwerde aufgeworfenen Fragen - allenfalls mit ergänzenden Erhebungen - nicht aus den Verwaltungsakten beantwortet werden können, und insbesondere, wenn der Sachverhalt zu ergänzen oder die Beweiswürdigung mangelhaft ist (VfGH 14.03.2012, U 466/11-18, U 1836/11-13).
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat mit Erkenntnis vom 28.05.2014, Zl. Ra 2014/20/0017 und 0018-9, für die Auslegung der in § 21 Abs. 7 BFA-VG enthaltenen Wendung "wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint" unter Bezugnahme auf das Erkenntnis des VfGH vom 12.03.2012, Zl. U 466/11 ua., festgehalten, dass der für die rechtliche Beurteilung entscheidungswesentliche Sachverhalt von der Verwaltungsbehörde vollständig in einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben worden sein und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes immer noch die gesetzlich gebotene Aktualität und Vollständigkeit aufweisen muss. Die Verwaltungsbehörde muss die die entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende Beweiswürdigung in ihrer Entscheidung in gesetzmäßiger Weise offen gelegt haben und das Bundesverwaltungsgericht die tragenden Erwägungen der verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung teilen. In der Beschwerde darf kein dem Ergebnis des behördlichen Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder darüber hinaus gehender für die Beurteilung relevanter Sachverhalt behauptet werden, wobei bloß unsubstantiiertes Bestreiten des von der Verwaltungsbehörde festgestellten Sachverhaltes ebenso außer Betracht bleiben kann wie ein Vorbringen, das gegen das in § 20 BFA-VG festgelegte Neuerungsverbot verstößt. Schließlich ist auf verfahrensrechtlich festgelegte Besonderheiten bei der Beurteilung Bedacht zu nehmen.
Da der angefochtene Bescheid hinsichtlich der Spruchpunkte II. und III. ersatzlos zu beheben war, konnte diesbezüglich die in der Beschwerde beantragte Abhaltung einer mündlichen Verhandlung unterbleiben. Im Übrigen sind die oben genannten Kriterien im vorliegenden Fall erfüllt, da der Sachverhalt durch die belangte Behörde vollständig erhoben wurde und nach wie vor die gebotene Aktualität aufweist. Die Beweiswürdigung des Bundesamtes wurde seitens des Bundesverwaltungsgerichtes in ihren entscheidungsmaßgeblichen Aspekten bestätigt. Des Weiteren findet sich in der Beschwerdeschrift ein nicht ausreichend substantiiertes Vorbringen, welches im konkreten Fall nicht dazu geeignet ist, die erstinstanzliche Entscheidung in Frage zu stellen. Was das Vorbringen in der Beschwerde zu den Spruchpunkt I. betrifft, so findet sich in dieser insbesondere kein neues Tatsachenvorbringen und wird den beweiswürdigenden Erwägungen des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl auch nicht in substantiierter Weise entgegengetreten. Da die Behörde diesbezüglich den für die gegenständliche Beurteilung erforderlichen Sachverhalt bereits im Rahmen des angefochtenen Bescheides vollständig festgestellt hat, waren seitens des Bundesverwaltungsgerichtes keine zusätzlichen Ermittlungsergebnisse heranzuziehen, weshalb die Abweisung der Beschwerde keiner weiteren mündlichen Erörterung bedurfte, wenngleich in der Beschwerde ein Antrag auf Abhaltung einer mündlichen Verhandlung gestellt wurde. Damit ist der maßgebliche Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als geklärt anzusehen (vgl. dazu auch § 27 VwGVG), wobei eine mündliche Erörterung auch keine weitere Klärung der Rechtssache erwarten lässt. Die Abhaltung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung konnte sohin gemäß § 21 Abs. 6a und 7 BFA-VG iVm § 24 VwGVG unterbleiben.
Zu B) Unzulässigkeit der Revision:
Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. Nach Art. 133 Abs. 4 erster Satz B-VG idF BGBl. I Nr. 51/2012 ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.
Im vorliegenden Fall ist die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich nämlich bei allen erheblichen Rechtsfragen auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichthofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen, die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen wiedergegeben.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)